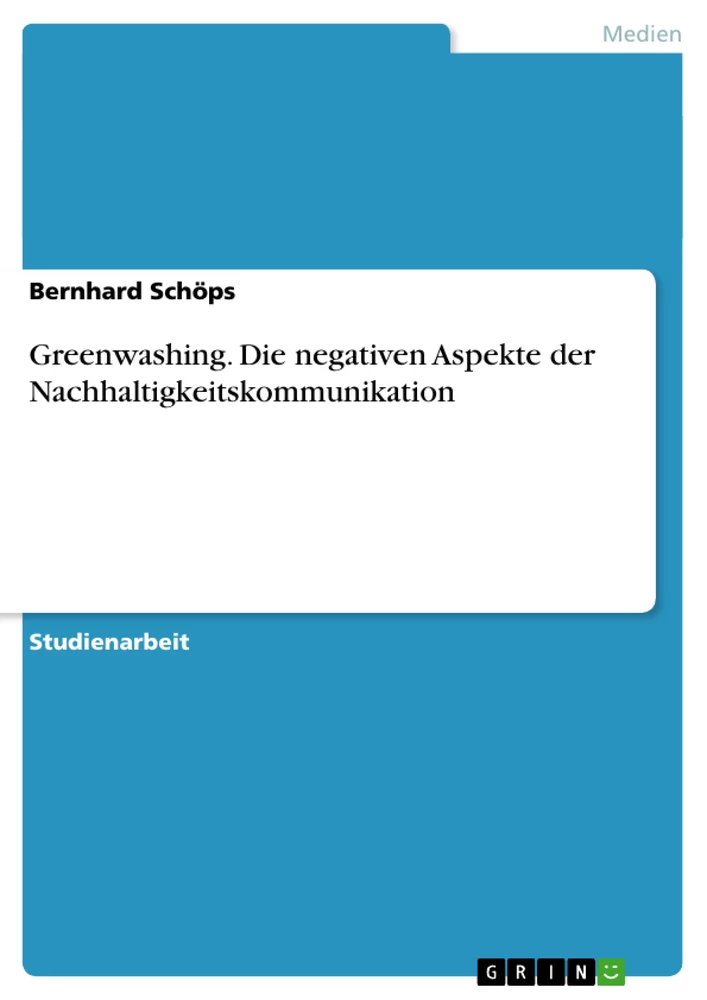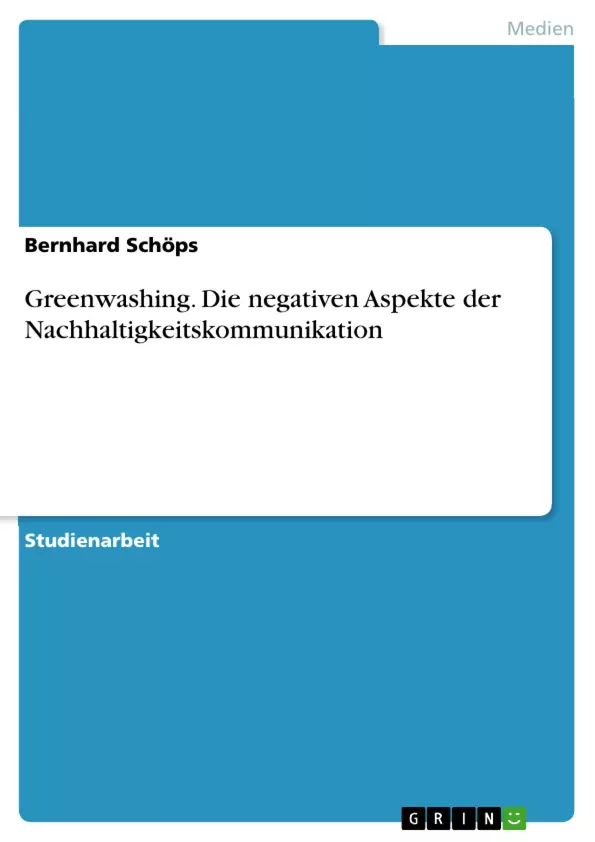Wahrscheinlich mit der ersten Erdölkrise 1973, jedenfalls jedoch mit der zweiten im Jahr 1979, erkannte die breite Masse der Menschheit, dass die Ressourcen dieser Erde, auf welche der Wohlstand der Bevölkerung der nördlichen Hemisphäre aufgebaut ist, nicht unerschöpflich sind. Die durch die hohen Treibstoffpreise von heute auf morgen leer gefegten Autobahnen verdeutlichten sehr drastisch, dass ohne eine effizientere Nutzung selbiger Rohstoffe, zukünftige Generationen wohl einen Großteil ihrer individuellen Mobilität, aber vor allem auch ihres individuellen Wohlstands einbüßen würden. Und diese Erkenntnis beschränkte sich nicht nur auf das Öl und der damit verbundenen Mobilität. Umweltschützer und -aktivisten – quasi „die Grünen“ der ersten Stunde – wurden vor diesen Ereignissen bezüglich ihrer Ideen, die vorhandenen Ressourcen sparsam zu verwenden, Recycling zu betreiben und generell Energie aus anderen Rohstoffen, denn aus Öl zu beziehen (und auch nicht aus der Atomenergie…), sprich mit den vorhandenen Mitteln nachhaltig umzugehen, bis dahin im besten Fall mit einem Lächeln belohnt. Dies änderte sich ab diesem Zeitpunkt drastisch. Ihre Vorschläge fanden in der Bevölkerung immer mehr Anklang und verloren auch „den Charakter der Idee des linken Aktivisten“. Es war chic geworden „grün“ zu denken, nachhaltig zu denken, an die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen zu denken.[...] Und schließlich entdeckten auch die Unternehmer und Wirtschaftstreibenden nachhaltiges Denken für sich und ihre Unternehmen. Ohne dabei einigen Individualisten und Idealisten der Gilde der Unternehmer ihre Vorreiterrolle streitig machen, oder gar ihren guten Willen in Frage stellen zu wollen, erkannte man, dass damit wirtschaftlich gesehen auf mehreren Ebenen Geld entweder einzusparen oder zu verdienen war. Beispielsweise wurde einerseits die Neuanschaffung ökonomisch und ökologisch sparsamer arbeitender Maschinen seitens der Regierungen finanziell unterstützt und etwa durch günstige Kredite verstärkt schmackhaft gemacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Aufbau der Arbeit
- 2. Methodik dieser Arbeit
- 3. Relevanz des Themas
- 4. Thematische Abgrenzung
- 5. Forschungsfragen
- 6. Gegenstandsbenennung/Begriffsdefinitionen
- 6.1 Definition des Begriffs Public Relations
- 6.2 „Stakeholder“ beziehungsweise „Gruppe der Öffentlichkeit“
- 6.3 Definition des Begriffs Nachhaltigkeit
- 6.4 Definition des Begriffs „CSR - Corporate Social Responsibility“
- 6.5 Definition des Begriffs Nachhaltigkeitsmanagement/unternehmerische Nachhaltigkeit
- 6.6 Definition des Begriffs „CSR - Corporate Social Responsibility“
- 6.7 Unterscheidung „Nachhaltigkeit“ („Corporate Sustainability“) und „Gesellschaftliche Verantwortung“ („CSR – Corporate Social Responsibility“)
- 6.8 Definition des Begriffs Greenwashing
- 6.9 Was ist eine ISO-Zertifizierung und welchen Sinn hat sie?
- 6.10 Die ISO-Zertifizierung 14001 - Umweltmanagement
- 7. Greenwashing – Die negativen Aspekte der Nachhaltigkeitskommunikation
- 7.1 Warum Nachhaltigkeit?
- 7.2 Greenwashing – Eine Erfindung unserer Tage?
- 7.3 Wie kann man Greenwashing erkennen?
- 7.4 Wer betreibt Greenwashing und welcher Zweck ist damit verbunden?
- 7.5 Die „Umweltzertifizierung nach ISO 14001“ und ihre atomaren Stilblüten
- 7.6 Welcher PR-Technischen Mittel und Wege bedienen sich Unternehmen die Greenwashing betreiben?
- 7.7 Bluewashing, Sweatwashing,... – die anderen Formen des Greenwashing
- 7.8 Exkurs „Greenwash-Trackers“
- 8. Fazit und Erkenntnisse
- 9. Recherchebericht
- 10. Literaturverzeichnis
- 10.1 Literaturliste
- 10.2 Online-Quellen
- 10.3 Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht kritisch den Begriff Greenwashing und seine negativen Aspekte in der Nachhaltigkeitskommunikation. Ziel ist es, die Definition und Erscheinungsformen von Greenwashing zu beleuchten und die dahinterliegenden Motive zu analysieren. Die Arbeit befasst sich mit der Relevanz von Nachhaltigkeitskommunikation im Kontext unternehmerischen Handelns und hinterfragt die Sinnhaftigkeit von Umweltzertifizierungen im Lichte von Greenwashing-Praktiken.
- Definition und Abgrenzung von Greenwashing
- Analyse der Motive und Strategien von Greenwashing
- Kritische Betrachtung von Umweltzertifizierungen (z.B. ISO 14001)
- Der Zusammenhang zwischen Greenwashing und Corporate Social Responsibility (CSR)
- Die Rolle der Public Relations in der Nachhaltigkeitskommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Aufbau der Arbeit: Die Einleitung führt in das Thema Greenwashing ein und stellt die Relevanz der Arbeit heraus, indem sie ein Beispiel eines Atomkraftwerks mit ISO 14001 Zertifizierung anführt und die kritische Auseinandersetzung mit CSR und nachhaltigem Wirtschaften im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen thematisiert. Der deduktive Aufbau der Arbeit wird erläutert, der vom Allgemeinen zum Besonderen führt, beginnend mit der Relevanz des Themas und der Arbeit selbst, gefolgt von der Abgrenzung, Forschungsfragen, Begriffsdefinitionen und dem Hauptteil, der sich mit Greenwashing auseinandersetzt und die Forschungsfragen beantwortet, abschließend mit einem Fazit.
2. Methodik: Diese Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz der Literaturanalyse und -recherche, um die Forschungsfragen zu beantworten. Als Zitationssystem wird das Harvard Citation and Referencing System verwendet. Es wird betont, dass es sich um eine Seminararbeit handelt, deren Umfang die umfassende Literaturrecherche einschränkt, obwohl Teile der Arbeit in die anstehende Diplomarbeit einfließen werden.
3. Relevanz des Themas: (Die Zusammenfassung für Kapitel 3 fehlt im Originaltext und kann hier nicht erstellt werden.)
4. Thematische Abgrenzung: (Die Zusammenfassung für Kapitel 4 fehlt im Originaltext und kann hier nicht erstellt werden.)
5. Forschungsfragen: (Die Zusammenfassung für Kapitel 5 fehlt im Originaltext und kann hier nicht erstellt werden.)
6. Gegenstandsbenennung/Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert zentrale Definitionen für Begriffe wie Public Relations, Stakeholder, Nachhaltigkeit, CSR und Nachhaltigkeitsmanagement. Es differenziert zwischen Nachhaltigkeit und CSR und definiert Greenwashing. Weiterhin wird die ISO-Zertifizierung, insbesondere die ISO 14001 für Umweltmanagement, erklärt. Diese Kapitel legt die Grundlage für die spätere Analyse von Greenwashing.
7. Greenwashing – Die negativen Aspekte der Nachhaltigkeitskommunikation: Kapitel 7 bildet den Kern der Arbeit. Es untersucht die Motive hinter der Nachhaltigkeit und beleuchtet die Geschichte und Erkennung von Greenwashing. Der Schwerpunkt liegt auf den Akteuren, den Zielen und den PR-Methoden, die beim Greenwashing zum Einsatz kommen. Zusätzlich werden alternative Formen des Greenwashing (z.B. Bluewashing) diskutiert, und der Begriff „Greenwash-Tracker“ wird eingeführt. Das Kapitel analysiert kritisch die „Umweltzertifizierung nach ISO 14001“ an einem konkreten Beispiel.
Schlüsselwörter
Greenwashing, Nachhaltigkeitskommunikation, Corporate Social Responsibility (CSR), Umweltzertifizierung, ISO 14001, Public Relations, Stakeholder, Nachhaltigkeit, Unternehmenskommunikation, kritische PR.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Greenwashing in der Nachhaltigkeitskommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert kritisch Greenwashing und seine negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitskommunikation. Sie beleuchtet Definitionen, Erscheinungsformen und Motive von Greenwashing und hinterfragt den Nutzen von Umweltzertifizierungen im Kontext von Greenwashing-Praktiken. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der Public Relations und des Zusammenhangs zwischen Greenwashing und Corporate Social Responsibility (CSR).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Aufbau, Methodik, Relevanz des Themas, Thematische Abgrenzung, Forschungsfragen, Begriffsdefinitionen (inkl. Public Relations, Stakeholder, Nachhaltigkeit, CSR, ISO-Zertifizierung 14001), Greenwashing und seine negativen Aspekte, Fazit und Erkenntnisse, Recherchebericht und Literaturverzeichnis.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturanalyse und -recherche, wobei das Harvard Citation and Referencing System zur Zitation verwendet wird. Der Umfang als Seminararbeit begrenzt die Tiefe der Literaturrecherche.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie Public Relations, Stakeholder, Nachhaltigkeit, CSR, Nachhaltigkeitsmanagement, Greenwashing und die ISO-Zertifizierung 14001. Es wird auch ein Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und CSR herausgearbeitet.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels zu Greenwashing?
Das Kapitel zu Greenwashing untersucht die Motive hinter der Nachhaltigkeitskommunikation, die Geschichte und Erkennung von Greenwashing, die beteiligten Akteure, deren Ziele und eingesetzten PR-Methoden. Es werden auch alternative Formen wie Bluewashing behandelt und „Greenwash-Tracker“ eingeführt. Eine kritische Analyse der ISO 14001-Zertifizierung an einem Beispiel ist enthalten.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
(Die konkreten Forschungsfragen werden im Originaltext nicht explizit zusammengefasst. Sie müssen im Haupttext der Arbeit nachgeschlagen werden.)
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen werden im Originaltext nicht explizit zusammengefasst. Sie müssen im Kapitel "Fazit und Erkenntnisse" der Arbeit nachgeschlagen werden.)
Welche Literatur wird verwendet?
Das Literaturverzeichnis umfasst eine Literaturliste, Online-Quellen und ein Abbildungsverzeichnis (genaue Quellenangaben sind im vollständigen Dokument enthalten).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Greenwashing, Nachhaltigkeitskommunikation, Corporate Social Responsibility (CSR), Umweltzertifizierung, ISO 14001, Public Relations, Stakeholder, Nachhaltigkeit, Unternehmenskommunikation, kritische PR.
Gibt es ein Beispiel, das in der Arbeit verwendet wird?
Die Arbeit verwendet als Beispiel ein Atomkraftwerk mit ISO 14001 Zertifizierung, um die kritische Auseinandersetzung mit CSR und nachhaltigem Wirtschaften zu verdeutlichen.
- Arbeit zitieren
- Bernhard Schöps (Autor:in), 2009, Greenwashing. Die negativen Aspekte der Nachhaltigkeitskommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/135670