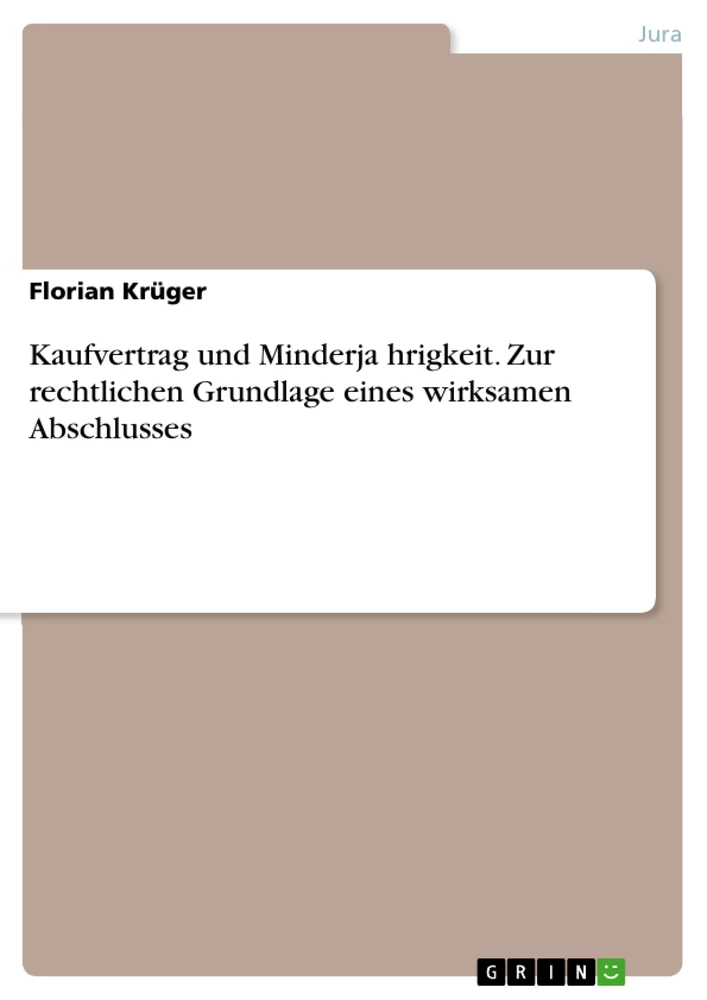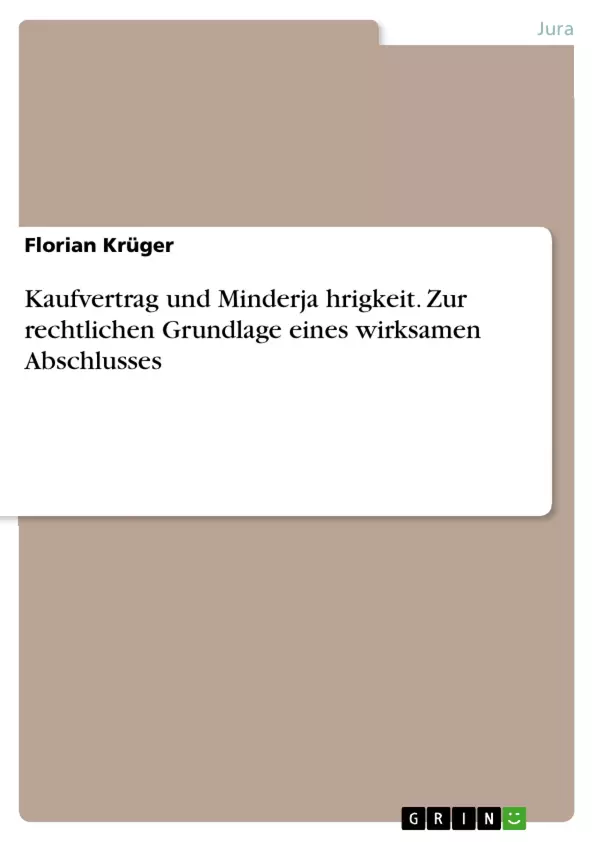Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Problem des wirksamen Abschlusses eines Kaufvertrags mit Minderjährigen. Hierzu gibt das bürgerliche Gesetzbuch zwar Regeln vor, welche im alltäglichen Geschäftsleben beachtet werden müssen. Jedoch kommt es oftmals zu strittigen Kaufgeschäften. Eltern sind nicht immer mit den Einkäufen ihrer Kinder einverstanden. Ob es nun Süßigkeiten, Videospiele oder Kleider sind. Auch Minderjährige können in einem eingeschränkten Rahmen Kaufverträge abschließen. Eine Zustimmung der Eltern ist in bestimmten Fällen kein Muss. In diesen Fällen müssen dann Fachkommentierungen, Rechtsprechungen und die Betrachtung der Lebensgewohnheiten des jeweiligen Minderjährigen herangezogen werden, um die entsprechende Situation beurteilen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtsgrundlagen
- Rechtliche Vorteilhaftigkeit (§ 107 BGB)
- Beispiele
- Eigene Mittel (§ 110 BGB)
- Urteil des AG München vom 17.03.2011 - 213 C 917/11
- Vertragsschluss ohne Einwilligung (§§ 108, 109 BGB)
- Widerrufsrecht des anderen Teils (§ 109 BGB)
- Einseitige Rechtsgeschäfte (§ 111 BGB)
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Wirksamkeit von Kaufverträgen, die von Minderjährigen abgeschlossen werden. Sie beleuchtet die relevanten Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen. Die Arbeit untersucht dabei die Problematik strittiger Kaufgeschäfte und die Rolle der Erziehungsberechtigten.
- Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen nach BGB
- Rechtliche Vorteilhaftigkeit von Willenserklärungen (§ 107 BGB)
- Auswirkungen der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter
- Vertragsschluss ohne Einwilligung (§§ 108, 109 BGB)
- Bedeutung von Rechtsprechung und Lebensgewohnheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Kaufvertragsabschlusses mit Minderjährigen ein und hebt die Problematik strittiger Kaufgeschäfte hervor. Sie betont die Notwendigkeit, Rechtsgrundlagen, Rechtsprechung und Lebensumstände des Minderjährigen zu berücksichtigen, um die jeweilige Situation korrekt einzuschätzen. Die alltägliche Konfrontation von Einzelhändlern mit diesem Problem und die damit verbundenen Risiken werden deutlich gemacht, insbesondere die Schwierigkeit, im Nachhinein Behauptungen über die Ausgabenbefugnis des Minderjährigen zu widerlegen.
Rechtsgrundlagen: Dieses Kapitel behandelt die gesetzlichen Grundlagen der Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen gemäß §§ 104 Nr. 1 und 106 i.V.m. §§ 107 ff. BGB. Es wird die beschränkte Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen ab sieben Jahren und die Geschäftsunfähigkeit von jüngeren Kindern erläutert. Die Paragraphen bilden die Basis für die weitere Analyse der rechtlichen Aspekte von Kaufverträgen mit Minderjährigen.
Rechtliche Vorteilhaftigkeit (§ 107 BGB): Dieses Kapitel erklärt den § 107 BGB, der besagt, dass Minderjährige für Willenserklärungen, die nicht lediglich rechtlich vorteilhaft sind, die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters benötigen. Es wird zwischen Willenserklärungen mit rein rechtlichem Vorteil (z.B. Kauf zu besonders günstigem Preis) und solchen unterschieden, die dies nicht sind (z.B. Erwerb einer Eigentumswohnung mit verbundenen Verpflichtungen). Beispiele verdeutlichen den Unterschied und die damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen.
Schlüsselwörter
Minderjährigkeit, Kaufvertrag, Geschäftsfähigkeit, §§ 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 BGB, Einwilligung, gesetzlicher Vertreter, rechtliche Vorteilhaftigkeit, Willenserklärung, Rechtsgeschäft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Wirksamkeit von Kaufverträgen mit Minderjährigen"
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Diese Ausarbeitung untersucht die Wirksamkeit von Kaufverträgen, die von Minderjährigen abgeschlossen werden. Sie beleuchtet die relevanten Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen. Die Arbeit untersucht dabei die Problematik strittiger Kaufgeschäfte und die Rolle der Erziehungsberechtigten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt die Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen nach BGB, die rechtliche Vorteilhaftigkeit von Willenserklärungen (§ 107 BGB), die Auswirkungen der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter, den Vertragsschluss ohne Einwilligung (§§ 108, 109 BGB) und die Bedeutung von Rechtsprechung und Lebensgewohnheiten. Sie umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den Rechtsgrundlagen, der rechtlichen Vorteilhaftigkeit (§ 107 BGB), eigenen Mitteln (§ 110 BGB), Vertragsschluss ohne Einwilligung, dem Widerrufsrecht und einseitigen Rechtsgeschäften, sowie eine Literaturliste. Ein Urteil des AG München wird ebenfalls referenziert.
Welche Rechtsgrundlagen werden betrachtet?
Die relevanten Paragraphen des BGB, insbesondere §§ 104 Nr. 1, 106, 107, 108, 109, 110 und 111 BGB, bilden die Grundlage der Analyse. Diese Paragraphen regeln die Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen und die Wirksamkeit ihrer Willenserklärungen.
Was bedeutet "rechtliche Vorteilhaftigkeit" im Kontext von Minderjährigen (§ 107 BGB)?
§ 107 BGB besagt, dass Minderjährige für Willenserklärungen, die nicht lediglich rechtlich vorteilhaft sind, die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters benötigen. Ein rein rechtlicher Vorteil liegt beispielsweise bei einem Kauf zu einem besonders günstigen Preis vor. Ein nicht lediglich rechtlicher Vorteil ist z.B. der Erwerb einer Eigentumswohnung mit verbundenen Verpflichtungen. Die Ausarbeitung liefert Beispiele zur Verdeutlichung.
Welche Rolle spielen die gesetzlichen Vertreter?
Die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter (z.B. Eltern) ist für die Wirksamkeit von Kaufverträgen mit Minderjährigen entscheidend, außer bei lediglich rechtlich vorteilhaften Geschäften. Die Ausarbeitung beleuchtet die Auswirkungen dieser Einwilligung auf die Rechtsgültigkeit des Vertrages.
Was passiert bei einem Vertragsschluss ohne Einwilligung (§§ 108, 109 BGB)?
Die Ausarbeitung behandelt die Folgen eines Vertragsschlusses ohne die erforderliche Einwilligung der gesetzlichen Vertreter gemäß §§ 108 und 109 BGB. Sie analysiert die Möglichkeiten des Widerrufs und die rechtlichen Konsequenzen für den Minderjährigen und den Vertragspartner.
Welche Bedeutung haben Rechtsprechung und Lebensgewohnheiten?
Die Ausarbeitung betont die Bedeutung der Berücksichtigung von Rechtsprechung und den Lebensumständen des Minderjährigen bei der Beurteilung der Wirksamkeit eines Kaufvertrages. Sie zeigt auf, wie diese Faktoren die Einzelfallprüfung beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Minderjährigkeit, Kaufvertrag, Geschäftsfähigkeit, §§ 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 BGB, Einwilligung, gesetzlicher Vertreter, rechtliche Vorteilhaftigkeit, Willenserklärung, Rechtsgeschäft.
- Quote paper
- Florian Krüger (Author), 2023, Kaufvertrag und Minderjährigkeit. Zur rechtlichen Grundlage eines wirksamen Abschlusses, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1356570