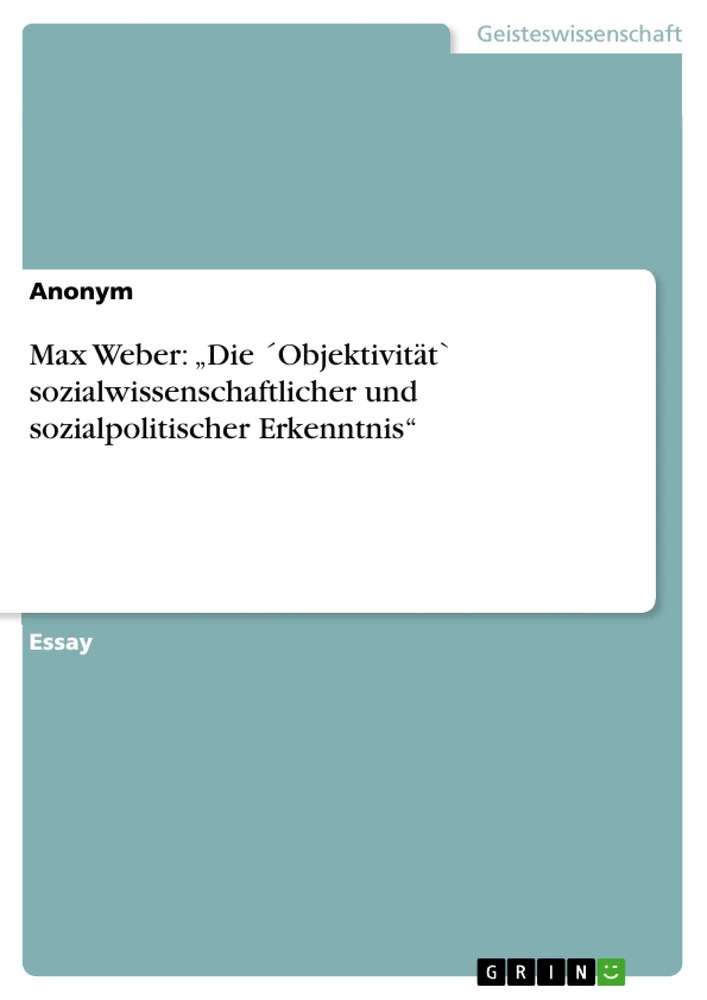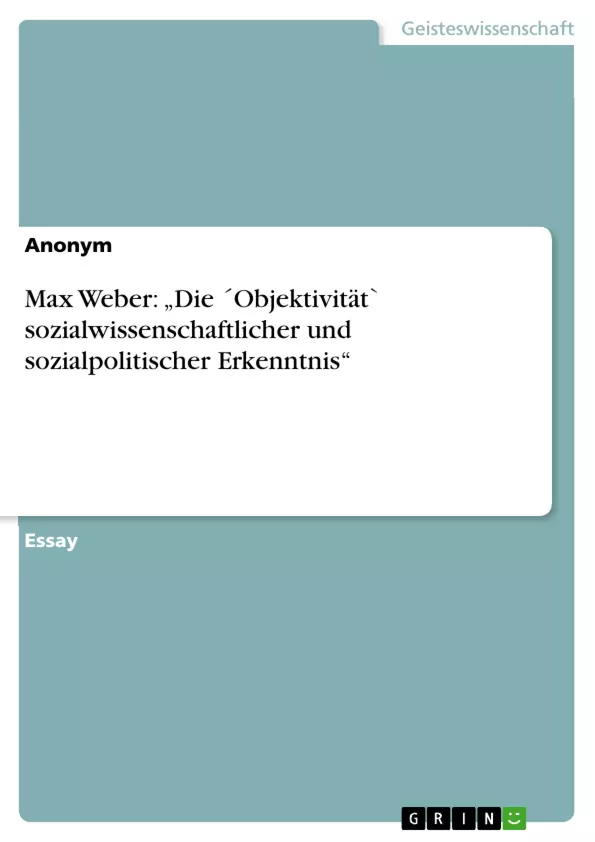Um zu verstehen, was Max Weber mit dem Begriff „Idealtyp“ meint, ist es zunächst notwendig, sich die groben Züge seiner wissenschaftlichen Theorie zu vergegenwärtigen. Max Weber gilt als Begründer der verstehenden Soziologie. Mit seinem heuristischen Wissenschaftsmodell setzte er sich vor allem ab von den etablierten scholastischen Schulen, die den Zweck wissenschaftlichen Arbeitens in absoluter – also ahistorisch gültiger – Ordnung der empirischen Wirklichkeit in Form von Begriffssystemen sahen. Empirische Realität besteht für Weber nicht mehr in absolut erkennbaren Tatsachen und sich daraus entwickelnden und ableitbaren regelhaften Zusammenhängen und Entwicklungen. Ihre „schlechthin unendliche Mannigfaltigkeit“ sei es vielmehr, die die Wirklichkeit in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit für den „endlichen Menschengeist“ kaum zu durchschauen oder systematisch zu ordnen mache. Ziel jeglicher Sozialwissenschaft ist es nun für Weber, dieses mannigfaltige Chaos verstehend zu interpretieren und zwar durch Analyse gesellschaftlicher Phänomene in Bezug auf ihre historische
Entstehung, ihre gegenwärtige Bedeutung und ihre tatsächlichen oder potentiellen Auswirkungen. Im Gegensatz zur quantitativ arbeitenden Naturwissenschaft, die ihr empirisches Interessenfeld durch Messung exakt bestimmen kann, ist die Sozialwissenschaft vor allem auf geistige Prozesse fixiert, welche es, so Weber, „nacherlebend zu ´verstehen`“ gelte.
„Der Begriff des Idealtypen bei Max Weber“
Grundlage: „Die ´Objektivität` sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“
Um zu verstehen, was Max Weber mit dem Begriff „Idealtyp“ meint, ist es zunächst notwendig, sich die groben Züge seiner wissenschaftlichen Theorie zu vergegenwärtigen.
Max Weber gilt als Begründer der verstehenden Soziologie. Mit seinem heuristischen Wissenschaftsmodell setzte er sich vor allem ab von den etablierten scholastischen Schulen, die den Zweck wissenschaftlichen Arbeitens in absoluter – also ahistorisch gültiger – Ordnung der empirischen Wirklichkeit in Form von Begriffssystemen sahen. Empirische Realität besteht für Weber nicht mehr in absolut erkennbaren Tatsachen und sich daraus entwickelnden und ableitbaren regelhaften Zusammenhängen und Entwicklungen. Ihre „schlechthin unendliche Mannigfaltigkeit“ sei es vielmehr, die die Wirklichkeit in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit für den „endlichen Menschengeist“ kaum zu durchschauen oder systematisch zu ordnen mache[1]. Ziel jeglicher Sozialwissenschaft ist es nun für Weber, dieses mannigfaltige Chaos verstehend zu interpretieren und zwar durch Analyse gesellschaftlicher Phänomene in Bezug auf ihre historische Entstehung, ihre gegenwärtige Bedeutung und ihre tatsächlichen oder potentiellen Auswirkungen. Im Gegensatz zur quantitativ arbeitenden Naturwissenschaft, die ihr empirisches Interessenfeld durch Messung exakt bestimmen kann, ist die Sozialwissenschaft vor allem auf geistige Prozesse fixiert, welche es, so Weber, „nacherlebend zu ´verstehen`“[2] gelte.
Erkenntnis bedeutet in der Sozialwissenschaft also nicht ursächliches Erklären, sondern beschreibendes Verstehen – sie steht damit zwischen dem naturwissenschaftlich kausaler Definition und literarisch narrativer Deskription. In gewisser Weise ist sie Hybrid aus beidem – und doch liegt ihr Schwerpunkt auf dem wissenschaftlichen heuristischen Charakter. Denn, so Weber, es obliege den Kulturwissenschaften, geschichtliche und zeitgenössische Vorgänge und ihre kulturelle Bedeutung „über das bloße Konstatieren konkreter Zusammenhänge hinaus“ zu charakterisieren, sie also auch in gewissem Sinn zu systematisieren. Dies ist der Punkt, von dem aus die Sprache der Wissenschaft – Begriffe, Definitionen, Hypothesen - für Weber ihre Funktion erhält. Begriffssysteme sind bei ihm nicht mehr – wie in der deduktiven Schule - Ziel sondern Hilfsmittel sozialwissenschaftlichen Forschens. Ihre Bestimmung besteht somit nicht mehr darin, Wirklichkeit originalgetreu wiederzugeben, um objektiv wahre, absolute Regelmäßigkeiten aus ihr abzuleiten. Vielmehr sollen Begriffsysteme dem Forscher helfen, empirische oder historische Wirklichkeit in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit verstehend zu erkennen. Der „Idealtyp“ hat eine zentrale Funktion in diesem sprachlichen Werkzeugkasten des Wissenschaftlers.
Was genau versteht Weber also unter einem „idealtypischen“ Begriff? Einen ersten Zugang bietet die Wortanalyse. Während „typisch“ in seiner alltäglichen Bedeutung - wesenhaft, eigentlich – verstanden werden kann, ist „ideal“ in diesem konkreten Zusammenhang nicht Synonym für „vollkommen, fehlerlos, erstrebenswert“ – es ist vielmehr das von „Idee“ abgeleitete Adjektiv - Idee im Sinne eines abstrakten, synthetischen Gedankenkomplexes. Unter einem wissenschaftlichen Idealtypus versteht Max Weber also ein wissenschaftliches Begriffsystem, das in abstrahierter Form das Wesen von etwas darstellt. Die Art des idealzutypisierenden Objektes hängt nun von der wissenschaftlichen Ausrichtung und ihrem Forschungsfeld ab – allgemein jedoch ist es die empirische Wirklichkeit, sei es in Form historischer Entwicklungen oder gegenwärtiger Konstellationen.
Kehren wir zurück zu der anfangs beschriebenen Abkehr Webers von der traditionellen deduktiv arbeitenden Schule. Auch die Begriffe, mit der sie arbeitete, waren ja abstrakter Natur, auch sie hatten in gewisser Weise den Anspruch, Wirklichkeit in ihrer Wesenhaftigkeit darzustellen. Und dennoch lässt sich gerade an der Bildung, der Art ihrer Verwendung und dem Zweck von Begriffen die Unterschiedlichkeit beider Ansätze zeigen.
Der Webersche „Idealtyp“ entsteht, indem der Wissenschaftler durch Hervorhebung bestimmter als typisch eingestufter Merkmale und durch „Zusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen“[3] ein in sich logisches, widerspruchsloses Aggregat abstrakter bzw. abstrahierter Begriffe schafft, die für ihn das Wesenhafte des untersuchten Phänomens darstellen, die er also für typisch – oder mit Weber „idealtypisch“ - hält. Wichtig ist, dass derart gebildete Begriffsysteme erstens utopischen Charakter haben, in der konstruierten logischen Konsequenz realiter also nicht zu finden sind. Zweitens haben sie keine ahistorische Gültigkeit, sondern sind vor allem von der subjektiven Individualität des einzelnen Forschers geprägt, variieren also je nach kulturellen und zeitlichen Gegebenheiten. Es müsse folglich als „sicher angesehen werden, dass mehrere, ja sicherlich jeweils sehr zahlreiche Utopien dieser Art sich entwerfen (ließen)“, schreibt Weber[4] - es würde gelegentlich mit denselben Begriffen gearbeitet, deren konkreter Sinngehalt jedoch je nach Person des Forschers, seinem Interesse, dem zeitlichen Hintergrund und geltenden Werten stark divergierten. Diese inhaltliche „Unschärfe“ stellt für Weber jedoch keinen Grund für eine Diskreditierung wissenschaftlichen Arbeitens mit Idealtypen dar, denn – und hier schließt sich der Kreis – der Anspruch von Wissenschaft ist es ja eben nicht mehr, mittels objektiver Begriffe ein detailgetreues Bild der Wirklichkeit zu schaffen oder Ergebnisse, die nur über inhaltliche Objektivität wissenschaftliche Gültigkeit erhalten. In diesem Sinne schafft der Wissenschaftler also nicht objektive Wirklichkeit genauso wenig wie subjektive Möglichkeit, sondern objektive Möglichkeit.
[...]
[1] vgl.Weber, Max „Die ´Objektivität` sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“ S.107
[2] S.173
[3] S.191
[4] S. 192
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2004, Max Weber: „Die ´Objektivität` sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/135099