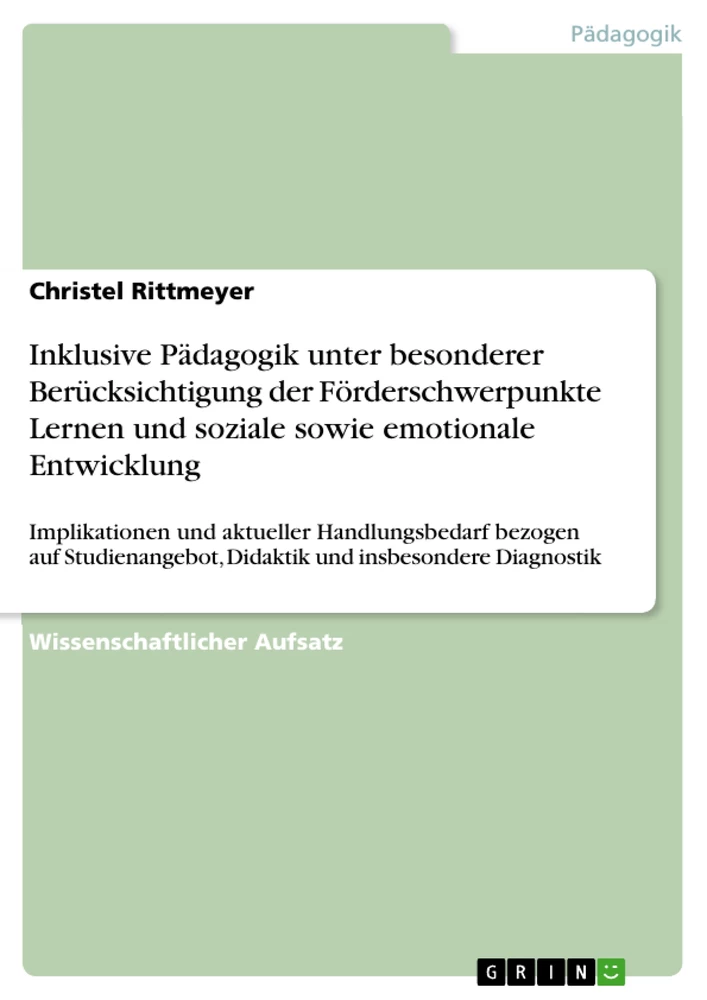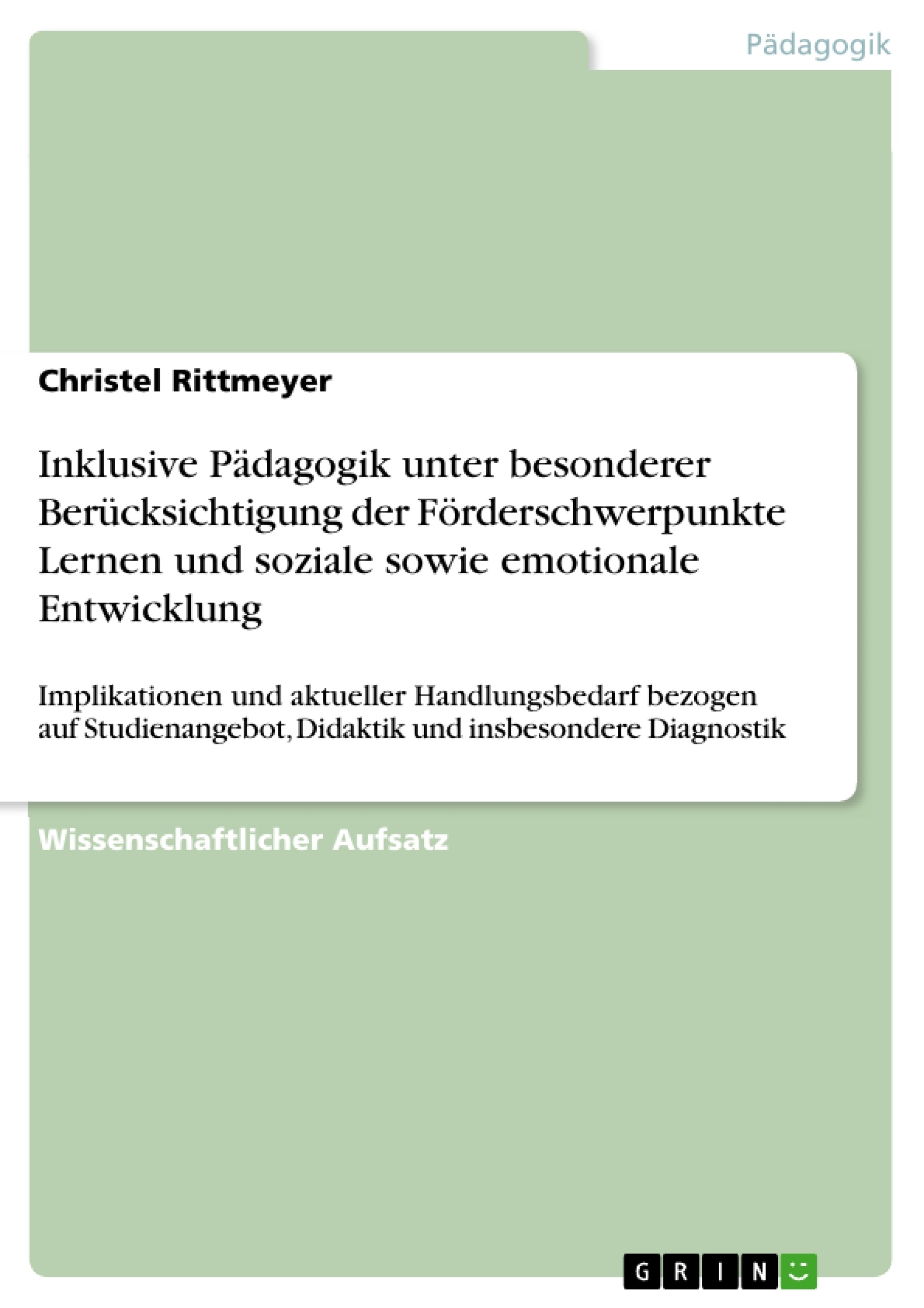Die im März 2009 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getretene UN-Konvention zum Schutze der Rechte von Menschen mit Behinderung verleiht Integration und Inklusion eine zunehmende Bedeutung. Diese Konvention wird, so meine Einschätzung, zu einer Ausweitung des GU führen. Derzeit werden im Bundesdurchschnitt rund 16 % Prozent der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im GU unterrichtet. Deren Anteil variiert von Land zu Land erheblich:
Bremen steht mit knapp 50 Prozent an der Spitze, NRW beispielsweise, aus dem ich komme, liegt bei knapp 14 Prozent (vgl. RITTMEYER 2009, 6). Berücksichtigt das aktuelle Studienangebot hinreichend diese Entwicklung? Und: gibt es das notwendige spezifische Angebot einer inklusiven Didaktik und Diagnostik? Sind zusammengefasst die notwendigen Grundlagen für den GU vorhanden?
Um diese Fragen wird es in meinem Beitrag gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Überblick
- Schulische Integration im Kontext gesellschaftlicher Inklusion
- Der Stellenwert von Integration und Inklusion im Studium
- Grundstruktur einer inklusiven Didaktik und deren potentieller Anregungscharakter für die zukünftige Schule
- Perspektiven der Weiterentwicklung
- Veränderte Sichtweisen und eine veränderte Diagnostik
- Anforderungen an eine integrative Diagnostik
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag untersucht den aktuellen Stand der inklusiven Pädagogik in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf den gemeinsamen Unterricht (GU) von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Es werden die Defizite im aktuellen Studienangebot, in der Didaktik und der Diagnostik beleuchtet und Handlungsbedarf aufgezeigt.
- Der Stellenwert von Integration und Inklusion im Studium und die Vorbereitung zukünftiger Lehrer auf den inklusiven Unterricht.
- Die Notwendigkeit einer inklusiven Didaktik und deren aktuelle Unterversorgung in der Integrationsforschung.
- Die Herausforderungen und Anforderungen an eine integrative Diagnostik.
- Die Auswirkungen der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung auf das deutsche Bildungssystem.
- Der Vergleich verschiedener Studienangebote und deren Eignung für eine inklusive Pädagogik.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Überblick: Der Text beginnt mit einer Einführung in die Thematik der inklusiven Pädagogik im Kontext der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung. Er stellt die zunehmende Bedeutung des gemeinsamen Unterrichts (GU) heraus und fragt nach der ausreichenden Berücksichtigung dieser Entwicklung im aktuellen Studienangebot, insbesondere hinsichtlich inklusiver Didaktik und Diagnostik. Die geringe Verbreitung des GU in verschiedenen Bundesländern wird hervorgehoben und die Notwendigkeit einer umfassenden Vorbereitung zukünftiger Lehrkräfte auf den inklusiven Unterricht betont.
Schulische Integration im Kontext gesellschaftlicher Inklusion: Dieses Kapitel beleuchtet die unumkehrbare Entwicklung hin zum gemeinsamen Unterricht. Im Vergleich zur Charta von Luxemburg von 1996, die keine klare Positionierung für inklusive Bildung und Erziehung bietet, wird die UN-Konvention als Wegbereiter für ein egalitäres, inklusives Schulsystem hervorgehoben, wobei auch die Möglichkeit besonderer pädagogischer Maßnahmen in speziellen Institutionen nicht ausgeschlossen wird. Der Fokus liegt auf der gesellschaftlichen Notwendigkeit und der bildungspolitischen Ausrichtung hin zu Inklusion.
Der Stellenwert von Integration und Inklusion im Studium: Dieser Abschnitt analysiert den Mangel an verbindlichen Angeboten zum gemeinsamen Unterricht an deutschen Universitäten und Hochschulen, die zukünftige Grundschullehrer ausbilden. Eine Studie von Franzowiak (2008) wird zitiert, welche die erheblichen Unterschiede im Studienangebot aufzeigt und den Mangel an Pflichtveranstaltungen zu diesem Thema offenlegt. Die unzureichende Vorbereitung zukünftiger Lehrer auf den Umgang mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird kritisch bewertet.
Grundstruktur einer inklusiven Didaktik und deren potentieller Anregungscharakter für die zukünftige Schule: Hier wird die Unterversorgung der Integrationsforschung hinsichtlich inklusiver Didaktik thematisiert. Die Arbeiten von Schumann (2006) und Seitz (2006) werden zitiert, welche die unzureichende Bearbeitung der didaktischen Fragen inklusiven Unterrichts beklagen. Der Mangel an Aussagen zur Didaktik im „Index for Inclusion“ wird ebenfalls kritisiert, und die Notwendigkeit einer umfassenderen Auseinandersetzung mit diesem Thema wird betont.
Schlüsselwörter
Inklusive Pädagogik, gemeinsamer Unterricht (GU), inklusive Didaktik, integrative Diagnostik, UN-Konvention, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Lehrerbildung, Integration, Inklusion, Studienangebot.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Beitrag: Inklusive Pädagogik in Deutschland
Was ist der Hauptfokus dieses Beitrags?
Der Beitrag untersucht den aktuellen Stand der inklusiven Pädagogik in Deutschland, insbesondere den gemeinsamen Unterricht (GU) von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Er beleuchtet Defizite im Studienangebot, der Didaktik und der Diagnostik und zeigt Handlungsbedarf auf.
Welche Themen werden im Beitrag behandelt?
Der Beitrag behandelt den Stellenwert von Integration und Inklusion im Studium, die Notwendigkeit einer inklusiven Didaktik, die Herausforderungen einer integrativen Diagnostik, die Auswirkungen der UN-Konvention, den Vergleich verschiedener Studienangebote und die Vorbereitung zukünftiger Lehrer auf inklusiven Unterricht.
Welche Kapitel umfasst der Beitrag?
Der Beitrag gliedert sich in Kapitel zu Einleitung und Überblick, schulischer Integration im Kontext gesellschaftlicher Inklusion, dem Stellenwert von Integration und Inklusion im Studium, der Grundstruktur einer inklusiven Didaktik, Perspektiven der Weiterentwicklung, veränderten Sichtweisen und Diagnostik, Anforderungen an eine integrative Diagnostik sowie Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Kritikpunkte werden im Beitrag genannt?
Der Beitrag kritisiert den Mangel an verbindlichen Angeboten zum gemeinsamen Unterricht an deutschen Universitäten, die unzureichende Berücksichtigung inklusiver Didaktik in der Integrationsforschung, die Unterversorgung der Integrationsforschung hinsichtlich inklusiver Didaktik und den Mangel an Aussagen zur Didaktik im „Index for Inclusion“.
Welche Studien und Konzepte werden erwähnt?
Der Beitrag bezieht sich auf die UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung, die Charta von Luxemburg von 1996, sowie Studien von Franzowiak (2008), Schumann (2006) und Seitz (2006) zum Thema inklusive Didaktik und Lehrerbildung.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter des Beitrags?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Inklusive Pädagogik, gemeinsamer Unterricht (GU), inklusive Didaktik, integrative Diagnostik, UN-Konvention, sonderpädagogischer Förderbedarf, Lehrerbildung, Integration, Inklusion, Studienangebot.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Beitrag?
Der Beitrag zeigt einen dringenden Handlungsbedarf im Bereich der inklusiven Pädagogik in Deutschland auf. Es wird die Notwendigkeit einer verbesserten Lehrerbildung, einer umfassenderen Auseinandersetzung mit inklusiver Didaktik und einer Weiterentwicklung der integrativen Diagnostik betont.
- Arbeit zitieren
- apl. Professor Dr. Christel Rittmeyer (Autor:in), 2009, Inklusive Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Förderschwerpunkte Lernen und soziale sowie emotionale Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/134697