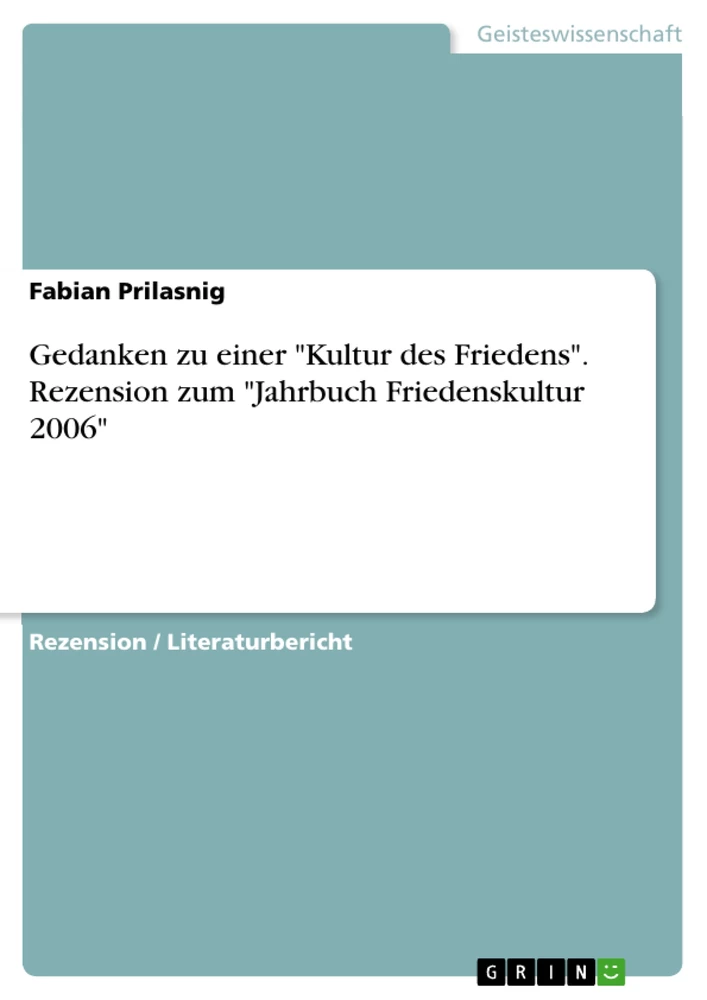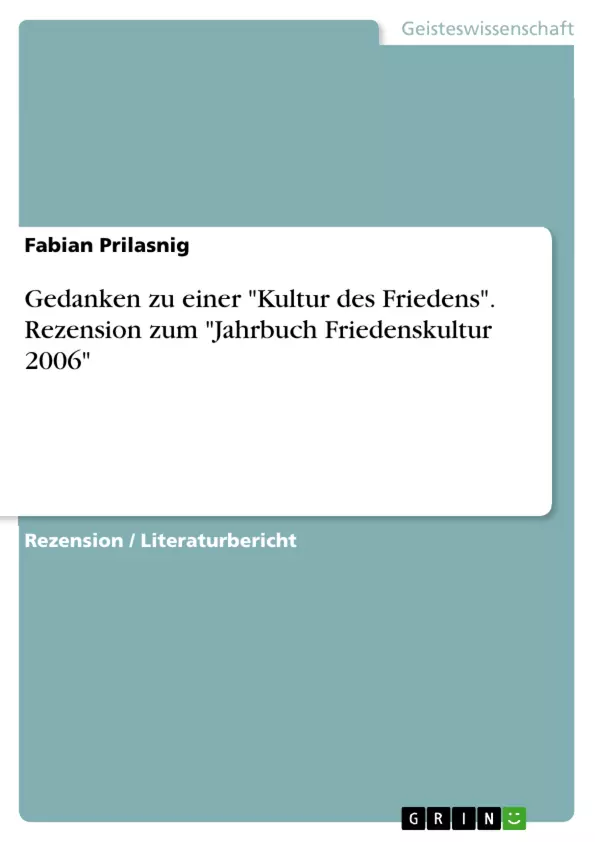Rezension zum „Jahrbuch Friedenskultur 2006“. Das „Jahrbuch Friedenskultur 2006“, herausgegeben vom „Zentrum für Friedensforschung und Friedenspädagogik“ der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, beschäftigt sich mit drei inhaltlichen Schwerpunkten: Friedensforschung und Friedenspolitik, Kultur des Friedens sowie Friedenspädagogik. Das „Jahrbuch Friedenskultur“ versteht sich als ein vielfältiger wissenschaftlicher Diskussionsbeitrag zu Friedensstudien und setzt mit der Nennung der „Friedenskultur“ einen spezifischen Schwerpunkt, der innerhalb der Friedensforschung bislang zu wenig repräsentiert war.
Inhaltsverzeichnis
- Friedensforschung und Friedenspolitik
- Frauen und Frieden
- Minderheiten in Kärnten
- Friedensprojekt Europa
- Defizite ziviler Konfliktbearbeitung
- „Transcend“-Verfahren
- Trauma Counselling Programm
- Mediation und Frieden
- Multikulturalität und das Gemeinsame Band
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Jahrbuch Friedenskultur 2006, herausgegeben vom Zentrum für Friedensforschung und Friedenspädagogik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, analysiert aktuelle Themen und Konzepte in den Bereichen Friedensforschung, Friedenspolitik, Kultur des Friedens und Friedenspädagogik. Es dient als Plattform für wissenschaftlichen Austausch und beleuchtet Fragestellungen, die in der Friedensforschung bislang unzureichend berücksichtigt wurden.
- Die Rolle von Frauen in der Friedensarbeit aus feministischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive
- Konfliktlösung und Integration von Minderheiten, insbesondere in Kärnten
- Das „Friedensprojekt Europa“ und die Notwendigkeit einer zivilen Sicherheitspolitik
- Die Bedeutung von Mediation und Konfliktbearbeitung für die Förderung des Friedens
- Die Bedeutung von Multikulturalität und die Herausforderungen der Begegnung mit dem Fremden
Zusammenfassung der Kapitel
- Im ersten Kapitel analysiert Brigitte Hipfl die Friedensarbeit von Frauen im Kontext des internationalen Projektes „1000 Women Across the Globe“ und hinterfragt traditionelle Geschlechterbilder, die die Aufrechterhaltung der Dichotomie Krieg/Frieden unterstützen. Sie fordert die Auflösung des Geschlechterdualismus und die Anerkennung der Frauen als Akteurinnen des Friedens.
- Bettina Gruber untersucht im zweiten Kapitel die Minderheitenfrage in Kärnten und skizziert ein „Friedensprojekt Europa“, das auf die Schaffung einer europäischen Identität, die Förderung der Integration von Migranten und die Weiterentwicklung der Sozialpolitik in Richtung sozialer Frieden abzielt. Die Autorin schlägt ein nachhaltiges Konfliktlösungsmodell für Kärnten vor und präsentiert konkrete Vorschläge für Maßnahmen, die die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt umsetzen könnte.
- Wilfried Graf widmet sich in seinem Beitrag den Defiziten ziviler Konfliktbearbeitung und skizziert die Prämissen und Leitideen des „Transcend-Verfahrens“, das auf die Bearbeitung von Konflikten durch dialogische und interaktive Prozesse mit den Konfliktparteien setzt.
- Barbara Preitler beschreibt im vierten Kapitel das „Trauma Counselling Programm“ in Sri Lanka, das nach der Tsunamikatastrophe 2004 in Zusammenarbeit mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt initiiert wurde und sich auf die Unterstützung von traumatisierten Menschen verschiedener ethnischer Gruppen fokussiert.
- Gerhard Falk betrachtet im fünften Kapitel die Beziehung zwischen Mediation und Frieden und betont, dass die Verwirklichung einer Friedenskultur ein Prozess ist, der durch Mediation gefördert werden kann.
- Ester Schmidt widmet sich im sechsten Kapitel der Multikulturalität und der Frage, wie ein gemeinsames Band zwischen verschiedenen Gruppen entstehen kann, das nicht auf bloßer Verständigung beruht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Jahrbuches sind Friedensforschung, Friedenspolitik, Kultur des Friedens, Friedenspädagogik, Frauen und Frieden, Minderheiten, Konfliktlösung, Integration, „Friedensprojekt Europa“, zivile Sicherheitspolitik, Mediation, Trauma, Multikulturalität und Begegnung mit dem Fremden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Jahrbuch Friedenskultur 2006“?
Ein wissenschaftlicher Diskussionsbeitrag des Zentrums für Friedensforschung der Universität Klagenfurt zu den Themen Friedenspolitik und -pädagogik.
Welche Rolle spielen Frauen in der Friedensarbeit?
Die Arbeit hinterfragt traditionelle Geschlechterbilder und fordert die Anerkennung von Frauen als eigenständige Akteurinnen des Friedens.
Was ist das „Friedensprojekt Europa“?
Ein Konzept, das auf europäische Identität, Integration von Migranten und soziale Sicherheit als Basis für dauerhaften Frieden setzt.
Was versteht man unter dem „Transcend“-Verfahren?
Ein von Wilfried Graf beschriebenes Modell zur zivilen Konfliktbearbeitung durch dialogische Prozesse mit allen Beteiligten.
Wie hängen Mediation und Friedenskultur zusammen?
Mediation wird als praktisches Werkzeug gesehen, um eine Kultur des Friedens im Alltag und in politischen Strukturen zu verankern.
Welche Minderheitenfrage wird im Jahrbuch thematisiert?
Ein Schwerpunkt liegt auf der Situation der Minderheiten in Kärnten und Modellen für ein nachhaltiges Zusammenleben.
- Arbeit zitieren
- Fabian Prilasnig (Autor:in), 2023, Gedanken zu einer "Kultur des Friedens". Rezension zum "Jahrbuch Friedenskultur 2006", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1344531