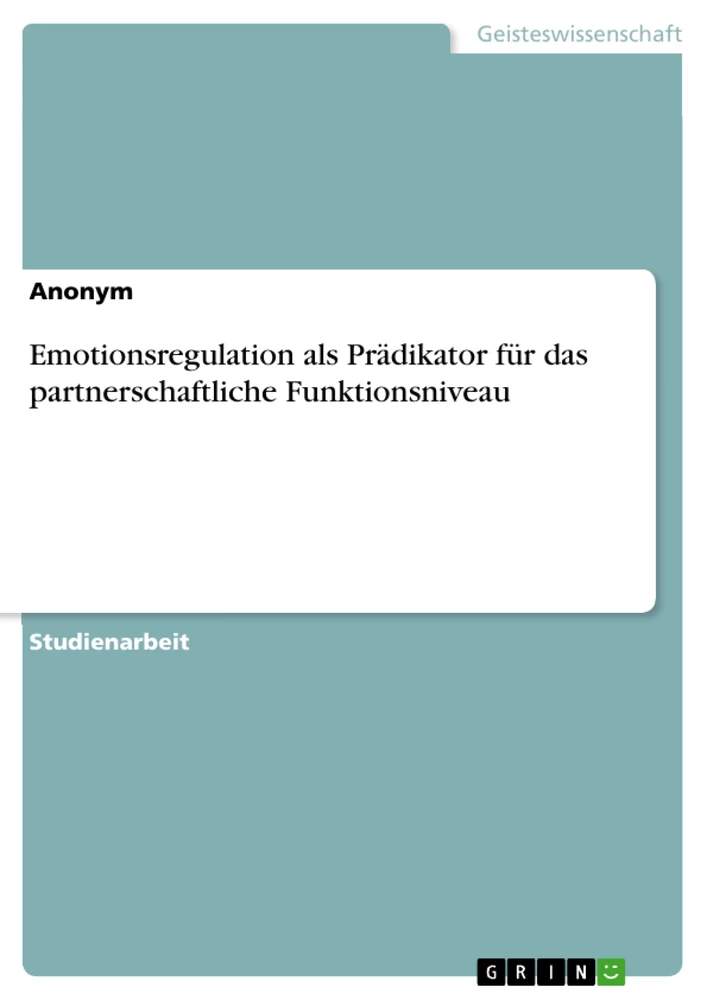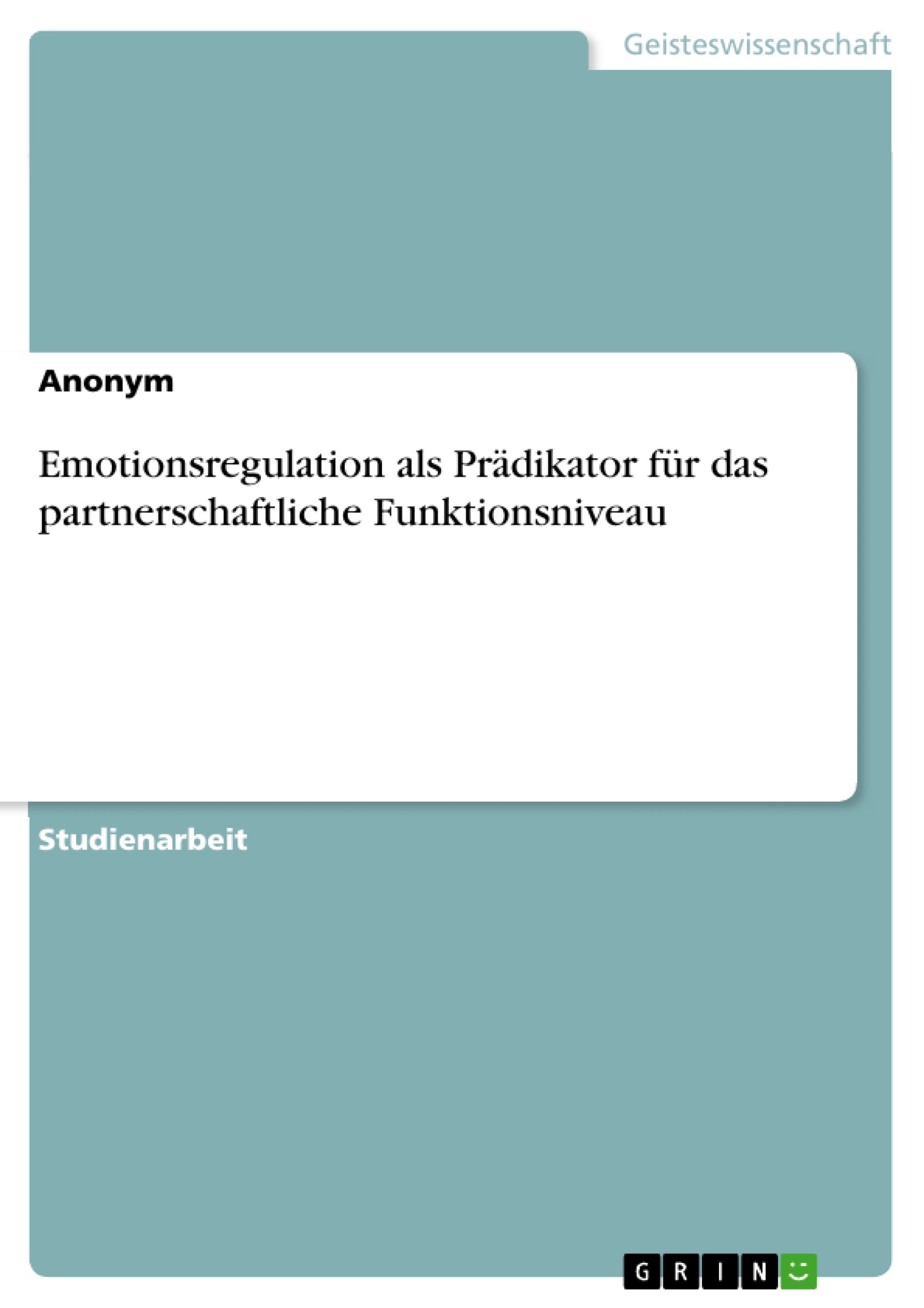Die Arbeit beschreibt die Modellierung der eigenen auftretenden negativen Emotionen als wirkungsvolle Strategie, um das Wohlbefinden in einer Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Die wissenschaftliche Arbeit widmet sich der Emotionsregulation als Prädikator für das partnerschaftliche Funktionsniveau. Die untersuchte Fragestellung lautet konkret: Inwiefern wirken sich Emotionsregulationsstrategien in Konfliktsituationen auf die Zufriedenheit in der Partnerschaft aus?
Um der Fragestellung nachzugehen, wird im ersten Abschnitt die Entstehung der Emotion und die darauf aufbauende Emotionsregulation erklärt, deren Wirkungsweise anhand des Prozessmodells von Gross und Thompson im dritten Abschnitt verbildlicht wird. Der vierte und fünfte Abschnitt gibt durch die Betrachtung zweier Untersuchungen einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand der Emotionsregulationsfähigkeit in Konfliktsituationen in der Partnerschaft. Abschließend werden die entstandenen Ergebnisse erörtert.
Nach der Arbeit noch in einem vollen Supermarkt einkaufen zu gehen, ist wahrscheinlich nicht jedermanns Idee einer schönen Zeit. Wenn dann in der Hektik auf das Smartphone geschaut und festgestellt wird, dass der Partner auf den letzten Drücker noch zahlreiche Lebensmittel dem Einkaufszettel hinzugefügt hat, entwickelt sich das Gefühl von Genervtheit zu Wut.
Dieser Umschwung macht sich in unseren Gedanken, Gefühlen, dem Verhalten und sogar im ganzen Körper bemerkbar. Der Blutdruck steigt, das Smartphone wird fest umschlossen und eine bissige Antwort formt sich im Kopf. Im letzten Moment keimt jedoch zusätzlich der Gedanke auf, dass eine provozierende Antwort die Gesamtsituation nur verschlimmern würde. Der Mund formt sich zu einem schmalen Strich und die Nachricht an den Partner wird heruntergeschluckt.
Im Paar-Alltag verlangen neben schweren Herausforderungen und offensichtlichen Krisen, viele solcher Situationen von einem ab, dass Emotionen reguliert werden. Nach Werth handelt es sich dabei oft um Kleinigkeiten, auch Daily Hassles genannt, wie offen liegen gelassene Zahnpastatuben oder Haare im Waschbecken, die das Beziehungsglück drücken können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Partnerschaft
- Emotionen
- Emotionsregulation
- Prozessmodell der Emotionsregulation
- Aktueller Forschungsstand
- Partnerschaftszufriedenheit im Zusammenhang mit Emotionsregulation
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Emotionsregulationsstrategien auf die Zufriedenheit in Partnerschaften. Die zentrale Fragestellung lautet: Inwiefern wirken sich Emotionsregulationsstrategien in Konfliktsituationen auf die Zufriedenheit in der Partnerschaft aus?
- Emotionsregulation als Prädikator für partnerschaftliches Funktionsniveau
- Einfluss von Emotionsregulationsstrategien auf Konfliktsituationen in Partnerschaften
- Zusammenhang zwischen Emotionsregulation und Partnerschaftszufriedenheit
- Prozessmodell der Emotionsregulation nach Gross und Thompson (2007)
- Aktueller Forschungsstand zur Emotionsregulation in Partnerschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Emotionsregulation im partnerschaftlichen Kontext ein. Sie beschreibt anhand eines Beispiels die Relevanz der Emotionsregulation im Alltag und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Emotionsregulationsstrategien auf die Partnerschaftszufriedenheit. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik, die zur Beantwortung dieser Frage eingesetzt werden.
Theoretische Grundlagen: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Er beleuchtet die Konzepte von Partnerschaft, Emotionen und Emotionsregulation. Es wird ein umfassendes Verständnis dieser Konzepte geschaffen, um den späteren empirischen Teil der Arbeit zu fundieren. Der Fokus liegt auf der Darstellung und Erläuterung der relevanten Theorien und Modelle. Besonderes Augenmerk gilt dem Prozessmodell der Emotionsregulation, welches als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse dient.
Aktueller Forschungsstand: Dieser Abschnitt präsentiert den aktuellen Forschungsstand zum Thema Emotionsregulation in Partnerschaften. Er gibt einen Überblick über relevante Studien und deren Ergebnisse, um den Kontext der vorliegenden Arbeit zu verdeutlichen und den eigenen Forschungsbeitrag einzubetten. Die Ergebnisse der vorgestellten Studien werden kritisch bewertet und in Bezug zu den eigenen Forschungsfragen gesetzt.
Partnerschaftszufriedenheit im Zusammenhang mit Emotionsregulation: Dieser Abschnitt untersucht den Zusammenhang zwischen Partnerschaftszufriedenheit und Emotionsregulation. Er analysiert, wie unterschiedliche Emotionsregulationsstrategien die Zufriedenheit in der Partnerschaft beeinflussen. Es werden die Daten vorgestellt und analysiert, um die Forschungsfrage zu beantworten. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen diesen beiden wichtigen Aspekten partnerschaftlicher Beziehungen.
Schlüsselwörter
Emotionsregulation, Partnerschaft, Partnerschaftszufriedenheit, Konflikt, Prozessmodell, Gross & Thompson, Forschungsstand, Strategien
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Emotionsregulationsstrategien auf die Partnerschaftszufriedenheit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Emotionsregulationsstrategien auf die Zufriedenheit in Partnerschaften. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich diese Strategien, insbesondere in Konfliktsituationen, auf die partnerschaftliche Zufriedenheit auswirken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst theoretische Grundlagen zu Partnerschaft, Emotionen und Emotionsregulation (inkl. des Prozessmodells der Emotionsregulation nach Gross & Thompson), einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Emotionsregulation und Partnerschaftszufriedenheit sowie eine abschließende Diskussion der Ergebnisse.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern wirken sich Emotionsregulationsstrategien in Konfliktsituationen auf die Zufriedenheit in der Partnerschaft aus?
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf etablierten Theorien und Modellen zu Partnerschaft, Emotionen und Emotionsregulation. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Prozessmodell der Emotionsregulation nach Gross und Thompson (2007), das als Rahmen für die Interpretation der Ergebnisse dient.
Wie wird der aktuelle Forschungsstand berücksichtigt?
Der aktuelle Forschungsstand zu Emotionsregulation in Partnerschaften wird umfassend dargestellt und kritisch bewertet. Die Arbeit setzt ihren eigenen Forschungsbeitrag in den Kontext der bestehenden Literatur ein.
Welche Methodik wird angewendet?
Die genaue Methodik wird in der Arbeit detailliert beschrieben. Die Zusammenfassung der Kapitel deutet auf eine empirische Untersuchung hin, die den Zusammenhang zwischen Emotionsregulationsstrategien und Partnerschaftszufriedenheit analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Emotionsregulation, Partnerschaft, Partnerschaftszufriedenheit, Konflikt, Prozessmodell, Gross & Thompson, Forschungsstand, Strategien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Abschnitt zu den theoretischen Grundlagen, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, einen Abschnitt zur Partnerschaftszufriedenheit im Zusammenhang mit Emotionsregulation und eine abschließende Diskussion.
Welche Erkenntnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet Erkenntnisse darüber, wie unterschiedliche Emotionsregulationsstrategien die Zufriedenheit in der Partnerschaft beeinflussen und welche Rolle diese Strategien in Konfliktsituationen spielen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Emotionsregulation als Prädikator für das partnerschaftliche Funktionsniveau, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1340212