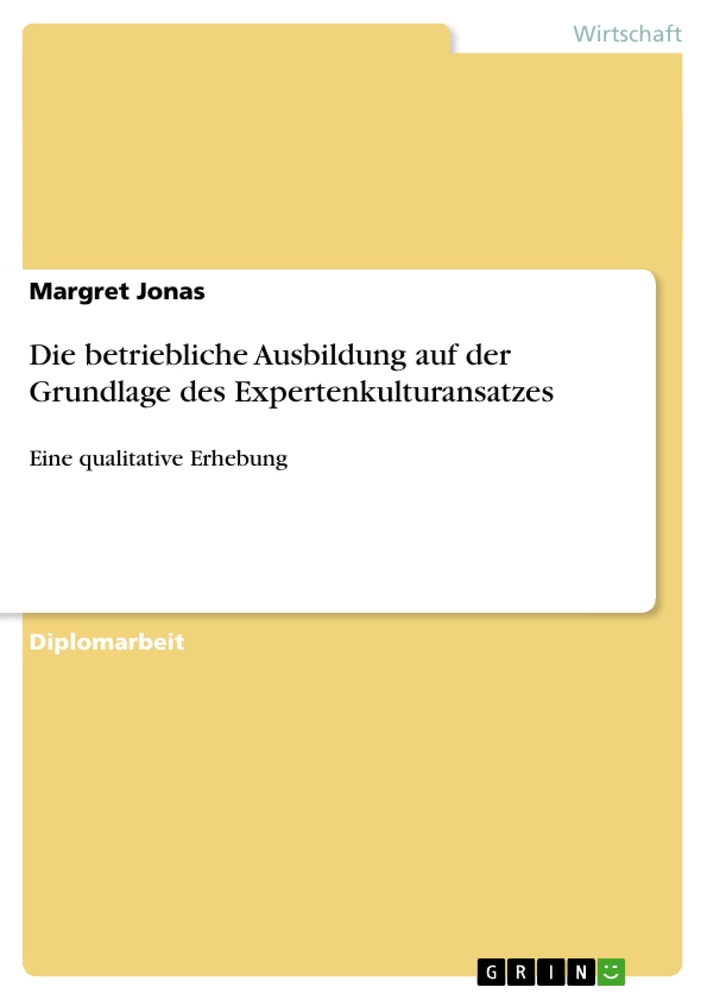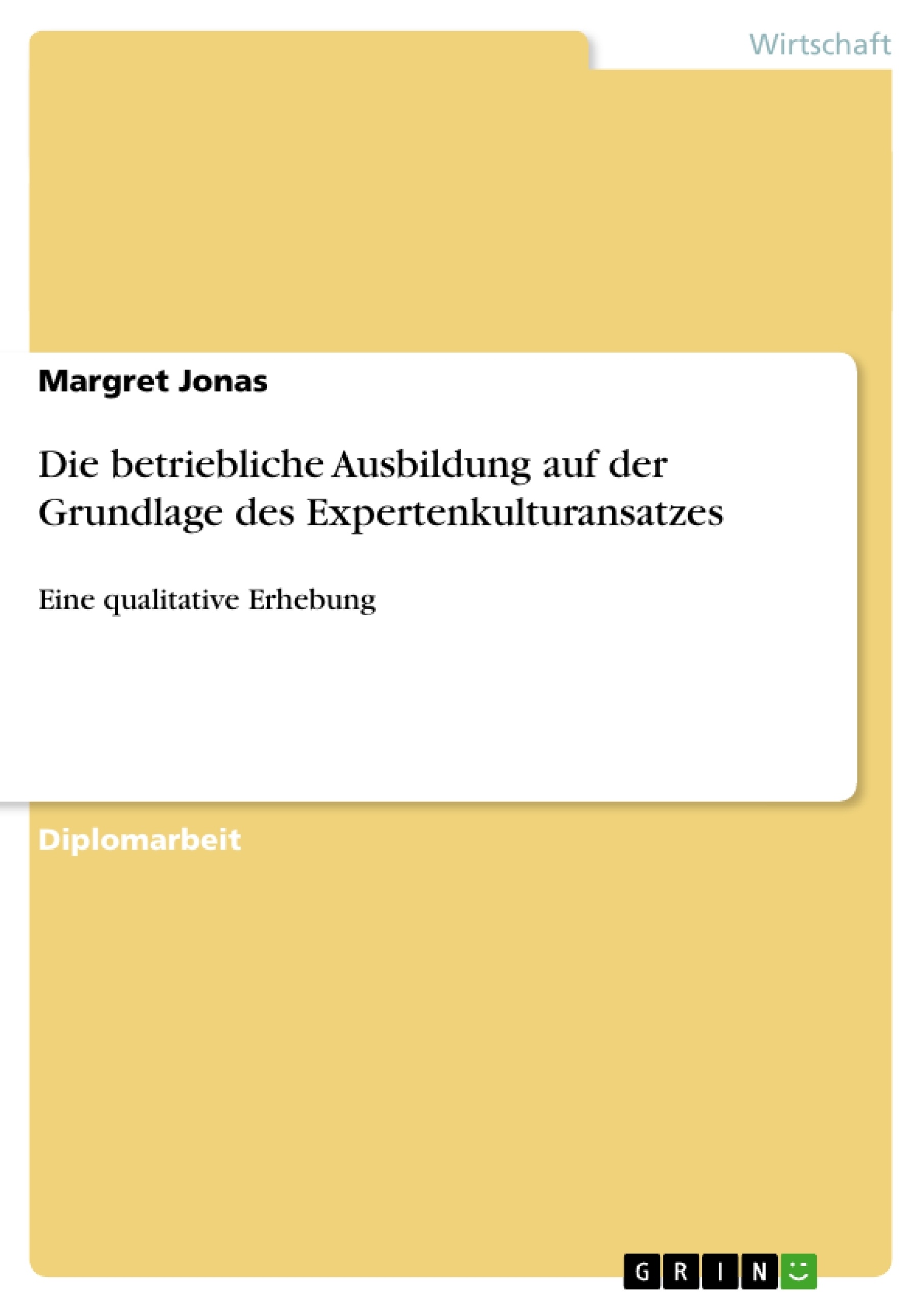Die Qualität beruflicher Ausbildung ist für die Wirtschaft wie für den Einzelnen von hoher Bedeutung. Für die Betriebe sind gut ausgebildete Fachkräfte ein wichtiger Faktor der Stand-ortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit. Für den Einzelnen beeinflusst die Qualität der Ausbildung entscheidend die Möglichkeiten der persönlichen Lebensführung sowie die Chancen der beruflichen Integration und Entwicklung. In dem Maße, in dem sich die gesellschaftlichen, demografischen und wirtschaftlichen Bedingungen wandeln, verändern sich auch die Anforderungen der einzelnen Anspruchsgruppen an die duale Berufsausbildung. Entspre-chend muss die Ausbildung kontinuierlich im Hinblick auf sich neu herausbildende Anforderungen weiterentwickelt werden.
Wenn es bei der Berufsausbildung in erster Linie um die Frage geht, wie vorhandenes Wissen und Können an die nächste Generation von Fachleuten weitergegeben wird, dann ist die Unterweisung eine angemessene Methode der Vermittlung. Sobald es in der Berufsausbildung aber auch darum geht, berufliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln und die junge Generation zu befähigen, neuartige, unvorhersehbare Probleme zu lösen sowie den ständigen Wandel zu bewältigen, reicht die Unterweisung nicht mehr aus.
Der Expertenkulturansatz, ein didaktisches Rahmenkonzept für die betriebliche Ausbildung, versucht diesen Anforderungen gerecht zu werden. Er fordert, dass die Auszubildenden in die jeweilige Expertenkultur eingebunden werden. Diese Enkulturation zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Lernenden aktiv an der Bearbeitung authentischer Problemstellungen beteiligt werden, wobei die Ausbilder ihre Vorgehensweise explizieren und begründen sowie den Lernenden effiziente Hilfestellungen geben. Ziel dieser handlungsorientierten Ausbildung ist es, Auszubildende allmählich zu domänenspezifischen Experten zu entwickeln und sie in die Arbeitswelt und in den betrieblichen Sozialisationsprozess zu integrieren. Für die Umsetzung dieser Forderungen ist ein adäquat qualifiziertes Ausbildungspersonal unerlässlich.
Insbesondere für betriebliche Ausbildungssituationen gibt es bisher nur wenige empirische Befunde über die Anwendung des Expertenkulturansatzes aus durch das ausbildende Personal. In dieser Arbeit wurde daher untersucht, inwieweit der Ansatz in der betrieblichen Ausbildungspraxis realisiert wird und inwiefern das Ausbildungspersonal für die Umsetzung der im Expertenkulturansatz geforderten Methoden qualifiziert ist.
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1 PROBLEMSTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
2 DER LERNORT BETRIEB IM RAHMEN DER DUALEN BERUFSAUSBILDUNG
2.1 Betrieblicher Nutzen der Berufsausbildung
2.2 Der Beitrag des Lernorts Betrieb zu den Ausbildungszielen
2.3 Die Ausbildungssituation im kaufmännischen Bereich
3 AUSBILDERINNEN UND AUSBILDER IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN BETRIEBLICHER REALITÄT UND PÄDAGOGISCHER NOTWENDIGKEIT
3.1 Die Situation und die Rolle der Ausbilderinnen und Ausbilder
3.2 Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals
3.2.1 Der Rahmenstoffplan für die Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder
3.2.2 Die Aussetzung der AEVO und ihre Folgen
3.3 Qualifizierung und Professionalisierung des Bildungspersonals als Ansatz der Qualitätssicherung
4 DER EXPERTENKULTURANSATZ IM RAHMEN DER BETRIEBLICHEN AUSBILDUNG
4.1 Konzeptionelle Einordnung des Ansatzes
4.2 Komponenten des Expertenkulturansatzes
4.2.1 Experten vs. Novizen
4.2.2 Lernen als Enkulturation in eine Expertenkultur
4.2.3 Ethische Legitimierung: Die Verantwortungsbereitschaft als Ziel der Berufsausbildung
4.2.4 Zur Gestaltung betrieblicher Ausbildungssituationen im Sinne des Expertenkulturansatzes: Der Cognitive Apprenticeship-Ansatz
4.2.4.1 Die Dimension Inhalt
4.2.4.2 Die Dimension Methode
4.2.4.3 Die Dimension Sequenzierung
4.2.4.4 Die Dimension soziales Umfeld
4.3 Empirische Befunde
4.3.1 Empirische Befunde zur Einbindung von Auszubildenden in die betriebliche Expertenkultur
4.3.2 Studien zu möglichen Einflussfaktoren bezüglich der Einbindung von kaufmännischen Auszubildenden in die betriebliche Expertenkultur
4.3.3 Studie zum Zusammenhang zwischen der Einbindung von kaufmännischen Auszubildenden in die betriebliche Expertenkultur und ihrem Interesse
4.3.4 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
5 STUDIE ZUR RELEVANZ DES EXPERTENKULTURANSATZES IN DER BETRIEBLICHEN AUSBILDUNG
5.1 Untersuchungsdesign
5.1.1 Rekrutierung und Beschreibung der Stichprobe
5.1.2 Inhalt und Aufbau des Erhebungsinstruments
5.2 Aufbereitung und Auswertung des Materials
5.3 Ergebnisse der Studie
5.3.1 Kategorie 1: Zugewiesene Ausbildungsaufgaben und ihre Merkmale
5.3.2 Kategorie 2: Vorgehensweise bei der Unterweisung
5.3.3 Kategorie 3: Einbindung in die Expertenkultur
5.3.4 Kategorie 4: Rahmenbedingungen der Ausbildertätigkeit
5.4 Gütekriterien der Untersuchung
6 FAZIT UND FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN
LITERATURVERZEICHNIS
ANLAGEN
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Alter der Befragten. Eigene Darstellung.
Abbildung 2: Dauer der Ausbildertätigkeit der Befragten. Eigene Darstellung.
Abbildung 3: Anteil der Ausbildertätigkeit an der Gesamttätigkeit. Eigene Darstellung.
Abbildung 4: Erworbener Berufsabschluss der Ausbilder. Eigene Darstellung.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit
Die Qualität beruflicher Ausbildung ist für die Wirtschaft wie für den Einzelnen von hoher Bedeutung. Für die Betriebe sind gut ausgebildete Fachkräfte ein wichtiger Faktor der Standortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit. Für den Einzelnen beeinflusst die Qualität der Ausbildung entscheidend die Möglichkeiten der persönlichen Lebensführung sowie die Chancen der beruflichen Integration und Entwicklung. In dem Maße, in dem sich die gesellschaftlichen, demografischen und wirtschaftlichen Bedingungen wandeln, verändern sich auch die Anforderungen der einzelnen Anspruchsgruppen an die duale Berufsausbil-dung. Entsprechend muss die Ausbildung kontinuierlich im Hinblick auf sich neu heraus-bildende Anforderungen weiterentwickelt werden, um weiterhin den mit qualifizierter Be-rufsausübung verfolgten betrieblichen wie individuellen Zielen Rechnung tragen zu kön-nen.
Das betriebliche Ausbildungspersonal gilt als eine der maßgeblichen Ressourcen der Ausbildungsqualität. Gut qualifiziertes Ausbildungspersonal fördert die Qualität der Aus-bildung und die Lernzufriedenheit von Auszubildenden. Nicht zuletzt lässt sich dessen Bedeutung daran erkennen, dass - wie in einigen Studien berichtet wird - die vorzeitige Lösung des Ausbildungsvertrages häufig damit begründet wird, dass Auszubildende und Ausbildungspersonal nicht miteinander zurecht kommen (Berufsbildungsbericht 2003: 96). Aufgrund dieser herausgehobenen Position liegt es nahe zu ermitteln, wo die Stärken und wo die Verbesserungspotenziale der Tätigkeiten des Ausbildungspersonals liegen.
Der Begriff ‚Ausbilder‘ ist im Berufsbildungsgesetz relativ undeutlich definiert und gilt als präzisierungsbedürftig (Eule 1993: 24). Als Ausbilder1 wird gebräuchlich diejenige Person im Betrieb verstanden, die den Auszubildenden unmittelbar am Arbeitsplatz unterweist (Seyd/Schaper/Schreiber 2005: 46). Ausbilden darf, wer nach dem Berufsbildungsgesetz (§ 20 Abs. 1 BBiG) persönlich und fachlich geeignet ist und wer über die in der Ausbildereignungs-Verordnung (AEVO) geforderten berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse verfügt.
In der Literatur besteht Konsens darüber, dass der von den Unternehmen geforderte Nachweis der AEVO die pädagogische Qualität der Ausbildung im gegenwärtigen Pro-zess des ständigen Wandels in der Arbeitswelt nicht ausreichend sichert (Berufsbildungs-bericht 2008: 34; Frackmann 1991: 9f). Doch sind berufspädagogische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Sozialkompetenz in der praktischen Ausbildung heute mehr denn je gefordert, da sich die traditionelle Rolle des Ausbilders als einem Unterweiser und Ver-mittler von Fachwissen gewandelt hat hin zu einem Ausbilder, der Rahmenbedingungen für die Aktivität der Auszubildenden setzt und ihnen somit mehr Handlungs- und Problemlösespielraum gibt (Freundlinger 1995: 10).
Qualitativ gute Berufsausbildung erfordert Ausbilder, die durch Weiterbildung auf dem neuesten Stand sind. Der Forderung nach einem Weiterbildungsangebot, welches über die Anforderungen der AEVO hinaus geht, wurde durch die Institutionalisierung des Fort-bildungsberufs ‚Berufspädagoge (IHK)‘ Rechnung getragen (Koop 2007: 106f). Das Bun-desministerium für Bildung und Forschung fordert hierfür eine flächendeckende bundes-einheitliche Rechtsverordnung (Berufsbildungsbericht 2008: 34). Diese Fortbildung soll das Ausbildungspersonal zu Experten für die berufliche Ausbildung qualifizieren, damit sie den Anforderungen einer handlungsorientierten Berufsausbildung gerecht werden.
Ziel der handlungsorientierten Ausbildung ist es, Auszubildende allmählich zu domänen-spezifischen Experten zu entwickeln und sie in die Arbeitswelt und den betrieblichen Sozialisationsprozess zu integrieren. Sie sollen dazu befähigt werden, die mit der angestrebten Berufsrolle verbundenen Anforderungssituationen verantwortlich und sach-gerecht zu bewältigen. In diesem Zusammenhang wird von der pädagogisch unterstützten Enkulturation der Auszubildenden in die Expertenkultur gesprochen (Zimmermann 1996: 49).
Wenn unmittelbar am Arbeitsplatz gelernt wird, spielen Vorgesetzte, erfahrene Kollegen oder andere Personen, die die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten schon beherr-schen, eine herausragende Rolle. Sie alle fungieren gegenüber den Auszubildenden als Modell dafür, wie Experten handeln. Durch Beobachtung erleben die Lernenden, wie ‚fachmännisches Handeln‘ aussieht. Dabei fassen die Experten ihre Denk- und Problem-löseprozesse in Worte, sodass ein kognitives Modellieren vorliegt, wie es auch im konstruktivistisch geprägten Cognitive Apprenticeship-Ansatz postuliert wird. Lernen wird hierbei als ein Prozess der Selbstorganisation des Wissens verstanden, der sich auf der Basis der aktiven Wirklichkeitskonstruktion jedes einzelnen Individuums vollzieht.
Die bisher aufgezeigten Aspekte stellen die Grundlage für den Expertenkulturansatz dar. Dieser Ansatz integriert als didaktisches Rahmenkonzept für die Berufsausbildung das berufspädagogische Postulat, sowohl die Persönlichkeitsentwicklung des Auszubildenden als auch seine berufliche Leistungsfähigkeit zu fördern (Zimmermann 1997: 48). Der Ex-pertenkulturansatz wählt Experten als didaktische und methodische Orientierungsgrßöe, um Auszubildende in einer „community of practice“ zu situieren (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1993: 240).
Eine Studie, die im Jahr 2006 mit 271 Berufsschülern aus verschiedenen Ausbildungsbe-rufen durchgeführt wurde, ergab, dass sich die Auszubildenden in eine betriebliche Ex-pertenkultur mehr oder weniger eingebunden sehen. Sie merkten jedoch kritisch an, dass die Ausbilder die bei der Problembearbeitung verfolgten Denkmuster nicht genug verdeut-lichen und das dabei praktizierte Vorgehen nicht ausreichend begründen.
Insbesondere für betriebliche Ausbildungssituationen gibt es bisher nur wenige empiri-sche Befunde über die Anwendung des Expertenkulturansatzes aus Sicht des ausbilden-den Personals, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass die traditionell berufs-pädagogische Forschung eher geisteswissenschaftlich orientiert ist und nicht ausreichend Zugang zum betrieblichen Lernort findet (Zimmermann/Müller/Wild 1994: 1). Daher liegt das vorrangige Ziel dieser Arbeit in der Beantwortung folgender zentralen Frage:
1.) Welche Relevanz hat der Expertenkulturansatz in der betrieblichen Ausbildung, d.h., in welchem Ausmaß wird der Expertenkulturansatz durch das Ausbil-dungspersonal praktiziert?
Hieraus ergeben sich nachfolgende Fragestellungen, welchen ebenfalls in dieser Arbeit nachgegangen werden soll:
2.Inwieweit ist das betriebliche Ausbildungspersonal für die Umsetzung der im Expertenkulturansatz geforderten Methoden qualifiziert?
3. Welche Maßnahmen sind notwendig, um die Anwendung der im Expertenkulturansatz geforderten Vorgehensweisen zu manifestieren?
Um diese Fragen zu beantworten, werden zunächst im zweiten Kapitel die Rahmen-bedingungen der dualen Berufsausbildung, fokussiert auf den Lernort Betrieb, erläutert und die aktuelle Ausbildungssituation erörtert.
In Kapitel 3 werden die Situation und die Rolle des betrieblichen Bildungspersonals näher beleuchtet und wird der Qualifizierungsbedarf dieser Berufsgruppe aufgezeigt. Der im Zentrum dieser Arbeit stehende Expertenkulturansatz wird im vierten Kapitel behandelt: Zunächst wird auf seine konzeptionelle Einordnung eingegangen, anschließend auf die einzelnen Elemente, die ihm zugrunde liegen, und schließlich auf den aktuellen For-schungsstand.
Im Rahmen dieser Arbeit wird zudem eine empirische Studie durchgeführt, die im fünften Kapitel behandelt wird. Die Studie soll darüber Aufschluss geben, inwieweit der in Kapitel 4 skizzierte Expertenkulturansatz in verschiedenen Betrieben bekannt ist und praktiziert wird. Die Studie wird zunächst vorgestellt und die empirische Vorgehensweise erläutert. Anschließend werden die gewonnen Ergebnisse ausgewertet und kritisch diskutiert. Im letzten Kapitel wird nach der Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse ein Fazit über die empirische Studie gezogen sowie der weiterführende Forschungsbedarf aufge-zeigt.
2 Der Lernort Betrieb im Rahmen der dualen Berufsausbildung
Der immer schneller werdende Wandel in der Arbeitswelt ist gekennzeichnet durch die zunehmende Globalisierung, durch den vermehrten Einsatz von Informations- und Kom-munikationstechniken sowie durch Veränderungen in der Arbeits- und Betriebsorganisa-tion (Matalik/Schade 1998: 7). Diese Veränderungen haben eine wachsende Komplexität von betrieblichen Problemstellungen zur Folge (Kohl/Molzberger 2005: 352). An einem Arbeitsplatz finden sich gebündelt zahlreiche heterogene Tätigkeiten und Aufgabenfelder, die von Mitarbeitern erhöhte Verantwortung und Selbstständigkeit sowie Flexibilität und Kooperation erfordern (Noß 2000: 9f). Unternehmen, die wettbewerbsfähig sein wollen, sind daher mehr denn je von den Qualifikationen bzw. den Kompetenzen ihrer Beschäf-tigten abhängig (Rebmann/Tenfelde/Uhe 2003: 149).
Auch eine zukunftsorientierte berufliche Erstausbildung muss diesen neuen Anfor-derungen gerecht werden. Dies kann mit einer ganzheitlichen Berufsausbildung2 gesche-hen, die berufliche Handlungskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung vermittelt und die durch eine gelungene Kooperation zwischen privaten Betrieben und öffentlichen Schulen miteinander verzahnt ist (Arnold/Gonon 2006: 101).
Der originäre Ausbildungsort des Arbeitsplatzes bzw. die arbeitsplatzgebundene Ausbil-dung wird nach wie vor als zentraler Bestandteil in der kaufmännischen Berufsausbildung gesehen (Söltenfuss 1987: 13)3. Nach Greinert stellt der Betrieb schon deswegen den entscheidenden Lernort dar, weil auf ihn ca. drei Viertel der Ausbildungszeit entfallen (1998: 121). Auch Brater und Mitarbeiter kamen im Rahmen einer empirischen Befragung im Bankensektor zu dem Ergebnis, dass „für das Erreichen der modernen handlungs-orientierten Lernziele der Bankkaufleute die Ausbildung am ‚Ernstfall Arbeitsplatz‘ unver-zichtbar und unersetzbar ist [...]“ (1990: 57).
Jedoch gibt es im Vergleich zu Studien, die sich mit der Berufsschule beschäftigen, hin-sichtlich der Qualität der betrieblichen Ausbildung und der Gestaltung von betrieblichen Ausbildungssituationen nur wenige Erhebungen (Euler 2005: 4; Keck 2007: 12).
Der Fokus dieses Abschnittes liegt daher auf den beruflichen Lernsituationen. Zunächst werden die Vorteile der Berufsausbildung für die ausbildenden Betriebe kurz erläutert und der Beitrag des Betriebs zum Ausbildungsziel sowie der gesellschaftliche Nutzen aufge-zeigt. Anschließend wird ein kurzer Umriss der aktuellen Ausbildungssituation für kauf-männische Auszubildende gegeben
2.1 Betrieblicher Nutzen der Berufsausbildung
Die duale Berufsausbildung sichert der Wirtschaft modern ausgebildeten Fachkräfte-nachwuchs und bildet dadurch die Basis für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. (Bulmahn 2003: 5).
Durch die Bereitschaft der Betriebe zur Ausbildung entsteht ihnen ein bedeutender Nut-zen: Die Auszubildenden werden hinsichtlich ihrer Qualifikation auf die Anforderungen des Betriebs geformt und können bei erfolgreicher Übernahme bedarfsgerecht eingesetzt werden. Das Fehlbesetzungsrisiko und die Kosten für die Personalgewinnung entfallen dadurch (Walden/Beicht/Herget 2002: 35f). Zudem stellt die betriebliche Ausbildung hin-sichtlich der sozialen Verantwortung einen Imagefaktor dar (Seyd/Schaper/Schreiber 2005: 25).
Gemäß der von 1999 bis 2002 vom BiBB durchgeführten Studie „Nutzen und Nettokosten der Berufsausbildung für Betriebe“ übersteigt der Ausbildungsnutzen mittelfristig die Aus-bildungskosten (Beicht/Weiden/Herget 2004: 271f). Die Kosten für die Ausbildung werden mit 16.435 € für das Jahr 2000 ermittelt. Diesen Kosten stünden 7.730 € an Erträgen ge-genüber, sodass dem Ausbildungsbetrieb im Durchschnitt 8.705 € an Nettokosten ent-stünden. Die Nettokosten zwischen West- und Ostdeutschland und zwischen den einzel-nen Ausbildungsbereichen weichen deutlich voneinander ab (Beicht/Walden 2002: 40ff). Stellt man diesen Ausbildungskosten nun den zuvor aufgezeigten Ausbildungsnutzen ge-genüber, so ist festzustellen, dass die betriebliche Ausbildung aufgrund ihrer ökonomi-schen Vorteile eine lohnenswerte Investition ist.
2.2 Der Beitrag des Lernorts Betrieb zu den Ausbildungszielen
Das grundlegende Ziel der Berufsausbildung liegt in der Vermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit (§ 1 Abs. 3 BBiG). Um Jugendliche für ihre gegenwärtige und zukünf-tige Lebenssituation adäquat zu qualifizieren, muss ihnen der Sinn und Zweck des beruf-lichen Handelns in komplexen wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern verdeutlicht werden (Keck/Weymar/Diepold 1997: 24). Hierfür eignet sich der Arbeitsplatz als Lernort und ist daher maßgeblich an der Erreichung dieses Ziels beteiligt sowie für die Qualität der Be-rufsausbildung verantwortlich (Lapke 1991: 111).
Die betriebliche Berufsausbildung ist in Deutschland curricular weitgehend standardisiert. Die Ausbildungsordnungen und Ausbildungsrahmenpläne normieren die zu vermittelnden Inhalte und den zeitlichen Aufbau und Ablauf (Frommberger 2005: 7). Die kaufmän-nischen Auszubildenden durchlaufen die verschiedenen Abteilungen des ausbildenden Betriebs und sind dort Sachbearbeitern unterstellt, die als nebenberufliche Ausbilder die Aufgabe haben, die Fertigkeiten und Kenntnissen gemäß der Ausbildungsordnung zu vermitteln (Nikolay 1993: 75). Daneben sollen praxisnahes Arbeiten und Denken in realen Handlungssituationen, die arbeitsbezogene Kooperation sowie die betriebliche Sozialisa-tion gefördert werden.
Die gestiegene Bedeutung der Ausbildung am Arbeitsplatz beruht u.a. auf den Erwar-tungen, dass durch das Lernen am Arbeitsplatz eine bessere Übereinstimmung von Aus-bildung und Arbeitsanforderungen sichergestellt und dadurch der Transfer des Erlernten verbessert wird. Ebenso werden die Auszubildenden frühzeitig mit den betrieblichen Be-dingungen vertraut gemacht, sodass der Aufbau ihrer beruflichen Identität und ihrer Per-sönlichkeit gefördert wird. Das Lernen im betrieblichen Kontext ermöglicht den Auszubil-denden, dass durch die direkte Erfahrung der Nutzen des Gelernten sichtbar und greifbar wird und Lernfortschritte unmittelbar erlebbar werden. Das Hineinwachsen und die Ein-bindung in betriebliche Strukturen, der Erwerb der Fähigkeit, in konkreten und realen Situationen zu arbeiten und in betrieblichen Teams zu kooperieren sind ebenso wie die Perspektive einer möglichen Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis für junge Men-schen die Voraussetzung erfolgreicher Ausbildung.
Die Effektivität, die mit dem arbeitsplatzgebundenen Lernen einhergeht, hängt wesentlich davon ab, was am einzelnen Arbeitsplatz konkret getan wird und wie die einzelnen Lehr-Lern-Situationen didaktisiert und gestaltet sind. Lernen am Arbeitsplatz vollzieht sich in der Regel in einer dyadischen Interaktion zwischen Sachbearbeiter und Auszubildenden und findet eher unreflektiert, unsystematisch und oftmals unter Zeitdruck statt (Diepold 1996: 61). Die Lernqualität hängt stark vom Arbeitsanfall im Betrieb ab. Besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist das Ausbildungsgeschehen sehr stark von der jeweiligen Auftragslage abhängig (Jungkunz 2008: 12), sodass nicht immer alle in der Ausbildungsordnung geforderten Inhalte vermittelt werden können.
Trotz der lernförderlichen Authentizität des Lernorts Arbeitsplatz darf nicht vernachlässigt werden, dass dieser nicht vorrangig als Lernort angelegt ist. Ein Arbeitsplatz ist eher unter betriebswirtschaftlichen und technologischen Gesichtspunkten gestaltet, als nach berufs-pädagogischen Eigenschaften. Restriktionen für die arbeitsplatzgebundene Ausbildung sind daher äußere Faktoren, wie z.B. unstrukturierte Arbeitsanforderungen, die zu laufen-den Unterbrechungen einzelner Arbeitstätigkeiten führen und dadurch ein arbeitsplatz-nahes Lernen behindern (Severing 1997: 311). Eine weitere Restriktion ist durch den ho-hen Grad der Arbeitsteilung im kaufmännisch-verwaltenden Bereich begründet, wodurch es dem Auszubildenden erschwert wird, Gesamtzusammenhänge zu erlernen und zu überschauen (Keck 1995: 150).
Das Lernen am Arbeitsplatz vollzieht sich folglich in einem Spannungsfeld. Einerseits soll der Arbeitsplatz didaktische Potenziale entfalten, um den Wissenstransfer und die Aktualität der Ausbildung zu sichern, andererseits eignen sich betriebliche Arbeitsumge-bungen weniger zur Vermittlung des notwendigen Wissens (ebd.: 313).
2.3 Die Ausbildungssituation im kaufmännischen Bereich
Aktuell erwerben zwei Drittel eines typischen Altersjahrgangs in den Einrichtungen unter-halb der Hochschulebene einen qualifizierten Berufsbildungsabschluss. 70% derjenigen erwirbt diesen Abschluss im dualen System von betrieblicher und schulischer Bildung (Bildungsbericht 2008: 95).
Zum 30. September 2007 wurden in Deutschland 625.914 neue Ausbildungsverträge ge-schlossen, was einer Steigerung von 8,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht (Berufs-bildungsbericht 2008: 260, 291) und damit den zweithöchsten Wert seit der Wiederverei-nigung erreicht. Die Industrie- und Handelskammern meldeten rund 367.500 neue Ver-träge, das ist ein Plus von über 30.500 Verträgen bzw. 9,1% (ebd.: 48). Im Vergleich zur Erhebung im Vorjahr ist im Zuständigkeitsbereich Industrie und Handel insbesondere in folgenden Berufen die Zahl der Ausbildungsverträge gestiegen: Bürokaufmann +8%, In-dustriekaufmann +6,9%, Kaufmann im Einzelhandel +7,1%, Verkäufer +15,6% (ebd.: 49). Seit dem Jahr 2006 ist eine Aufwärtsbewegung der angebotenen Ausbildungsplätze in Höhe von 14% zu verzeichnen. Der Anstieg basiert auf einer leichten Erhöhung der Aus-bildungsquote4 von 6,4% auf 6,5% zwischen 2004 und 2006 und einem Anstieg der Ausbildungsbetriebsquote5 von 23,8% auf 24% (Bildungsbericht 2008: 101). Durch diese Aufwärtsbewegung wird zwar die Ausbildungsstellenlücke verringert, aber nicht geschlos-sen, da im gleichen Zeitraum die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen um etwa 11% ge-wachsen ist. Jedoch ist die Zahl der gemeldeten noch unversorgten Jugendlichen spürbar gesunken. Zum 30. September 2007 hat die Statistik der Bundesagentur für Arbeit 29.102 noch unversorgte Bewerber ausgewiesen. Das entspricht einem Rückgang von 41,2% zum Vorjahr (ebd.: 2008: 16). Vor dem Hintergrund möglicher realwirtschaftlicher Folgen der internationalen Finanzkrise sowie der derzeit schlechten konjunkturellen Prognosen bleibt jedoch abzuwarten, ob sich das positive Wachstum an Ausbildungsplätzen der let-zten Jahre fortsetzen wird.
Von den insgesamt 625.914 neuen Ausbildungsverträgen wurden 41,4% mit jungen Frauen und 58,6% mit jungen Männern abgeschlossen. Im Bereich Industrie und Handel liegt der Anteil der weiblichen Auszubildenden bei 39,5% und damit im Durchschnitt aller neuen Ausbildungsverhältnisse. Die Frauen in einer dualen Berufsausbildung haben mit 19,7 Jahren ein geringfügig höheres Durchschnittsalter als die Männer mit 19,5 Jahren (ebd.: 52, 308).
Bezogen auf die Vorbildung kann festgehalten werden, dass 2,3% der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Vertrag über keinen Abschluss verfügen und 27,6% die allge-mein bildende Schule im Jahr 2006 mit Hauptschulabschluss verließen. Diese Gruppe der Auszubildenden bilden in handwerklichen Ausbildungsberufen die Mehrheit (47%). Gut 46% der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Vertrag erwarben zuvor den Real-schulabschluss bzw. den Abschluss an der Berufsfachschule. Im Bereich Industrie und Handel bilden Auszubildende mit mittlerer Reife den größten Teil (35,4%), die am stärk-sten vertretenen Berufe dieser Gruppe sind der Kaufmann im Einzelhandel, der Büro-kaufmann und der Kaufmann für Bürokommunikation. 16,1% der Auszubildenden mit neu abgeschlossenen Verträgen besitzen die allgemeine Hochschulreife (ebd.: 323). In den Berufen von Industrie und Handel machen die Auszubildenden mit Studienberechtigung 20,8% aus und sind auf wenige Berufe konzentriert. Zehn Berufe (unter anderem Industriekaumann, Kaufmann für Versicherung und Finanzen, Steuerfachangestellter, Bankkaufmann) umfassen 47,6% der Auszubildenden mit Hochschulzugang (ebd.: 328). Im Jahr 2006 wurden 19,8% der neu abgeschlossenen Verträge wieder gelöst, für den Bereich Industrie und Handel waren es 18,1% der Verträge, was einen Anstieg von 0,3% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet (ebd.: 339).
Die bundesdurchschnittliche Ausbildungsvergütung lag im Jahr 2006 bei 628€ pro Monat und entspricht einem Anstieg um 2,5% gegenüber dem Vorjahr. In den alten Ländern wurden im ersten Ausbildungsjahr wurden durchschnittlich 573€ gezahlt, im zweiten Jahr 638€ und im dritten Jahr 713€. In den neuen Ländern lagen die Werte bei 489€ im ersten Ausbildungsjahr, 554€ im zweiten Jahr und 609€ pro Monat im dritten Jahr (ebd.: 343).
3 Ausbilderinnen und Ausbilder im Spannungsfeld zwischen betrieblicher Realität und pädagogischer Notwendigkeit
Die an der betrieblichen Ausbildung beteiligten Personen stellen eine inhomogene und vielschichtige Berufsgruppe dar und sind durch unterschiedliche Biographien gekenn-zeichnet (Steinborn 1992: 9). Ihre Ausbildertätigkeit ist oft hinter anderen Berufsbezeich-nungen verborgen (Neß 2000: 50). In der Literatur herrscht weitgehende Einigkeit, dass die Qualität der betrieblichen Ausbildung am kaufmännischen Arbeitsplatz maßgeblich durch die fachliche und pädagogische Qualifikation des betrieblichen Ausbildungsperso-nals beeinflusst wird (Schulz 1989: 7; Keck 1995: 150). Daher ist es umso verwunder-licher, dass der Begriff des Ausbilders nach BBiG nicht ausdrücklich im Gesetz und in der Rechtsprechung definiert ist6. „Über kaum eine Berufsgruppe liegen bislang so wenig ver-lässliche Daten vor“ (Kraft 2006: 10). Die Bezeichnung ‚Ausbilder‘ entwickelt sich zu ei-nem Oberbegriff, der eine Skala von Akteuren abdeckt, die in unterschiedlichen Funk-tionen auf verschiedenen Ebenen tätig werden (Rieleit/Selka 1991: 3).
Im Folgenden wird das Berufsbild des betrieblichen Ausbildungspersonals vorgestellt. Zunächst wird auf die Situation und auf die Rolle der Ausbilder eingegangen sowie ihr Aufgabenfeld und die Qualifizierung gemäß AEVO beschrieben. Abschließend wird der daraus resultierende Qualifizierungs- und Professionalisierungsbedarf der Ausbilder und die neue Fortbildung zum ‚Berufspädagogen IHK‘ vorgestellt.
3.1 Die Situation und die Rolle der Ausbilderinnen und Ausbilder
Wer ist eigentlich Ausbilder und wer darf überhaupt ausbilden? Durch die Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) am 14. August 1969 und durch seine Novellierung im April 2005 wurde die Grundlage für die fachliche und pädagogische Qualifikation der Aus-bilder geschaffen (Pätzold 2000: 75f). § 10 Abs. 1 BBiG und §§ 28 bis 30 BBiG in Verbin-dung mit § 2 der AEVO legen fest, wer die Berechtigung zur Einstellung und Ausbildung besitzt. Der Ausbildende, der ggf. Auszubildende nur einstellt und die Ausbildung selbst einem verantwortlichen Ausbilder überträgt, muss persönlich aber nicht zwingend fachlich geeignet sein. Der verantwortliche Ausbilder muss hingegen sowohl eine persönliche als auch fachliche Eignung vorweisen.
Das BBiG definiert die persönliche Eignung nicht, es legt in § 29 BBiG nur fest, wer per-sönlich nicht geeignet ist, d.h., es ist zunächst jeder persönlich geeignet, sofern ihm nicht der Mangel der Eignung nachgewiesen wird. Persönlich geeignet ist im Normalfall derje-nige, der Kinder und Jugendliche beschäftigen darf und bisher nicht wiederholt oder schwer gegen die einschlägigen Vorschriften verstoßen hat (vgl. dazu auch § 25 JArbSchG).
Die Voraussetzungen der fachlichen Eignung des Ausbilders zählt das BBiG in § 30 positiv auf. Für die fachliche Eignung ist es notwendig, dass der Ausbilder berufliche so-wie berufs- und arbeitspädagogische Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die er durch eine einschlägige Berufsausbildung und Berufstätigkeit erworben hat (Schmidt-Hackenberg et al. 1999: 12). Weitere Anforderungen regelt die AEVO (siehe Kapitel 3.2). Eine Neuerung im BBiG stellt § 28 Abs. 3 dar. Unter der Verantwortung eines Ausbilders kann künftig auch derjenige bei der Berufsausbildung mithelfen, der selbst nicht alle Vor-aussetzungen für die fachliche Eignung besitzt. In diesem Fall spricht man häufig von Ausbildungsbeauftragten, also Personen, die im Betrieb ständig oder von Fall zu Fall Ausbildungsaufgaben wahrnehmen, ohne verantwortliche Ausbilder zu sein. Sie unterstützen den verantwortlichen Ausbilder bei der Durchführung der Berufsausbildung.
Unterteilt man die Ausbilder nach dem Zeitaufwand für anfallende Ausbildungstätigkeiten, so kann auch zwischen hauptberuflichen und nebenberuflichen Ausbildern unterschieden werden. Hauptberuflichen oder auch hauptamtlichen Ausbildern sind ausschließlich Aus-bildungsaufgaben übertragen, überwiegend führen sie Tätigkeiten des Bildungsmanage-ments aus: Sie entwickeln Ausbildungskonzepte, planen und organisieren die Ausbildung und beraten die nebenberuflichen Ausbilder und die Unternehmensleitung in Ausbil-dungsfragen (Bausch/Jansen 1995: 16).
Nebenberufliche Ausbilder bzw. Ausbildungsbeauftragte oder Ausbilder vor Ort üben ne-ben ihrer Hauptaufgabe zusätzlich Ausbildungsaufgaben aus (Paulik 1988: 40; Bausch/Jansen 1995: 16). Im Wesentlichen handelt es sich im kaufmännischen Bereich um Sachbearbeiter. Sie arbeiten mit den Auszubildenden direkt zusammen, leiten sie an, erklären Sachverhalte, machen Arbeiten vor und beraten und beurteilen sie (Wittwer 1995: 336). Nebenberufliche Ausbilder bilden die quantitativ größte Gruppe im Bereich der kaufmännischen Ausbildung (Keck 1995: 151; Schmidt-Hackenberg 1999: 12). Sie sind einer Doppelbelastung ausgesetzt und stehen im Interessenkonflikt zwischen be-trieblichen Zielen und den Ausbildungszielen (Steinborn 1987: 270). Daher bereitet es vielen nebenberuflichen Ausbildern Schwierigkeiten, zwischen Produktionsziel bzw. der jeweiligen ökonomischen Situation des Unternehmens einerseits und andererseits der nur langfristig wirkenden beruflichen Qualifizierung der jungen Menschen, die auch den erzie-herischen Auftrag mit einschließt, vermitteln zu müssen (Pätzold 2000: 71). Nebenberufli-che Ausbilder verfügen über ein individuelles, habituelles und auf Erfahrung begründetes Handlungswissen, welches sie durch einschlägige Berufserfahrung erworben haben. Mitunter werden die intuitiv und routiniert ablaufenden Tätigkeiten nicht systematisch ref-lektiert, sodass der Ausbilder sein Vorgehen dem Auszubildenden auch nicht immer ver-balisieren kann. Jedoch ermöglicht erst die bewusste Reflexion über das eigene Handeln, laut zu denken, und damit dem Auszubildenden die Abläufe und inneren Prozesse transparent zu machen (Herzer/Herz/Bauer 1993: 23). Dieses beschriebene Merkmal des Aus-bilderhandelns stellt eine weitere Schwierigkeit dar, mit der nebenberufliche Ausbilder konfrontiert sind.
Das Aufgabenspektrum des betrieblichen Bildungspersonals hängt maßgeblich von der Betriebsgröße und der Organisationsstruktur ab. Je größer der Betrieb ist, desto dif-ferenzierter sind in der Regel die Tätigkeitsmerkmale des ausbildenden Personals (Bonz/Compter/Kuhnle 1990: 38). Des Weiteren wird die betriebliche Bildungsarbeit durch unternehmensspezifische Leitsätze und -kulturen konstituiert. Die Auffassung der Unter-nehmensleitung beeinflusst dabei wesentlich den Stellenwert der Ausbildung im Betrieb und das Ausmaß der Tätigkeiten des betrieblichen Bildungspersonals (Pätzold 1989: 65). Allen Aufgaben und Funktionen gemeinsam ist die Verantwortung für eine fachgerechte und pädagogische Heranführung junger Menschen zu Fachkräften. Nach abgeschlosse-ner Ausbildung sollen die so ausgebildeten Fachkräfte in ihrem Beruf befähigt sein, die ihnen übertragenen Arbeitsaufgaben selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren. Dieser Qualifikationsanspruch liefert damit auch die Anforderungen an das Berufsbild des Ausbilders.
Durch die Veränderung der Ausbildungsinhalte und die Einführung des Prinzips der Handlungsorientierung in der Berufsausbildung haben sich die Rolle und das Aufgaben-feld des Ausbilders gewandelt (Hensge 1998: 8; Arnold/Schüssler 2001: 58). Galt der tra-ditionelle Ausbilder noch als ein Wissensvermittler, kommt ihm heute die Aufgabe eines Lernhelfers, Begleiters, Organisators und Moderators zu (Arnold 1997: 118ff; Sinnhold 1992: 214; Eisfeld 1995: 87). Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung ihrer Ausbil-dungstätigkeiten ist, dass sich nebenberufliche Ausbilder eine umfassende Handlungs-kompetenz aneignen, die insbesondere den gestiegenen intellektuellen und sozialkom-munikativen Anforderungen genügt, wobei selbstständiges, reflektiertes und innovatives Handeln bei der Bearbeitung komplexer Probleme im Vordergrund steht (Neß 2000: 54). Dafür ist es unabdingbar, Methoden, Medien und Verfahren zur Initiierung und Reflexion selbstorganisierten Lernens einzusetzen. Ebenso sind Ausbildungssituationen derart zu gestalten, dass sie organisationales Lernen anregen und eine metakognitive Steuerung des Wissenszugriffs ermöglichen. Arbeitsplatzgebundenes Lernen soll daher in multiplen Perspektiven und sozialer Situiertheit aufeinander bezogen sein, wobei die soziale und fachliche Einbindung der Auszubildenden in die betriebliche Expertenkultur entscheidend ist (siehe Kapitel 4).
Diese Forderungen haben Konsequenzen für die Qualifizierungsmöglichkeiten der be-trieblichen Ausbilder. Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands und den geringen finan-ziellen Mitteln, die zur Verfügung stehen, werden viele Angebote7 nicht genutzt (Herzer/Herz/Bauer 1993: 23). In der Praxis üblich und repräsentativ für die Qualifikation der betrieblichen Ausbilder ist der Nachweis der Ausbildereignung gemäß AEVO, der im folgenden Abschnitt ausführlich dargestellt wird.
3.2 Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals
Der Qualifizierungsnachweis für Ausbilder nach der AEVO versteht sich als eine berufs-und arbeitspädagogische Zusatzqualifikation, die additiv der beruflich-fachlichen Qualifi-kation hinzugefügt wird (Stiller 1992: 16). Sie beinhaltet die berufs- und arbeitspäda-gogischen Kenntnisse (§ 2 AEVO) und die Form des Nachweises der Qualifikation (§§ 3 bis 6 AEVO). Die AEVO kann als eine Empfehlung verstanden werden, die 1972 vom Bundesausschuss für Berufsbildung unter Beteiligung des Deutschen Industrie- und Han-delstages verabschiedet wurde und dient dem Ziel, eine Grundlage für die Verbesserung der pädagogischen Kompetenz zu schaffen (Schwichtenberg 1991: 25f). In Deutschland verfügen ca. 90% der hauptberuflichen Ausbilder über den Nachweis der AEVO, etwa die Hälfte der nebenberuflichen Ausbilder besitzt keine formelle Ausbilderberechtigung (Seyd/Schaper/Schreiber 2005: 296)
3.2.1 Der Rahmenstoffplan für die Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder
Seit Inkrafttreten der AEVO vor mehr als 30 Jahren unterlagen die Berufs- und Arbeitsbe-dingungen von Ausbildern erheblichen Veränderungen. Neue Konzepte der Arbeitsorga-nisation mit flacheren Hierarchien und dezentralen Entscheidungsstrukturen verlangen eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter. Ebenso ist die neue Auszubildendengenera-tion durch deutlich höhere Bildungsabschlüsse und durch ein gestiegenes Eintrittsalter gekennzeichnet und steht gewachsenen Ansprüchen an die Ausbildungsqualität gegenüber (Bahl/Diettrich 2008: 4).
Seit mit der Neuordnung der Berufe der handlungsorientierte Qualifikationsbegriff mit in die Ausbildungsordnungen aufgenommen wurde, liegt es nahe, auch Ausbilder hand-lungsorientiert auszubilden. Die reformierte AEVO, die im August 1992 verabschiedet wurde, passt daher den Rahmenstoffplan und die Prüfungsregelung für die Ausbilder-qualifizierung an diese Entwicklungen an (DIHT 1993: 53; Pätzold 2000: 80). Der neue Rahmenstoffplan orientiert sich an dem neuen Anforderungsprofil der Ausbilder, es wer-den verstärkt Handlungs-, Methoden- und Planungskompetenz und berufspädagogisches Rollenverständnis gefördert. Die Anforderungen sind in sieben Handlungsfelder zusam-mengefasst und sind entlang typischer Aufgabenstellungen aus dem Praxisalltag struktu-riert. In ihrer Summe sollen sie den üblichen betrieblichen Ausbildungsablauf repräsentie-ren (Pätzold 2000: 81). Nach der Vermittlung der allgemeinen Grundlagen und Rahmen-bedingungen beginnt der Lehrgang mit der Planung der Ausbildung und der Einstellung der Auszubildenden. Die Ausbildung am Arbeitsplatz und die Förderung von Lern-prozessen gehören zu den weiteren Handlungsfeldern. Der Lehrgang endet mit der Vor-bereitung auf und Mitwirkung an den Prüfungen und schließt einen rechtlichen Teil mit ein.
Das Modell der pädagogischen Ausbilderqualifizierung durch den Erwerb berufs- und ar-beitspädagogischer Kenntnisse nach der AEVO weist jedoch Mängel auf, die vor allem in den Lücken der gesetzlichen Bestimmungen liegen8. Es ist nicht eindeutig geklärt, welche Personengruppe des ausbildenden Personals den Nachweis gemäß AEVO erbringen muss (Schulz/Tilch 1975: 18). Zum einen liegt dies an der mangelnden gesetzlichen Definition der Person, die ausbilden darf (Eule 1991: 24), zum anderen daran, dass es in der Praxis üblich ist, nur diejenigen als Ausbilder gemäß BBiG anzusehen, die auch als sol-che bei den zuständigen Stellen (z.B. IHK) gemeldet sind.
Die Fachkräfte (sog. nebenberuflichen Ausbilder), denen gemäß § 28 Abs. 3 BBiG Aus-bildungsaufgaben durch einen Ausbilder übertragen werden, gelten gesetzlich nicht als Ausbilder. Daher sind sie auch nicht verpflichtet, berufs- und arbeitspädagogische Nach-weise vorzuweisen. Blanke spricht hierbei von einer „Schizophrenie des Berufsbildungs-gesetzes“ (1993: 90), da der direkt mit den Ausbildungsaufgaben betraute Ausbilder nicht über den Eignungsnachweis verfügen muss, der anerkannte Ausbilder, der in der Regel am Arbeitsplatz überhaupt nicht ausbildet, gleichwohl.
3.2.2 Die Aussetzung der AEVO und ihre Folgen
Im Rahmen der Ausbildungsoffensive 2003 wurde durch einen Beschluss der Bundesre-gierung die befristete Aussetzung der AEVO bis 2009 festgelegt (§ 7 AEVO). Ziel dieser Rechtsänderung ist, Ausbildungshemmnisse zu beseitigen, um unter Beibehaltung der Bildungsqualität die Ausbildungsbeteiligung der Betriebe im Dualen System zu erhöhen. Bisher nicht ausbildende Betriebe sollen auf diese Weise für die Schaffung neuer Ausbil-dungsplätze gewonnen werden. Seit August 2003 müssen hauptberufliche Ausbilder den Qualifizierungsnachweis der AEVO nicht mehr zwingend erbringen, der damit verbundene Lehrgang kann aber weiterhin fakultativ durchlaufen werden.
2007 wurde die Wirksamkeit der Aussetzung der AEVO durch das Bundesinstitut für be-rufliche Bildung (BiBB) evaluiert. Grundlage der Erhebung war eine bundesweite reprä-sentative Befragung von 15.000 Betrieben sowie eine Befragung aller Handwerks- und Industrie- und Handelskammern (Berufsbildungsbericht 2008: 33). Die Untersuchung sollte mit Hinblick auf quantitative Effekte (Wie viele zusätzliche Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsplätze konnten aufgrund der Aussetzung der AEVO gewonnen werden?) und auf qualitative Effekte (Welche Auswirkungen hatte der Verzicht auf eine formale Be-scheinigung der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung für die Qualität der betriebli-chen Berufsausbildung?) durchgeführt werden.
Die BiBB-Studie zeigt, dass die Anzahl der zusätzlichen Ausbildungsplätze, die durch die Aussetzung der AEVO leichter zur Verfügung gestellt werden konnten, erheblich unter den Erwartungen liegt. Auch in Hinblick auf qualitative Auswirkungen der AEVO-Aus-setzung lassen sich negative Ergebnisse nachweisen, vor allem bezüglich des Ausbil-dungserfolgs. Ausbildungsabbrüche treten häufiger in den Betrieben auf, die über kein nach der AEVO qualifiziertes Personal verfügen und die selbst angegeben haben, dass ihnen die Aussetzung der AEVO den Einstieg in die Ausbildung erleichtert hatte. Im Ge-gensatz zu den berufsbildungspolitischen Behauptungen sehen sowohl die befragten Ausbildungsbetriebe als auch die nicht ausbildenden Betriebe mehrheitlich in einer ge-setzlichen Regelung der Ausbildereignung einen Beitrag zur Sicherung der Mindestquali-fikation des Ausbildungspersonals sowie der Qualität der beruflichen Ausbildung (Ulmer/Jablonka 2007: 4ff). Auch angesichts der gestiegenen Anforderungen an die Be-rufsausbildung und den gewachsenen pädagogischen Herausforderungen ist ein Min-destmaß an berufs- und arbeitspädagogischer Qualifikation unverzichtbar. Daher soll zum neuen Ausbildungsjahr 2009/2010 die AEVO wieder in Kraft gesetzt werden. Derzeit erar-beitet das BiBB unter Mitwirkung der Sozialpartner einen neuen Verordnungsentwurf und Rahmenstoffplan.
3.3 Qualifizierung und Professionalisierung des Bildungspersonals als Ansatz der Qualitätssicherung
Die Erarbeitung neuer und die Modernisierung bestehender Ausbildungsordnungen stel-len an die Ausbilder immer höhere Anforderungen, insbesondere sind die Ansprüche an berufspädagogische und soziale Kompetenzen gestiegen (Dauser/Rümpker/Sailmann 2006: 80). Überdies haben Untersuchungen gezeigt, dass Ausbilder meist nach fachprak-tischen Kriterien rekrutiert werden, denn als Hauptaufgabe des Ausbildungsbeauftragten galt lange die direkte Unterweisung am Arbeitsplatz. Berufspädagogische Kompetenzen werden dabei aber vernachlässigt (ebd.: 45). Für nebenberufliche Ausbildertätigkeiten werden in der Regel keinerlei Qualifikationen verlangt, die über eine Berufsausbildung und einschlägige Berufserfahrung hinausgehen (Pätzold 1989: 125), obwohl die Ausbilder vor Ort den quantitativ größten Teil der betrieblichen Ausbildung leisten (Steinborn 1999: 111). Auch Arnold kam schon vor einigen Jahren zu dem Ergebnis, dass die pädagogi-sche Kompetenz eher als sekundär angesehen wird und überwiegend berufsbegleitend durch externe Kursprogramme vermittelt wird (1982: 179f). Erhebungen über das wahr-genommene Selbstverständnis des nebenberuflichen Ausbilders bekräftigen diese Re-sultate. Sie sehen sich in erster Linie als Fachkraft und erst nachgeordnet als Pädagoge oder Ausbilder (Schmidt-Hackenberg et al. 1990: 10; Herzer/Herz/Bauer 1993: 24). Aus-bilder benötigen jedoch in der heutigen Arbeitswelt ein pädagogisches Handlungskonzept sowie ein differenziertes Methodenrepertoire. Neben didaktischen Kompetenzen tritt die Fähigkeit zur Erziehung, Betreuung und Beratung der Jugendlichen sowie die Motivierung in den Vordergrund.
Angesichts dieser skizzierten Probleme wird in der Wirtschaft die Notwendigkeit erkannt, die Qualifikation und den Status des Bildungspersonals aufzuwerten. Besonders neben-berufliche Ausbilder sollen im Gesetz eine stärkere Stellung erhalten und die Professiona-lisierung des Ausbilderberufs soll angestrebt werden (Bonz/Comper/Kuhnle 1990: 51f). Pätzold kommt zu dem Schluss, dass vor dem Hintergrund der Anhebung der Qualitäts-standards in den Ausbildungsordnungen statt einer Aussetzung der AEVO besser eine qualitative Weiterentwicklung hätte erfolgen müssen (2008: 231f). Überdies ist es zwin-gend erforderlich, dass insbesondere das nebenberuflich tätige Bildungspersonal mit in die Qualifizierungsmaßnahmen einbezogen wird (Steinborn 1999: 113).
In Deutschland gibt es bisher keine einheitliche Anerkennung für das Berufsbild des Aus-bilders, es fehlen die professionellen Entwicklungsmöglichkeiten genauso wie die Aner-kennung als eigenständige Aufgabe und eine anspruchsvolle Qualifizierung (Koop 2007: 104). Als Folge dessen ergeben sich heterogene Qualifikationsvoraussetzungen der Ak-teure und eine eingangs beschriebene heterogene Beschäftigungsstruktur. Um diesem Problem entgegenzuwirken, d.h., einerseits haupt- und nebenberuflichen Ausbildern eine Qualifizierungsperspektive zu eröffnen und andererseits den betrieblichen Trägern der Berufsausbildung qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen, wird die Etablierung eines einheitlichen Fortbildungsberufsbildes für die betriebliche Aus- und Weiterbildung angestrebt (ebd.: 105). Eine erfolgreiche Umsetzung dieses Konzepts fand bisher im Rahmen eines Modellversuchs in Bayern statt, weitere Projekte sind derzeit in Vorberei-tung. Inzwischen liegt ein Entwurf für eine Bundesverordnung vor, die Rechtsvorschrift soll noch im Jahre 2009 bundesweit erlassen werden (Krogoll 2008). Die Absolventen dieser Fortbildung zum „Berufspädagogen für die Aus- und Weiterbildung (IHK)“ werden zu Experten für die praktische Berufsausbildung befähigt, die alle Prozesse der betrieb-lichen Aus- und Weiterbildung planen, organisieren, durchführen und auswerten können, die Aufgaben in den Bereichen Bildungsmanagement, -marketing und -controlling bewäl-tigen, ausbildende Betriebe beraten und in den Prüfungsausschüssen mitarbeiten können, und die vor allem als Lernprozessbegleiter eine moderne und gestaltungsoffene Aus- und Weiterbildung arrangieren können (Brater et al. 2006: 44ff; Koop 2007: 107).
Die Fortbildung ist modular aufgebaut, wird berufsbegleitend innerhalb von zwei Jahren absolviert und umfasst sowohl Basismodule als auch spezielle Module (Martin 2007: 99). Schwerpunkt ist dabei die pädagogische Qualifizierung sowie das Erwerben moderner Methoden der Berufsbildung.
Die Institutionalisierung dieses Fortbildungslehrgangs ist ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung des ausbildenden Personals, zumindest wird eine Verberuflichung der Ausbildertätigkeit geschaffen. Inwiefern damit auch ein Beitrag zur Steigerung der Qualität einhergeht und ob die skizzierten Mängel der Ausbilderqualifizierung damit beho-ben werden können, muss zu gegebener Zeit durch wissenschaftliche Erhebungen evaluiert werden.
4 Der Expertenkulturansatz im Rahmen der betrieblichen Ausbildung
Ziel der Berufsausbildung im Sinne des Expertenkulturansatzes ist die Entwicklung eines Novizen zu einem domänenspezifischen Experten (Gruber/Mandl 1993: 4). Auszubil-dende sollen Mitglieder einer Expertenkultur werden und aktiv bei der Bearbeitung au-thentischer Aufgaben und Problemstellungen beteiligt sein. Die Realität zeigt jedoch, dass besonders in der Berufsausbildung häufig träges Wissen9 entsteht. Dieses Problem fällt besonders bei kaufmännischen Ausbildungsgängen ins Gewicht (Stark et al. 2001: 369). Beispielsweise werden im Rechnungswesen-Unterricht Formeln oft nur auswendig gelernt und Buchungssätze mechanisch angewendet, ohne dass sie auf neuartige Aufgaben in der Berufspraxis übertragen werden können (ebd.: 372). Die Vermeidung von trägem Wissen erhält daher eine zentrale Bedeutung für die Berufsausbildung und ihre Akteure (Zimmermann 1996: 46). Der Expertenkulturansatz wurde mit dem Ziel entwickelt, die Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden auszubauen und gleichzeitig ihren Willen zur Anwendung des Gelernten zu fördern (Zimmermann 1996: 49). Hierbei kommt dem ausbildenden Personal ein erheblicher Stellenwert zu. Bevor der Expertenkulturansatz im Folgenden ausführlich beschrieben wird, soll zunächst seine Klassifizierung erfolgen.
4.1 Konzeptionelle Einordnung des Ansatzes
Der Expertenkulturansatz geht von einem gemäßigt konstruktivistischen Grundverständ-nis aus, in seinem Zentrum stehen handlungsorientierte Überlegungen. Die Zuwendung zu konstruktivistischen Positionen ist in der Kritik an traditionellen Konzepten begründet, welche Im Folgenden kurz angerissen werden soll.
Der Lernende (Auszubildende) nimmt in traditionellen Konzepten eine passiv-rezipierende Rolle ein, im Fokus steht die Aufbereitung des Lehrinhalts für den didaktischen Transfor-mationsprozess von der Lehr- zur Lern-Seite. Daher kommt dem Lehrenden (Ausbilder) eine aktive Rolle zu. Er präsentiert und erklärt die Wissensinhalte systematisch und schrittweise und ist um eine Anleitung der Auszubildenden beim Lernen bemüht (Reinmann/Mandl 2006: 618). Theoretisches Ziel ist die quantitative und qualitative Einszueins-Abbildung des Lehrinhalts in den Köpfen der Auszubildenden. Der Lehrende soll daher die objektiven Inhalte so übermitteln, dass der Lernende am Ende dieses Wis-senstransports den vermittelten Wissensausschnitt in beinah gleicher Form besitzt wie der Lehrende. Dies erweist sich jedoch in vielen Fällen als problematisch (Ebner 2000: 113). Zum einen verfügen die Auszubildenden über keine oder nur unzureichende elaborierten Lernstrategien, zum anderen wird durch den passiven Lern- und Aufnahmeprozess die Entstehung von trägem Wissen gefördert (ebd.: 114f). Ebenso können sich die Auszubil-denden nicht mit den zugewiesenen Aufgaben identifizieren, da ihnen die Möglichkeit zur Initiative und Eigenverantwortung im Lernprozess abgenommen wird. Vorherrschend als traditionelle Lehr-Lernform ist die Vier-Stufen-Methode in betrieblichen Lernumgebungen (siehe Kapitel 5.3.2), der Frontalunterricht wird häufig in beruflichen Schulen praktiziert (Bonz 1999: 65).
Der Konstruktivismus basiert auf der Annahme, dass die Realität durch die Erfahrungen und Interpretationen des jeweiligen Menschen bestimmt wird. Der Konstruktivist betrach-tet diese Wirklichkeit als persönliche Konstruktion und nimmt somit externe Phänomene solange als bedeutungslos an, bis sie von einem Individuum wahrgenommen werden. Menschen greifen durch ihre Handlungen, mit ihren Erfahrungen und durch Experimentie-ren umfassend in die Konstruktion dessen ein, was ihnen dann als Lösung oder Fortschritt erscheint. Ihre Konstruktionen bzw. ihre Versionen von Wirklichkeit sind dabei kein ein-faches Abbild der Welt, in der alles determiniert und abgeschlossen ist. Es gehört daher zum Entdecken und Erfinden der Individuen, dass immer neue Versionen und Abbilder geschaffen werden. Der Mensch wird in der konstruktivistischen Didaktik als ein beobachtendes und handelndes Wesen angesehen, das viele Probleme bewältigen muss, die ihm durch die Natur auferlegt sind, aber das sich auch durch seine Zivilisation seine eigenen Probleme schafft, die es zu lösen hat (Reich 2006: 75).
Bezogen auf die konstruktivistischen Ansätze zum Lernen und Lehren setzt sich der Konstruktivismus aus vielen unterschiedlichen Denkrichtungen zusammen, die sich auf einem Kontinuum einordnen lassen, das von schwachen über gemäßigte bis zu radikalen Positionen reicht (Law/Wong 1996: 116). Die Rolle, die der Instruktion beim Lernen zuge-schrieben wird, ist dabei umso geringer, je stärker konstruktivistische Vorannahmen aus-geprägt sind (Mietzel 2007: 5f).
Im Gegensatz zum traditionellen Unterrichtskonzept erfolgt Lehren und Lernen aus kons-truktivistischer Perspektive in einem sozialen Aushandlungsprozess mit der Umwelt. Aus-zubildende rücken mit ihren Handlungen in den Vordergrund didaktischer Überlegungen beruflichen Lernens und Lehrens. Ihre Aktivität spiegelt sich darin wieder, dass der Wis-sensaufbau als individueller Konstruktionsprozess verstanden wird und sich in einer aktiven Verarbeitung von Wahrnehmung vollzieht (Rebmann et al. 2003: 172). Wissen ist hier keine Kopie der Wirklichkeit (Reinmann/Mandl 2006: 626). Der Lernprozess ist wis-sensabhängig, da Auszubildende ihr vorhandenes Wissen nutzen, um neue Informationen interpretieren zu können und um neues Wissen aufzubauen. Der Lernende übernimmt selbst die Verantwortung für den Verlauf und den Erfolg des Lernprozesses. Die An-nahme eines Dualismus von Denken und Handeln wird hier zurückgewiesen10, vielmehr sollen sich Auszubildende das Wissen handelnd aneignen. Dem Lehrenden obliegt hauptsächlich die Aufgabe, den Lernenden im Verlauf des Lernprozesses zu beraten und zu unterstützen. Er hat im Vergleich zu traditionellen Konzepten keine Steuerungsfunk-tion, sondern stellt Problemsituationen und Werkzeuge zu Verfügung (Reinmann/Mandl 2006: 628). Der Auszubildende sollte an allen Prozessen des Beobachtens und Beurtei-lens beteiligt sein, um somit kontinuierlich an eine Selbstevaluation herangeführt zu wer-den. Zentral ist die Forderung, dass weniger das Ergebnis als vielmehr der Prozess des Lernens zum Gegenstand von Beurteilungen wird.
Die gemäßigt konstruktivistische Auffassung von Lernen versucht, die Prinzipien von In-struktion und Konstruktion miteinander zu verbinden. Jedoch lassen sich die beiden Ge-genpole nicht nach einem Alles-oder-Nichts-Prinzip realisieren. Lernen setzt einerseits immer Motivation und Interesse seitens des Lernenden voraus, andererseits müssen ihre Konstruktionsleistungen durch passende Lehr-Lernsituation unterstützt und gefördert werden. Lernen erfordert auch immer Orientierung, Anleitung und strukturierte Hilfe. Ziel muss es folglich sein, eine Balance zwischen expliziter Instruktion durch den Lehrenden und konstruktiver Aktivität des Lernenden zu finden.
4.2 Komponenten des Expertenkulturansatzes
4.2.1 Experten vs. Novizen
Im Rahmen des Expertenkulturansatzes werden Experten als didaktische Orientierungs-größe gewählt. Für den Begriff des Experten gibt es in der Literatur bislang keine einheitli-che Definition (Gruber/Mandl 1993: 5ff; Gruber/Mandl 1996: 9).
Bromme bezeichnet Experten als Personen, die berufliche Aufgaben zu bewältigen ha-ben, für die sie eine lange Ausbildung und praktische Erfahrung benötigen und die diese Aufgaben erfolgreich lösen können (1992: 7f). In der Expertiseforschung wird der Begriff des Experten doppeldeutig gebraucht (Bromme/Jucks/Rambow 2004: 180). Einerseits wird durch ihn der Unterschied zum Laien und Anfänger hervorgehoben, andererseits wird auf das besondere Wissen und Können hingedeutet, das Experten von anderen ebenfalls berufserfahrenen Kollegen unterscheidet (ebd.: 8).
Als Merkmal von Expertentum hebt Bromme nicht den Aspekt des Vergleichs von schwachen zu starken Leistungen hervor, sondern den Aspekt des Professionellen. Ex-perten sind demnach Personen, „die komplexe berufliche Anforderungen bewältigen, für die sie sowohl theoretisches (...) Wissen als auch praktische Erfahrungen haben sam-meln müssen“ (Bromme/Rambow (2001: 542). Hacker hingegen charakterisiert Experten als „Spitzenkönner“ und akzentuiert den Vergleich mit „durchschnittlichen Arbeitskräften gleicher Ausbildung und gleichem Berufsalter“ (1992: 11). Er stellt fest, dass sich Exper-ten bei industriellen Arbeitstätigkeiten durch ein qualitativ anderes Vorgehen mit kogniti-ven als auch mit motivationalen Aspekten auszeichnen (ebd.: 14).
Was macht einen Experten aus? Die Expertiseforschung zielt darauf ab, wissensbasiertes Handeln bei komplexen Anforderungen zu untersuchen. Üblicherweise wird dem Experten der Novize gegenübergestellt, also eine Person, die auf einem bestimmten Gebiet noch unerfahren ist (Gruber/Mandl 1996: 8) und der die Ausbildung und die institutionellen Rahmenbedingungen für eine eigenständige Problemlösung noch fehlen (Bromme/Rambow 2001: 542). Durch Interaktion zwischen Experte und Novize soll das Wissen des Laien an das des lehrenden Experten angeglichen werden. Die Ergebnisse der Expertiseforschung11 verweisen im Wesentlichen darauf, dass Experten im Vergleich zu Novizen nicht nur mehr wissen, sondern auch durch folgende Eigenschaften gekenn-zeichnet sind: Ein Experte bewältigt eine überdurchschnittliche Anzahl von Aufgaben mit unterdurchschnittlichem Aufwand, er macht weniger Fehler und arbeitet präziser. Ebenso verfügt er über einen umfangreicheren Erfahrungsschatz. Diese eher aus alltagspsycho-logischer Perspektive betrachtete Definition von Krems (1994: 48ff) wird noch präzisiert, wenn man auf die Wissensorganisation von Experten eingeht: Das domänenspezifische Wissen eines Experten ist kohärenter strukturiert, er kann sein Wissen prinzipienorientiert abspeichern und greift dabei auf vielfältige, elaborierte und fallbasierte Wissensschemata zurück. Ebenso verfügen sie über ein komplexes Repertoire an Problemlösestrategien sowie über ein elaboriertes kognitives Wissen (Gruber/Mandl 1996: 19; Gruber/Mandl 1993: 18; Law/Wong 1996: 116; Mietzel 2007: 312ff).
Wie entsteht aber nun Expertise? In der Literatur werden zwei Erklärungen diskutiert, zum einen wird die Erklärung über Disposition zum anderen über umfangreiche Übung gege-ben. Der Dispositionsansatz besagt, dass man nur durch hohe Begabung zu einem Ex-perten heranwachsen kann. Ericsson und Mitarbeiter (1993) und Posner (1988) schreiben einer Disposition aber nur einen geringen Einfluss auf das Entstehen von Expertise zu. Der Übungsansatz vertritt hingegen die Meinung, dass man durch wohldurchdachte und gezielte Übung zur Expertise gelangt. Der Expertisegrad steigt über langzeitige Übungen kontinuierlich an, wobei dies nach Ericsson et al. (1993) auch hohe Erfordernisse und Anstrengungen vom Lernenden abverlangt. Der Novize benötigt ausreichend Ressourcen (Zeit, Energie, Zugang zu Lehrpersonen, Trainingsmaterialien) und eine zusätzlich ent-sprechende Motivation zur Leistungsbereitschaft.
Expertise ist darüber hinaus in verschiedenen Ausprägungsgraden auf einem Kontinuum denkbar, analog der beruflichen Handwerksausbildung, in der man sich über den Lehrling über den Gesellen zum Meister entwickelt (Law/Wong 1996: 115). Reimann (1998: 361) teilt die Entwicklung von Expertentum in drei Stadien auf: Im Anfängerstadium dominiert ein anwendungsspezifisches Wissen, etwa semantische Netze oder deklarative Regeln. Auf dieser Grundlage erfolgt das Problemlösen suchbasiert, langsam und fehleranfällig. Mit zunehmender Praxis wird das Wissen umorganisiert und passt sich flexibler der Auf-gabenstellung an. Dadurch entwickeln sich Automatismen und deklarative Wissens-strukturen, die prototypische Lösungswege repräsentieren. Das Problemlösen erfolgt nun nicht mehr suchbasiert, sondern orientiert sich an früheren Erfahrungen. Im dritten Stadium, das kennzeichnend für ‚echte‘ Expertise ist, wird das Prototypenwissen um konkrete subjektive Erfahrungen erweitert.
Im Expertenkulturansatz wird unter einem Experten eine Person verstanden, „die in der beruflichen Praxis reflektiert und verantwortlich die mit ihren jeweiligen Berufspositionen verbundenen Anforderungen“ bewältigen kann (Zimmermann 1996: 50). Diese Definition orientiert sich eher an der performanzorientierten Sichtweise von Bromme als an jener von Hacker, die sich auf das Spitzenkönnen fokussiert. Bezogen auf den kaufmännischen Bereich wäre ein Experte beispielsweise die Sekretärin, die weiß, wie man einen Ge-schäftsbrief aufsetzt, der Vermögensberater in der Bank, der weiß, wie er seine Kunden kompetent berät oder ein Sachbearbeiter in der Einkaufsabteilung, der weiß, wie man verschiedene Angebote vergleicht.
Auszubildende haben demnach während ihren Praxisphasen in den verschiedenen Ab-teilungen die Möglichkeit, unterschiedliche Experten kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Reinmann-Rothmeier und Mandl (1993: 239) sehen gerade im Lernen die Mög-lichkeit der Entwicklung vom Novizen zu einem Experten. In der Literatur besteht Kon-sens, dass Expertenwissen und der Kontakt mit Experten während der Ausbildung zu effektiverem Lernen und zu effizienteren Problemlösungen beitragen können (Rogoff 1990: 39).
4.2.2 Lernen als Enkulturation in eine Expertenkultur
Unter Enkulturation versteht man im pädagogischen Sinn die Gesamtheit bewusster und unbewusster Lern- und Anpassungsprozesse, durch die der Lernende im Zuge des Hineinwachsens in eine Gesellschaft die wesentlichen Elemente der zugehörigen Kultur übernimmt und folglich zu einer sozialen Persönlichkeit heranreift (Brockhaus 1988: 409). Durch Enkulturations- und Sozialisationsprozesse entwickeln sich zudem Überzeugungs-und Wertesysteme (Reimann/Krapp 2008: 195).
In der betrieblichen Ausbildung ist neben dem Ziel, die Auszubildenden mit den erforderli-chen Kompetenzen zur Bewältigung beruflicher Anforderungen auszustatten, auch die Enkulturation als berufspädagogisches Ziel verankert. Das bedeutet, dass die Persönlich-keitsentfaltung der Auszubildenden und ihre Integration in Arbeits- und Sozialstrukturen zu fördern sind.
Für die Auszubildenden stellt die betriebliche Ausbildungswirklichkeit einen wesentlichen Bezugspunkt der berufs- und ausbildunsgbezogenen Erwartungen dar. Sie treten in einen neuen Erfahrungsbereich ein, in dem sie sich auf Tätigkeitsanforderungen, Organisa-tionsstrukturen und Interaktionsformen einstellen müssen, mit denen sie im Laufe ihrer bisherigen Sozialisation nur wenig zu tun hatten. Diesem Sachverhalt kommt aus päda-gogischer Sicht besondere Aufmerksamkeit zu. Die Möglichkeit der persönlichen „Sinn-erfüllung und sozialen Kommunikation“ muss in den Betrieben daher gewährleistet sein (Senatskommission 1990: 63).
Dazu soll der Auszubildende in eine Expertenkultur eingebunden bzw. in einer „community of practice“ situiert werden (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1993: 4) und so zu einem Mitglied dieser Expertenkultur heranreifen.
Auch Kron zufolge leistet der Enkulturationsprozess mit einem aktiv und kreativ teilneh-menden Individuum einen wesentlichen Beitrag zur Herausbildung einer individuellen Persönlichkeit (1993: 232ff) und formt das alltägliche Verhalten der Auszubildenden.
Dem Expertenkulturansatz liegt die Annahme zugrunde, dass „Expertise in identitätsstif-tende Teilkulturen eingebunden ist, in denen kulturspezifische Wahrnehmungsweisen, Denkmuster, Handlungsweisen und (häufig implizite) Wissensformen geteilt werden“ und „bestimmte Werte, Überzeugungen und Rollenerwartungen und Sozialstrukturen gelten, auf deren Basis Experten agieren und interagieren“ (Zimmermann 1996: 49; Brown/Collins/Duguid 1989: 33f). Das im Laufe der betrieblichen Ausbildung erworbene berufliche Wissen ist mehr als explizites Wissen über Fakten, Zahlen, Zusammenhänge und Problemlösemethoden. Es umfasst darüber hinaus Orientierungen, Bilder, Werte und Überzeugungen, die nicht nur das berufliche Handeln lenken, sondern auch die Wahr-nehmung der Umwelt beeinflussen. Es wird durch den Kontakt mit den ausbildenden Ex-perten innerhalb der Expertenkultur geprägt. Dieses Wissen ist zumeist implizit, es be-einflusst das Handeln, der Handelnde ist sich dessen jedoch kaum bewusst.
Zur Erklärung des Zusammenhangs von beruflichem Lernen und Enkulturation sind be-sonders die sozialen Lerntheorien bedeutend. Wenger (1998: 47) versteht unter Lernen zum einen die Veränderung von im Langzeitgedächtnis gespeicherten Wissensstrukturen, zum anderen findet Lernen in enger Verbindung zwischen Denken und Handeln statt und erfolgt durch Partizipation in einer Gemeinschaft (ebd.: 4). Diese Teilhabe entwickelt und formt die eigene Identität und das Selbstbild. In den sozial-kulturellen Lerntheorien wird keine strenge Grenze zwischen Wissenserwerb und Identitätsbildung gezogen. Beide resultieren aus der Interaktion mit sozialen und kulturellen Ressourcen (Lave/Wenger 1991: 53; Rogoff 1990: 8ff).
Miteinander beruflich interagierende Menschen formen eine Art „community of practice“. Diese Wissensgemeinschaften (Reimann/Rapp 2008: 195) benötigen für ihre Existenz ein gemeinsames Wertesystem und eine gemeinsame Geschichte, die auch in Form von Erzählungen und durch verbalen Erfahrungsaustausch weitergegeben und dadurch mit lebendigen und aktuellen Informationen angereichert wird (Lave/Wenger 1991: 29). Jedes Mitglied der Expertenkultur trägt durch die individuelle Auswahl dessen, was es verbal weitergibt, selbst identitätsstiftend zur Gemeinschaft bei (Barab/Duffy 2000: 37). Durch die schrittweise Übernahme der Werte und Praktiken einer Expertenkultur erlangen Novizen zunehmend Souveränität, als vollwertige Mitglieder die Gemeinschaft mitzugestalten.
4.2.3 Ethische Legitimierung: Die Verantwortungsbereitschaft als Ziel der Berufsausbildung
An die duale Berufsausbildung wird der Anspruch gestellt, Sozialkompetenz zu vermitteln (Beck et al. 1998: 188), wozu unter anderem gehört, dass Auszubildende Schlüsselquali-fikationen wie bspw. Verantwortungsbewusstsein und moralische Urteils- und Handlungs-kompetenz erwerben (Yang 1998: 5, 161). Auch nach Zabeck schließt die Berufsausbil-dung ethische Fragen der Lebensführung mit ein (1991: 534ff). Die Auszubildenden sollen befähigt werden, in konkreten Lebenszusammenhängen den ökonomischen Aspekt zu berücksichtigen, zugleich aber auch verantwortlich zu handeln und ethische Verpflich-tungen gegenüber dem Nächsten und dem Ganzen zu wahren (ebd.: 545).
Den Experten fällt somit auch die erzieherische Aufgabe zu, die Persönlichkeitsent-wicklung des Auszubildenden pädagogisch zu unterstützen (Brezinka 1990: 79). Dabei sollen die Auszubildenden soziale Rollen, Verhaltensweisen und die Einsicht in Werte und Normen der spezifischen Expertenkultur erlernen.
Man kann nicht immer davon ausgehen, dass die in der Realität vorfindbare Kultur in ethischer und fachlicher Hinsicht den pädagogischen Vorstellungen von einer ‚gelungenen‘ Berufsausbildung entspricht. Oftmals besteht ein Interessenkonflikt zwischen den pädagogischen Zielen der betrieblichen Ausbildung und den Zielen und der Absicht des unternehmerischen Handelns. Unternehmen investieren in ihre Ausbildungs-bestrebungen gemäß ihren ökonomischen Zielen und Interessen. Entscheidungen der Geschäftsführung bestimmen dabei die Realisierungsmöglichkeiten und Bedingungen der betrieblichen Erziehungspraxis, die sich im Wesentlichen aus Kosten-Nutzen-Betrach-tungen ergeben12, wobei unter Umständen pädagogische Prinzipien vernachlässigt wer-den. Auch könnte die Expertenkultur durch nicht ausgebildetes Personal moralisch defor-miert sein. Deshalb erfordert der Erwerb des Ausbilderscheins gemäß AEVO sowohl die fachliche wie pädagogische Eignung des Ausbilders (siehe Kapitel 2).
In diesem Sinne ist der Expertenkulturansatz nicht als unreflektierte Internalisierung kul-turspezifischer Überzeugungen zu verstehen. Er ist vielmehr von dem pädagogischen Bemühen geprägt, die Auszubildenden mit jenen Kompetenzen auszustatten, die ihnen eine Bewährung und Mitgestaltung im beruflichen Feld ermöglichen. Dazu sind Freiräume zu schaffen, in denen sie eine tragfähige Identität aufbauen können. Das bedeutet auch für den Ausbilder, nicht ‚an der Realität vorbei‘ auszubilden, sondern moralische und fach-liche Standards, Regeln, Tricks und Expertenkniffe der Berufswirklichkeit den Auszubil-denden bewusst zu machen und sie zum kritischen Hinterfragen anzuregen (Zimmermann/Müller/Wild 1994: 13).
Eine gelungene pädagogische Enkulturation in eine Expertenkultur weist folgende Merk-male auf: Den Auszubildenden wird eine offene Konfrontation mit sozialen Problemen und Konflikten ermöglicht, sie haben zudem die Chance an der Teilnahme an Kommunika-tionsprozessen und an Partizipationsmöglichkeiten bei Entscheidungen. Ebenso erhalten sie eine angemessene Zuweisung und Zurechnung von Verantwortung (Beck et al. 1998: 195). Eine Lernumwelt, die in diesem Sinne gestaltet ist, hat förderliche Effekte auf die sozialen und kommunikativen Fertigkeiten der Auszubildenden sowie auf die Entwicklung des gegenstandsbezogenen Interesses (Zimmermann/Müller/Wild 1994: 13).
Wodurch ist eine gelungene pädagogisch unterstützte Enkulturation in eine Expertenkultur gekennzeichnet? Wie sollen betriebliche Lehr-Lern-Situationen in der Ausbildung unter Berücksichtigung des Expertenkulturansatzes gestaltet werden? Dieser Frage wird im folgenden Kapitel nachgegangen.
4.2.4 Zur Gestaltung betrieblicher Ausbildungssituationen im Sinne des Expertenkulturansatzes: Der Cognitive Apprenticeship-Ansatz
Im Zentrum dieses instruktionspsychologischen Ansatzes, der 1989 von den amerika-nischen Forschern Collins, Brown und Newman erarbeitet wurde und auf den Erkenntnis-sen der Expertenforschung beruht, steht die Frage, wie Wissen vermittelt werden soll, damit es auf die Praxis übertragen und in komplexen Problemsituationen flexibel ange-wendet werden kann.
Mandl, Gruber und Renkl (1993: 64f) zeigen in ihrem Aufsatz, dass Wirtschaftswissen-schaft-Studenten höherer Semester schlechter bei Anwendungs- und Entscheidungs-situationen abschnitten als Laien. Das im Studium erworbene Fach- und Spezialwissen kann offenbar nicht auf konkrete betriebswirtschaftliche Entscheidungen vernünftig ange-wendet werden. Mandl et al. machen dafür die Entstehung des trägen Wissens verant-wortlich (siehe Kapitel 4).
Wie bereits zuvor erwähnt, ist das Ziel des Cognitve Apprenticeship Ansatzes, der Ent-stehung von trägem Wissen entgegenzuwirken (Collins/Brown/Newman 1989: 457), so-dass die Lernenden ihre erworbenen Denk- und Handlungsschemata situationsadäquat anwenden können. Die Lernenden sollen zu stabilen Problemlösestrategien und zu lebensbegleitendem Lernen befähigt werden (Straka 2002: 133), indem der Erwerb von Fertigkeiten und Wissen in deren sozialen und funktionalen Kontext eingebettet wird. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung von betrieblichen Lernsituationen.
Collins et al. versuchen mit ihrem Ansatz, charakteristische Elemente der traditionellen Handwerkslehre auf kognitive Probleme zu übertragen (Dörig 1994: 262). Der Ansatz kann sowohl auf schulische als auch auf betriebliche Bildungskontexte angewendet wer-den (ebd.: 270; Zimmermann 1996: 51). Der Fokus dieser Arbeit ist jedoch ausschließlich auf den Lernort Betrieb gerichtet. Es handelt sich um einen gemäßigt-konstruktivistisch begründeten Ansatz, der deutliche Prinzipien einer konstruktivistischen Didaktik beinhaltet (siehe Kapitel 4.1).
Der Cognitive Apprenticeship-Ansatz orientiert sich am Handeln von Experten. Wie gehen Experten also vor, wenn sie komplexe Aufgaben bearbeiten?
Hierzu ist es notwendig, dass sowohl explizites Wissen in Form von Begriffs-, Fakten- und Prozesswissen als auch implizites Wissen, bestehend aus heuristischen Strategien sowie Kontroll- und Lernstrategien, aufgebaut wird (ebd.: 477ff). Dabei ist dem Lernenden die Erarbeitung einer bedeutsamen Aufgaben- und Problemstellung durch einen Fachexper-ten innerhalb einer möglichst realitätsnahen problemhaltigen Lernsituation zu vermitteln (ebd.: 457, 486f). Der Experte bietet hierbei die Vorgehensweise dar und erläutert sie. Anschließend hat der Lernende ebenso realitätsnahe Problemsituationen möglichst selbstständig zu bewältigen. Dem Lernenden können zunächst Lösungsschritte abge-nommen werden, und er kann mit angemessenen Hilfestellungen (Anleitung, Unterstützung, Rückmeldung) durch den Experten unterstützt werden. Diese Hilfen wer-den sukzessive zurückgenommen, wodurch das Ausmaß der Selbstkontrolle im Lern-prozess stetig zunimmt (Niegemann 1994: 77). Die Lehr-Lern-Situation hat daher einen adaptiven Charakter. Trotz der eher konstruktivistischen Auffassung von Lernen, die dem Cognitive Apprenticeship-Ansatz zugrunde liegt, werden die Lernenden durch ein spezifi-sches Methodenrepertoire angeleitet und unterstützt (Reinmann-Rothmeier/Mandl 2006: 619f).
Der Handlungsrahmen zur Gestaltung von Lernumgebungen im Sinne des Cognitve Apprenticeship Ansatzes wird durch vier Dimensionen bestimmt: Inhalt, Methoden, Strukturierung und soziales Umfeld. Nachfolgend werden diese Designparameter aus-führlich erläutert.
4.2.4.1 Die Dimension Inhalt
Ideale Lernumgebungen, die mittels des Cognitive Apprenticeship-Ansatz gestaltet wer-den, ermöglichen gleichzeitig den Aufbau der vier Bereiche des Expertenwissens:
Domänenspezifisches Wissen umfasst nach Collins et al. (1989: 477f) das Fakten-, Begriffs- und Prozesswissen, das für ein bestimmtes Gebiet explizit vermittelt wird, wobei dieses Bereichswissen nicht abstrahiert von seinem Gebrauch in Realsituationen vermit-telt werden darf, sondern in unterschiedlichen Problemsituationen angewendet wird.
Heuristische Strategien sind effektive Techniken und Vorgehensweisen zur Bewältigung von schwierigen Aufgabenstellungen. Diese Strategien werden von den Lernenden wäh-rend des Problemlöseprozesses meist unbewusst erworben (Collins/Brown/Newman 1989: 478).
Kontrollstrategien unterstützen den Lernenden dabei, sein eigenes Vorgehen bei Problemlösungsprozessen durch Steuerung und Überwachung zu überprüfen. Hierzu müssen sie in der Lage sein, über ihren Problemlöseprozess zu reflektieren. Charakteris-tisch für Kontrollstrategien ist, dass sie auf verschiedenen Ebenen ablaufen und Strate-gien des Überwachens, des Diagnostizierens und des Regulierens umfassen (Collins/Brown/Newman 1989: 478f).
Lernstrategien dienen der Aneignung aller zuvor beschriebenen Inhalte, ausgehend vom Wissen über Strategien, wie man eine neue Domäne untersuchen muss bis hin zu Strate-gien, wie man sein Wissen bei Bedarf ausweiten oder umgestalten kann. Collins, Brown und Newman beschreiben diese als „knowledge about how to learn” (1989: 479).
4.2.4.2 Die Dimension Methode
Die Methoden, die eine ideale Lernumgebung fördern, stellen den Mittelpunkt des Cog-nitve-Apprenticeship-Ansatzes dar und sind durch sieben Bausteine gekennzeichnet: M odeling, Coaching, Scaffolding, Fading, Articulation, Reflection und Exploration. Den Ler-nenden soll damit ermöglicht werden, kognitive und metakognitive Strategien aufzubauen und diese adäquat anzuwenden.
Der Experte demonstriert dem Lernenden zunächst anhand eines spezifischen Problems sein Vorgehen und externalisiert die dabei internal ablaufenden Prozesse (Collins/Brown/Newman 1989: 481). Dies gewährt den Lernenden einen Einblick in die relevanten Problemlösungsprozesse (Gruber/Mandl 1993: 25). Durch modellhaftes Vor-führen (Modeling) soll dem Lernenden ermöglicht werden, ein mentales Modell derjenigen Handlungen aufzubauen, die für eine sachgerechte Aufgabenbearbeitung notwendig sind. Auf dieses mentale Modell kann er dann die späteren Lernerfahrungen rückbeziehen (Dörig 1994: 266).
Der Lernende übt unter Anleitung durch den Experten nun selbstständig an authentischen Situationen oder realen Objekten und wird durch ihn bei seiner Vorgehensweise beobachtet. Zur weiteren Annäherung an die Expertenleistung werden gezielte Hinweise, Feedback, modellhafte Vorführungen und Erinnerungsstützen gegeben (Coaching). Die Hilfestellung ist dann effizient, wenn sie problembezogen ist, situativ erfolgt und auf die Fertigstellung der Aufgabe hinarbeitet. Zudem erhalten die Lernenden von den Experten strukturierte Hilfestellungen und stützende Anleitungen, sofern sie Teile der Aufgaben-stellung noch nicht selbstständig bewältigen können (Scaffolding). Diese Methode stellt ein kooperatives Problemlösen zwischen dem Experten und dem Lernenden dar. Hierzu muss der Experte in der Lage sein, das gegenwärtige Leistungsniveau des Lernenden festzustellen. Er nimmt in Abhängigkeit vom Grad der Selbstständigkeit des Lernenden sukzessive seine Hilfestellungen zurück (Fading) bis der Lernende die Aufgabenstellung selbstständig lösen kann (Collins/Brown/Newman 1989: 482f; Reinmann-Rothmeier/Mandl 2006: 620).
Durch den kommunikativen Austausch (Articulation) soll der Lernende sein Wissen, seine Überlegungen und sein Vorgehen bei der Problembearbeitung zum Ausdruck bringen. Der Lernende präsentiert seine Ergebnisse und erfährt Rückmeldung durch den Experten. Diese Methode subsumiert Formen, die von der Beantwortung von Fragen bis hin zum Rollentausch reicht, bei dem die Lernenden die Rolle des Experten übernehmen (Collins/Brown/Newman 1989: 482). Die impliziten Bestandteile des Wissens werden ex-plizit gemacht, sodass das Wissen dekontextualisiert wird und auf verschiedene Zusam-menhänge übertragen werden kann (Reetz 1996: 181). Durch die Externalisierung bietet sich für den Lernenden die Möglichkeit, sein Wissen durch Kommunikation mit anderen zu überprüfen und zu elaborieren.
Diskussionen mit der Lerngruppe ermöglichen dem Lernenden, seine eigenen Problem-löseprozesse mit jenen von Experten und von anderen Lernenden zu vergleichen (Reflection). Durch eine Analyse mittels Videoaufzeichnungen können beispielsweise Leistungen wiedergegeben und wiederholt werden, damit sie mit jenen von Experten verglichen wer-den können (ebd.: 482f). Durch die Reflektion soll der Lernende ermutigt werden, sich selbst zu überprüfen, wodurch sich seine Leistungen verbessern können.
[...]
1 Im Folgenden wird wegen der Lesbarkeit auf die jeweilige weibliche Personenbezeichnung verzichtet. Das jeweils andere Geschlecht ist immer mitzudenken.
2 Unter einer ganzheitlichen Berufsausbildung wird die systematisch abgestimmte Verknüpfung der Vermittlung von theoretischem Fachwissen gepaart mit allgemeiner Bildung sowie praktischen Tätigkeiten im Betrieb verstanden (Jungkunz 2008: 3).
3 Nach § 2 und § 5 BBiG kann der Lernort Betrieb auch durch andere Lernorte ersetzt werden. Überbetriebliche Bildungseinrichtungen und Ausbildungsverbünde gewinnen dort an Bedeutung, wo aus konjunkturellen oder strukturellen Gründen nicht genügend Betriebe ausbilden. Prinzipiell überwiegt in Deutschland aber die klassische Variante, nach der der Ausbildungsbetrieb den zentralen Lernort im Rahmen der Berufsausbildung darstellt.
4 Die Ausbildungsquote misst den Anteil der Auszubildenden an allen Beschäftigten.
5 Unter der Ausbildungsbetriebsquote versteht man den Anteil der ausbildenden Betriebe an den Betrieben insgesamt.
6 Der Ausbilderbegriff wird zwar im BBiG genannt (§§ 6, 8, 20, 21 und 33 BBiG), jedoch ungenügend differenziert und präzisiert.
7 Vgl. Sloane (2006), der auf verschiedene Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen verweist.
8 Die fehlende gesetzliche Bestimmung ist bereits früh gerügt worden: „Die gesetzliche Grundlage für eine eindeutige Ausbilder-Definition ist dürftig. Zwar wird der Begriff [...] rechtlich verankert, aber wie viele Ausbilder ein Betrieb tatsächlich bestellen mu l3, wie viele Ausbilder im Sinne des § 20 BBiG geeignet sein müssen und ob letztlich der Bestellung von Ausbildern gegenüber der zuständigen Stelle lediglich formal Folge geleistet werden mu l3, dies alles bleibt weiterhin offen“ (Kutt 1980: 825).
9 Träges Wissen beschreibt den Sachverhalt, dass Wissen zwar vorhanden ist, jedoch in einer entsprechenden Anwendungssituation nicht aktiviert werden kann (Ebner 2000: 14).
10 Zum Problem des Dualismus von Denken und Handeln: Piaget (1995).
11 Studien von De Groot (1965) und Chase/Simon (1973) am Schachmodell erwiesen sich als aussagekräftiges Instrumentarium. Weitere klassische Expertisestudien liegen von Chi, Feltovich und Glaser (1981) vor.
12 Ma l3 geblich für den Nutzen ist die Leistung des Auszubildenden am Arbeitsplatz (Yang 1998: 182).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Expertenkulturansatz in der Ausbildung?
Es ist ein didaktisches Konzept, bei dem Auszubildende durch aktive Teilnahme an authentischen Problemlösungen schrittweise in die Kultur und das Wissen von Experten einbezogen werden (Enkulturation).
Was bedeutet „Cognitive Apprenticeship“?
Dieser Ansatz sieht Lernen als Prozess, bei dem Experten ihre Denk- und Problemlöseprozesse verbalisieren, damit Auszubildende diese kognitiven Modelle beobachten und übernehmen können.
Warum reicht klassische Unterweisung heute oft nicht mehr aus?
In einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt müssen Auszubildende nicht nur Fachwissen reproduzieren, sondern auch komplexe, unvorhersehbare Probleme eigenständig lösen können.
Welche Rolle spielt die Ausbildereignungsverordnung (AEVO)?
Die AEVO definiert die pädagogischen Mindestanforderungen. Kritiker betonen jedoch, dass für eine moderne, handlungsorientierte Ausbildung oft weitergehende Qualifikationen nötig sind.
Was ist das Ziel der Enkulturation in der Berufsausbildung?
Das Ziel ist die vollständige Integration der Auszubildenden in die Arbeitswelt und die Entwicklung einer verantwortungsbewussten beruflichen Handlungsfähigkeit.
- Quote paper
- Margret Jonas (Author), 2009, Die betriebliche Ausbildung auf der Grundlage des Expertenkulturansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/133995