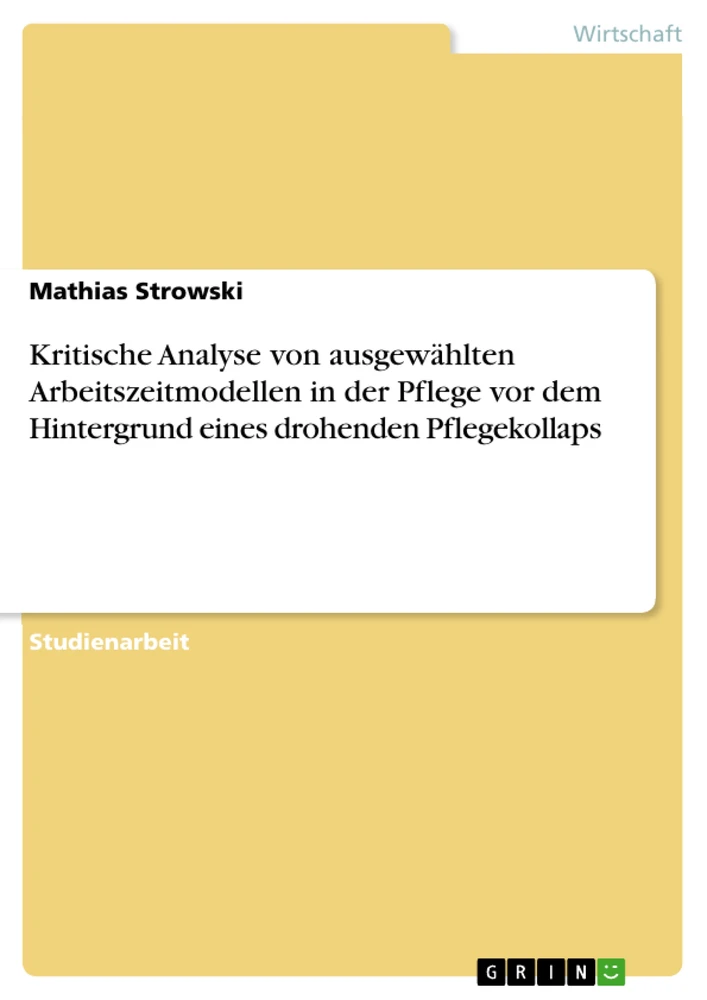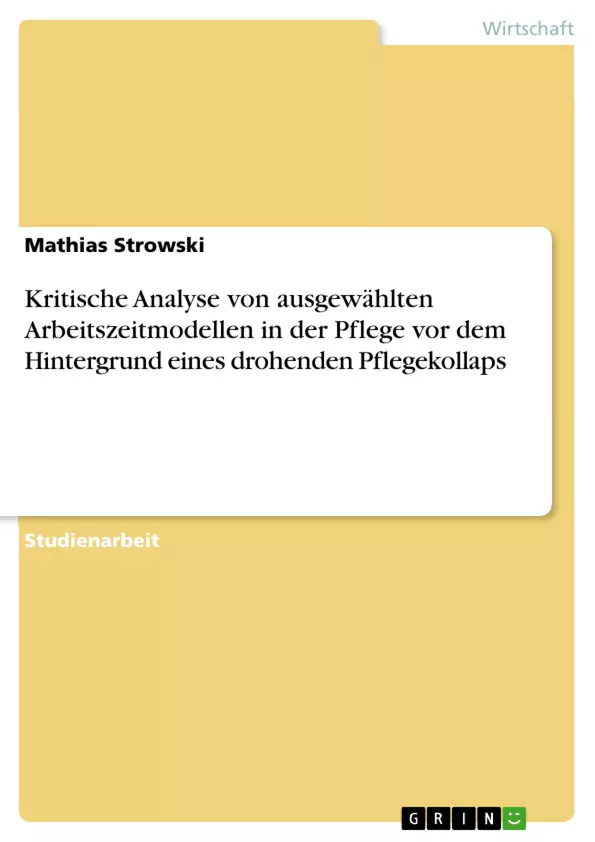Der Pflegeberuf wird von der Gesellschaft als wenig attraktiv eingestuft. Vor allem der Altenpflegeberuf stößt auf ein sehr geringes Interesse bei Schüler*innen. Die demografischen Veränderungen, der Mangel an Nachwuchs sowie die Abwanderungen der Pflege in andere Berufe führten ebenfalls zum spürbaren Pflegemangel in Deutschland. Die Aufwertung des Pflegeberufs sowie die Gewinnung der jungen Generation für den Pflegeberuf stellt die Politik sowie die Gesundheitseinrichtungen vor große Herausforderungen. Die aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen in der Pflege, sowie die Gestaltung von Arbeitsbedingungen, insbesondere der unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen werden in der vorliegenden Arbeit anhand der Literaturrecherche zusammengefasst. Zudem werden Aspekte der aktuellen Arbeitszeitmodellen im ambulanten und vor allem im stationären Pflegesektor diskutiert. Wesentliche Entwicklungen bei den Pflegeberufen der letzten Jahre (Demografie, Beschäftigungsgrad, Geschlechterverteilung, Voll- und Teilzeittätigkeiten) werden anhand der aktuellen statischen Daten vorgestellt und analysiert. Darüber hinaus sind bundespolitische Initiativen, neue gesetzliche Rahmenbedingungen zur Gewinnung von in- und ausländischen Pflegekräften, sowie die Maßnahmen zur attraktiven Gestaltung der Pflegetätigkeiten Gegenstand des Artikels. Die Aspekte der Voll- und Teilzeittätigkeit in der Pflege werden aus Sicht der wichtigsten Stakeholder diskutiert. Des Weiteren werden Gestaltungsmöglichkeiten von individuell angepassten Arbeitszeitmodellen als Argument zur Rekrutierung der digital-technologisch sowie Work-Life-Kohärenz orientierten Generationen Y und Z zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung/Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hintergrund
- 1.2 Aktuelle und künftige Arbeitsmarktsituation des Pflegeberufs
- 1.3 Besonderheiten der Pflegetätigkeiten
- 1.4 Ziele und Vorgehen
- 2 Arbeitszeitmodelle
- 2.1 Beschäftigungsstrukturen in der Pflege
- 2.2 Besonderheiten der Schichtdienstmodelle
- 3 Neue gesetzliche Regelungen zur Aufwertung der Pflege
- 4 Erwartungen der jungen Generation an den Pflegeberuf
- 4.1 Personalbedarfsermittlung und Besonderheiten bei Vollzeitbeschäftigung
- 4.2 Generelle Aspekte der Teilzeittätigkeit
- 4.3 Arbeitszeitvarianten in Teilzeit
- 4.3.1 Teilzeit classic
- 4.3.2 Teilzeit classic vario
- 4.3.3 Teilzeit invest
- 4.3.4 Jobsharing
- 4.3.5 Saisonale Teilzeitmodelle
- 4.3.6 Gleitzeitvarianten
- 4.4 Vor- und Nachteile der Arbeitszeitflexibilisierung
- 4.4.1 Ziele der Arbeitszeitflexibilisierung
- 4.4.2 Vollzeit
- 4.4.3 Teilzeit
- 5 Schlussbetrachtung und Ausblick
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert kritisch ausgewählte Arbeitszeitmodelle in der Pflege vor dem Hintergrund eines drohenden Pflegekollapses. Sie beleuchtet die Herausforderungen, denen der Pflegeberuf in Deutschland begegnet, und untersucht die Bedeutung von flexiblen Arbeitszeitmodellen zur Attraktivitätssteigerung des Berufs. Die Arbeit beleuchtet die aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen in der Pflege, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen.
- Die Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs durch flexible Arbeitszeitmodelle
- Die aktuelle und künftige Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich
- Die Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung und deren Varianten in der Pflege
- Die Erwartungen der jüngeren Generationen an den Pflegeberuf
- Die Rolle der Politik bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen in der Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand der Pflege in Deutschland beleuchtet. Sie stellt die Herausforderungen durch die demografische Entwicklung und den Mangel an Pflegekräften dar. Das Kapitel erläutert die geringe Attraktivität des Berufs in der Gesellschaft, die Ursachen für den Pflegemangel sowie die Bedeutung der Gewinnung von Nachwuchs.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Arbeitszeitmodelle in der Pflege vorgestellt, darunter die Besonderheiten von Schichtdienstmodellen und die Auswirkungen von Voll- und Teilzeitbeschäftigung. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle im Hinblick auf ihre Flexibilität und ihre Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Beschäftigten.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Es betrachtet neue gesetzliche Regelungen zur Aufwertung des Pflegeberufs und die Bedeutung von attraktiven Arbeitszeitmodellen. Die Arbeit untersucht, inwieweit die aktuellen Gesetze und Rahmenbedingungen den Bedürfnissen der Pflegekräfte gerecht werden und wie diese optimiert werden können.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Erwartungen der jungen Generation an den Pflegeberuf. Es analysiert, welche Faktoren für junge Menschen entscheidend sind, um eine Tätigkeit in der Pflege auszuüben. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Arbeitszeitflexibilität, Work-Life-Balance und Karriereperspektiven für die Rekrutierung von Pflegekräften der Generationen Y und Z.
Schlüsselwörter
Pflegeberuf, Arbeitszeitmodelle, Arbeitsbedingungen, Attraktivitätssteigerung, Demografie, Pflegemangel, Teilzeitbeschäftigung, Schichtdienst, Work-Life-Balance, Generationen Y und Z, Gesundheitspolitik, Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, Digitalisierung, Berufsperspektive.
- Quote paper
- Prof. Dr. med. Dr. h. c. Mathias Strowski (Author), 2021, Kritische Analyse von ausgewählten Arbeitszeitmodellen in der Pflege vor dem Hintergrund eines drohenden Pflegekollaps, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1335653