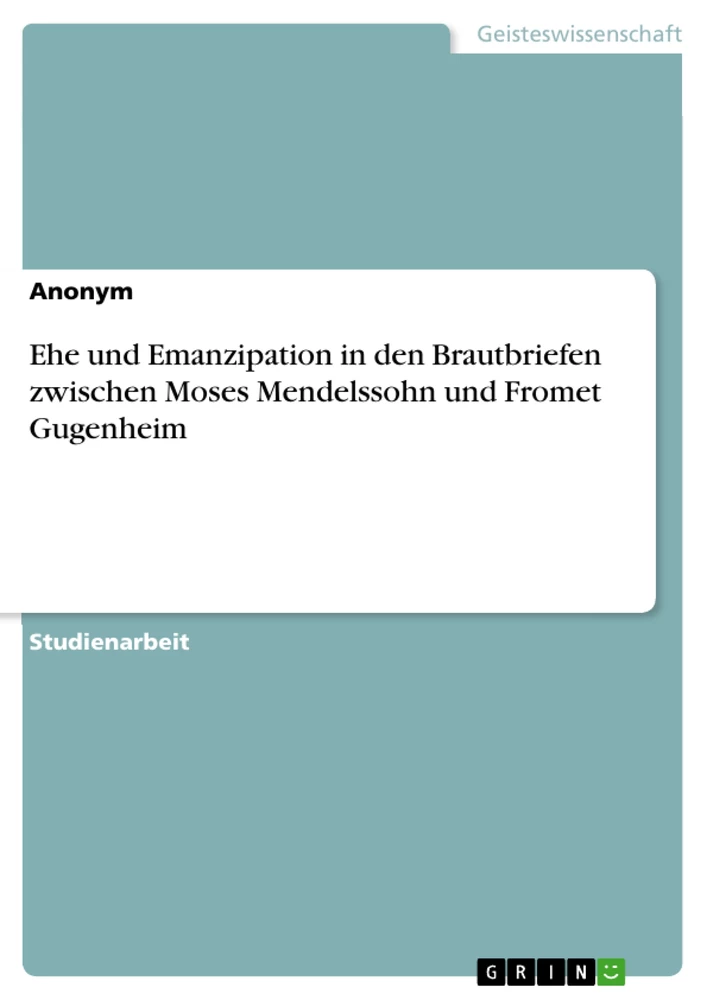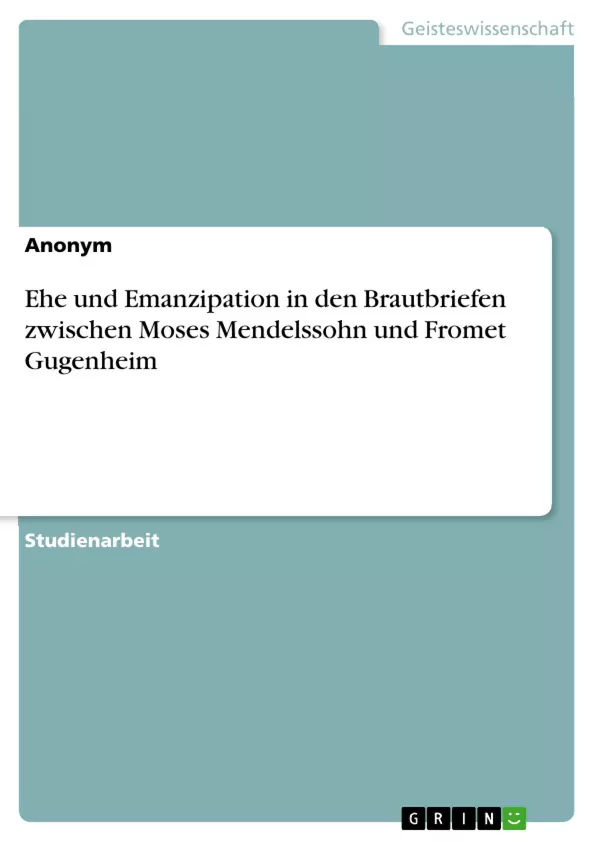In den Brautbriefen zwischen Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim wird der:die Leser:in Zeuge:in einer für die damalige Zeit ungewöhnlich liebevollen Beziehung, in der die gegenseitige Zuneigung und Anziehung erstmals dokumentiert werden und im Mittelpunkt stehen. In dieser Arbeit wird die Entwicklung des jüdischen Eheschließungsrechtes der Vormoderne und die Abweichung der tatsächlichen Eheschließung von Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim thematisiert, mit einem Fokus auf die Untersuchung, welche einstigen Traditionen in den Brautbriefen gebrochen wurden.
In der jüdischen Tradition spielte die wechselseitige Liebe der Brautleute für die Vermählung jahrhundertelang keine tragende Rolle. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde noch ein Großteil der Eheschließungen in Aschkenas von den Eltern arrangiert, wobei sich Braut und Bräutigam nicht selten erst am Tag der Hochzeit zum ersten Mal begegneten.
Im Zeitalter der (jüdischen) Moderne allerdings war allmählich eine Aufbruchstimmung diesbezüglich zu vernehmen. Waren die für die Auswahl des Ehepartners ausschlaggebenden Faktoren zunächst noch der Berufsstand des Mannes oder die Höhe der Mitgift der Frau, so wurden diese nach und nach durch Liebe und Romantik ergänzt, bis sie in vielen Fällen schließlich gänzlich von ihnen abgelöst wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Recht und Tradition der jüdischen Eheschließung vor der Haskala
- 3. Die Brautbriefe Mendelssohns - Tradition und Trotz
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des jüdischen Eheschließungsrechtes bis zur Haskala und analysiert die Brautbriefe von Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim als Beispiel für den Wandel in der jüdischen Ehe. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie Traditionen in den Brautbriefen gebrochen wurden und wie dies die Emanzipation der jüdischen Gemeinde widerspiegelt.
- Entwicklung des jüdischen Eheschließungsrechtes vor der Haskala
- Analyse der Brautbriefe Mendelssohns und Gugenheims
- Traditionen in den Brautbriefen und deren Bruch
- Zusammenhang zwischen Wandel der Ehe und jüdischer Emanzipation
- Die Haskala als gesellschaftlicher Hintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die jüdische Aufklärung (Haskala) als Reformbewegung im 18. Jahrhundert und deren Ziele, wie Reformen in Bildung und Religion sowie die Emanzipation der jüdischen Gemeinde. Sie hebt die Kontroversen zwischen Rabbinern und Maskilim hervor und diskutiert den Einfluss des außerjüdischen Kontextes. Die Arbeit konzentriert sich auf die jüdische Gesellschaft im Aschkenas der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wobei Moses Mendelssohn als zentrale Figur im Kontext der jüdischen Ehe betrachtet wird. Die Einleitung betont die Bedeutung der Brautbriefe Mendelssohns und Gugenheims als Beispiel für den Wandel von einer wirtschaftlich geprägten Ehe hin zu einer Ehe aus Liebe.
2. Recht und Tradition der jüdischen Eheschließung vor der Haskala: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen und traditionellen Aspekte jüdischer Eheschließungen vor der Haskala. Es wird detailliert auf die Rolle der Eltern bei der Partnerwahl, die geringe Bedeutung der Liebe und die Fokussierung auf wirtschaftliche Aspekte wie Beruf des Mannes und Mitgift der Frau eingegangen. Das Kapitel beschreibt den historischen Kontext und die gesellschaftlichen Normen, die die Eheschließungen prägten und den starken Einfluss der Tradition auf die Partnerwahl. Der Kontrast zu den später aufkommenden Ideen der Romantik und Liebe wird vorbereitet.
3. Die Brautbriefe Mendelssohns - Tradition und Trotz: Dieses Kapitel analysiert die Brautbriefe von Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim. Es wird untersucht, wie die in den Briefen zum Ausdruck kommende Liebe und Zuneigung im Gegensatz zu den traditionellen Eheschließungsformen stand. Die Analyse konzentriert sich auf die spezifischen Beispiele aus den Briefen, die zeigen, wie Mendelssohn und Gugenheim gegen traditionelle Erwartungen vorgingen und eine neue Form der Partnerschaft schufen. Das Kapitel beleuchtet, wie diese Briefe ein frühes Beispiel für die Herausbildung einer partnerschaftlichen, auf Liebe basierenden Ehe innerhalb der jüdischen Gemeinschaft darstellen.
Schlüsselwörter
Jüdische Aufklärung (Haskala), Moses Mendelssohn, Fromet Gugenheim, Brautbriefe, Eheschließungsrecht, jüdische Tradition, Emanzipation, Moderne, Liebe, Romantik, Aschkenas, Vormoderne.
Häufig gestellte Fragen zu: Die Brautbriefe Mendelssohns - Tradition und Trotz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des jüdischen Eheschließungsrechts bis zur Haskala und analysiert die Brautbriefe von Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim als Beispiel für den Wandel in der jüdischen Ehe. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie Traditionen in den Brautbriefen gebrochen wurden und wie dies die Emanzipation der jüdischen Gemeinde widerspiegelt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des jüdischen Eheschließungsrechts vor der Haskala, die Analyse der Brautbriefe Mendelssohns und Gugenheims, Traditionen in den Brautbriefen und deren Bruch, den Zusammenhang zwischen dem Wandel der Ehe und der jüdischen Emanzipation sowie die Haskala als gesellschaftlichen Hintergrund.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über das Recht und die Tradition der jüdischen Eheschließung vor der Haskala, einem Kapitel über die Brautbriefe Mendelssohns und Gugenheims und einer Zusammenfassung mit Ausblick.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die jüdische Aufklärung (Haskala) als Reformbewegung im 18. Jahrhundert und deren Ziele. Sie hebt die Kontroversen zwischen Rabbinern und Maskilim hervor und diskutiert den Einfluss des außerjüdischen Kontextes. Der Fokus liegt auf der jüdischen Gesellschaft im Aschkenas der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wobei Moses Mendelssohn als zentrale Figur im Kontext der jüdischen Ehe betrachtet wird. Die Bedeutung der Brautbriefe als Beispiel für den Wandel von einer wirtschaftlich geprägten Ehe hin zu einer Ehe aus Liebe wird betont.
Worüber handelt Kapitel 2?
Kapitel 2 beleuchtet die rechtlichen und traditionellen Aspekte jüdischer Eheschließungen vor der Haskala. Es wird detailliert auf die Rolle der Eltern bei der Partnerwahl, die geringe Bedeutung der Liebe und die Fokussierung auf wirtschaftliche Aspekte eingegangen. Das Kapitel beschreibt den historischen Kontext und die gesellschaftlichen Normen, die die Eheschließungen prägten und den starken Einfluss der Tradition auf die Partnerwahl. Der Kontrast zu den später aufkommenden Ideen der Romantik und Liebe wird vorbereitet.
Was ist der Inhalt von Kapitel 3?
Kapitel 3 analysiert die Brautbriefe von Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim. Es wird untersucht, wie die in den Briefen zum Ausdruck kommende Liebe und Zuneigung im Gegensatz zu den traditionellen Eheschließungsformen stand. Die Analyse konzentriert sich auf spezifische Beispiele aus den Briefen, die zeigen, wie Mendelssohn und Gugenheim gegen traditionelle Erwartungen vorgingen und eine neue Form der Partnerschaft schufen. Das Kapitel beleuchtet, wie diese Briefe ein frühes Beispiel für die Herausbildung einer partnerschaftlichen, auf Liebe basierenden Ehe innerhalb der jüdischen Gemeinschaft darstellen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Jüdische Aufklärung (Haskala), Moses Mendelssohn, Fromet Gugenheim, Brautbriefe, Eheschließungsrecht, jüdische Tradition, Emanzipation, Moderne, Liebe, Romantik, Aschkenas, Vormoderne.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Ehe und Emanzipation in den Brautbriefen zwischen Moses Mendelssohn und Fromet Gugenheim, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1333958