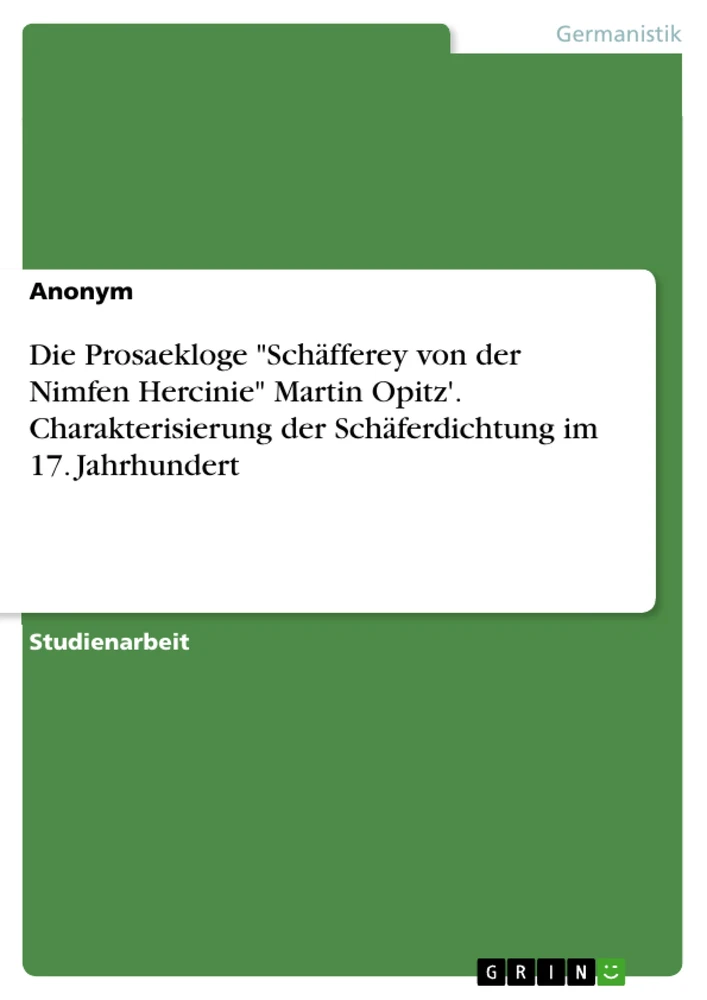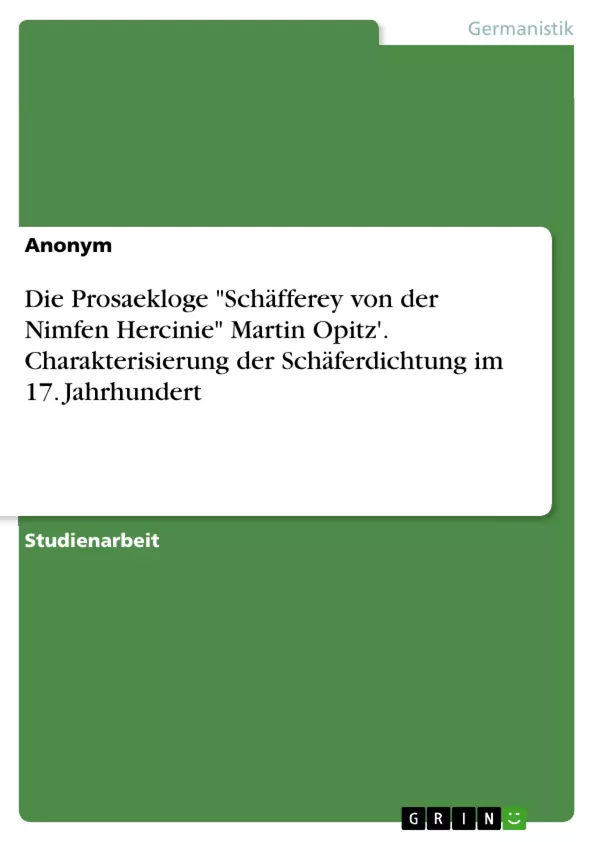Das bedeutendste Werk der europäischen Schäferdichtung des 17. Jahrhundert stellt die "Schäfferey von der Hercine" Martin Opitz‘ aus dem Jahre 1629 dar. Eine vergleichbare Hirtendichtung in der kunstvollen Mischform aus Prosa und Vers habe zuvor nicht existiert. Die vorliegende Hausarbeit widmet sich der Charakterisierung der europäischen weltlichen Schäferdichtung im 17. Jahrhundert. Das Ziel der Arbeit besteht in einer gattungstheoretischen Untersuchung Opitz‘ erster Prosaekloge.
Im Fokus der Betrachtung steht hierbei das die Gattung der Prosaekloge begründende Werk Schäfferey von der Hercine. Dabei werden die drei grundlegenden Merkmale der Schäferdichtung – Biographismus, Feuilletonismus und Panegyrik – an Textauszügen nachgewiesen und erklärt. Obwohl es sich bei der Prosaekloge um eine Gattung handelt, für die keine Tradition existiert, lassen sich verschiedene inhaltliche Parallelen zur antiken Schäferdichtung auffinden. Um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Gattungen aufzufinden, zeichnet der erste Teil der Arbeit zunächst die theoretischen Grundzüge der Ursprünge und der Entwicklung der Schäferdichtung nach. Bevor der Schwerpunkt der Arbeit im Gliederungspunkt 4 behandelt wird, wird der Inhalt der Hercine skizziert. Die abschließende Schlussbetrachtung rekapituliert die gesammelten Ergebnisse.
Die Wurzeln der literarischen Gattung der Schäferdichtung reichen bis ins antike Griechenland zurück und bildeten bis in das 18. Jahrhundert einen wichtigen Bestandteil der europäischen Literatur. Scalger stellte dar, dass es am wahrscheinlichsten sei, den Ursprung der Schäferdichtung als älteste Dichtform in der ältesten Lebensform des Menschen zu verorten: im Hirtentum. Während Hirten ihr Leben in Zufrieden- und Gelassenheit an einem Ort der Schönheit inmitten der Natur verbrachten, um ihrer Arbeit hingebungsvoll nachzugehen, seien sie durch die Geräusche der Natur dazu inspiriert worden, sie in musikalischer Form nachzuahmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundzüge der Hirtendichtung
- Eidyllion und Ekloge: antike Urspünge der Hirtendichtung
- Die Hirtendichtung des 17. Jahrhunderts
- Inhaltsbeschreibung der „Schäfferey von der Nimfen Hercinie“
- Eine gattungstheoretische Untersuchung der „Schäfferey von der Nimfen Hercinie“
- Autobiographische Elemente
- Feuilletonistische Elemente
- Panegyrische Elemente
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit widmet sich der Charakterisierung der europäischen weltlichen Schäferdichtung im 17. Jahrhundert. Im Fokus der Betrachtung steht das die Gattung der Prosaekloge begründende Werk Schäfferey von der Hercine. Das Ziel der Arbeit besteht in einer gattungstheoretischen Untersuchung Opitz’ erster Prosaekloge. Dabei werden die drei grundlegenden Merkmale der Schäferdichtung – Biographismus, Feuilletonismus und Panegyrik – an Textauszügen nachgewiesen und erklärt.
- Theoretische Grundzüge der Hirtendichtung
- Inhaltsbeschreibung der „Schäfferey von der Nimfen Hercinie“
- Gattungstheoretische Untersuchung der „Schäfferey von der Nimfen Hercinie“
- Analyse der drei grundlegenden Merkmale der Schäferdichtung (Biographismus, Feuilletonismus und Panegyrik)
- Vergleich der Schäferdichtung des 17. Jahrhunderts mit ihren antiken Ursprüngen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Ursprünge der literarischen Gattung der Schäferdichtung in der Antike und beschreibt die Entwicklung der Hirtendichtung im 17. Jahrhundert. Dabei werden die Werke Theokrits und Vergils als wichtige Vorläufer der europäischen Schäferdichtung des 17. Jahrhunderts vorgestellt.
Der zweite Teil der Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundzüge der Hirtendichtung. Es werden die Ursprünge der Schäferdichtung bei den griechischen Dichtern Theokrit und Vergil sowie deren Werke Eidyllion und Ekloge im Detail betrachtet. Dabei wird der Einfluss der antiken Komödie mimus und die Entwicklung der Schäferdichtung von einer gebundenen Versform hin zu einer freieren Form dargestellt.
Im dritten Kapitel wird die „Schäfferey von der Nimfen Hercinie“ von Martin Opitz' inhaltlich beschrieben. Es werden die zentralen Themen und die Struktur des Werkes dargestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich der gattungstheoretischen Untersuchung der „Schäfferey von der Nimfen Hercinie“. Es werden die drei grundlegenden Merkmale der Schäferdichtung – Biographismus, Feuilletonismus und Panegyrik – an Textauszügen nachgewiesen und erklärt.
Schlüsselwörter
Schäferdichtung, Hirtendichtung, Prosaekloge, Martin Opitz, Schäfferey von der Nimfen Hercinie, Eidyllion, Ekloge, Biographismus, Feuilletonismus, Panegyrik, antike Literatur, Theokrit, Vergil
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Die Prosaekloge "Schäfferey von der Nimfen Hercinie" Martin Opitz'. Charakterisierung der Schäferdichtung im 17. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1333283