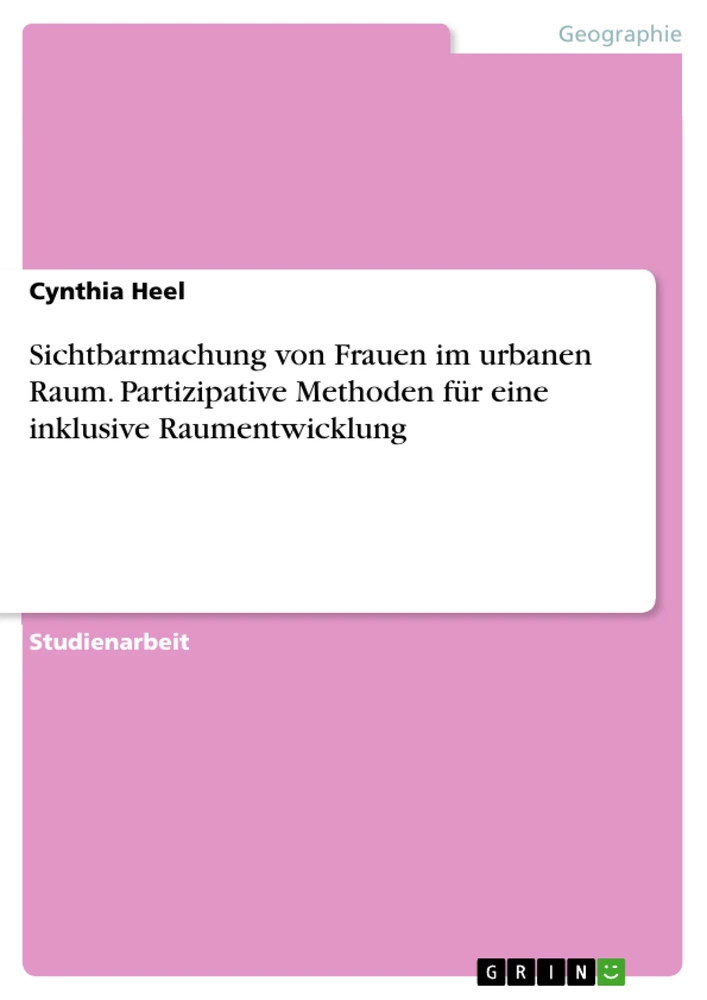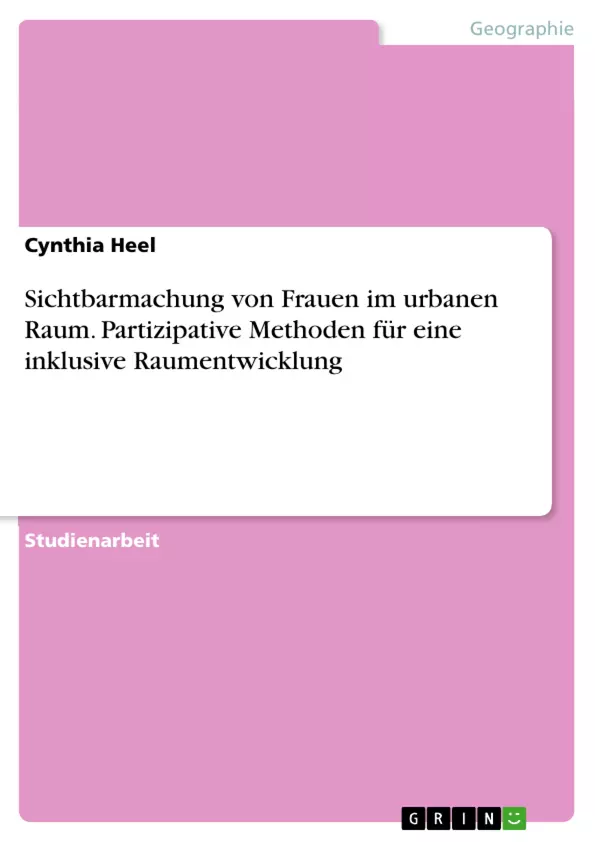Die Arbeit konzentriert sich speziell auf die Gruppe der Frauen im Kontext der Raum- und Stadtplanung. Zentrale Frage dieser Arbeit ist, inwiefern sich Frauen in den Prozess einer geschlechtergerechteren Stadtplanung durch partizipative Methoden einbringen können. Raumplanung muss einerseits die geschlechtsbezogenen Stereotype und Vorurteile im Planungsprozess dekonstruieren und andererseits neue Handlungsräume für das Gestalten von Räumen eröffnen.
Der öffentliche Raum ist ein wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Im besten Fall sollte dieser frei zugänglich sein und eine Teilhabe für verschiedenste Nutzer*innengruppen ermöglichen. Der öffentliche Raum dient dem Austausch, der Mobilität, dem Konsum, der Interessensbekundung, aber auch dem Ausgleich und der Erholung. Auf den Prozess der Bildung und der Ausführung für die Gestaltung des öffentlichen Raumes wirken jedoch Machtverhältnisse. Diese Einwirkungen führen dazu, dass der öffentliche Raum nicht gleichermaßen für alle Nutzer*innengruppen zugänglich ist, da bestimmte infrastrukturelle Faktoren dazu führen, dass bestimmte Räume nur für eine bestimmte homogene Gruppe nutzbar sind. Der Grund für diese Defizite ist in vielen Fällen eine nicht adäquate Diversität unter Planenden und die Teilhabe der tatsächlichen Nutzer*innen in den Planungsprozessen.
Aus diesem Grund benötigt es eine diversitäts- und geschlechtersensible Gestaltung des öffentlichen Raumes, bei welcher die spezifischen Interessen und Bedürfnisse der Nutzer*innen sichtbar gemacht werden. Die Bedürfnisse von vulnerablen und belasteten Nutzer*innengruppen blieben in diesem Kontext lange Zeit unsichtbar, aber sind für eine zukunftsorientierte Stadtplanung besonders von Bedeutung. In den späten 1970er Jahren begann eine feministische Auseinandersetzung mit Städten und der Art, wie diese geplant wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Raumentwicklung und Gender-Perspektiven
- 2.1. Gender und Geschlecht
- 2.2. Wer darf sich welche Räume wie erschließen?
- 2.3. Gender Planning: Eine gendersensible Stadtplanung
- 3. Col·lectiu Punt 6: Nutzer*innen als Expert*innen der eigenen Alltagswelt
- 3.1. Urban Diagnosis in Carrillo, Buenos Aires, Argentinien
- 3.2. Urban Transformation in Poble Sec, Barcelona, Spanien
- 3.3. Grenzen der Inklusivität und der Implementierung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Frauen in der Stadtplanung und die Bedeutung partizipativer Methoden für eine inklusive Raumentwicklung. Ziel ist es, die Frage zu beleuchten, inwiefern Frauen sich durch partizipative Methoden in den Prozess einer geschlechtergerechteren Stadtplanung einbringen können.
- Die Differenzierung der Begriffe „Geschlecht“ und „Gender“
- Die Auswirkungen des sozialen Geschlechts auf die Nutzung des öffentlichen Raums
- Gender Planning als Strategie für eine gendersensible Stadtplanung
- Das Beispiel des Kollektivs Col·lectiu Punt 6 und die Einbeziehung von Frauen in Raumbildungsprozesse
- Grenzen und Problematiken der Inklusivität partizipativer Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung des öffentlichen Raums in einer demokratischen Gesellschaft und die Herausforderungen, die sich aus Machtverhältnissen in Bezug auf die Gestaltung des Raumes ergeben. Es werden die Defizite einer nicht adäquaten Diversität unter Planenden und die Notwendigkeit einer diversitäts- und geschlechtersensiblen Raumplanung hervorgehoben. Das Kapitel stellt die zentrale Frage der Arbeit: inwiefern können sich Frauen durch partizipative Methoden in den Prozess einer geschlechtergerechteren Stadtplanung einbringen?
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Differenzierung der Begriffe „Geschlecht“ und „Gender“. Es wird die Bedeutung des sozialen und performativen Charakters von „Geschlecht“ und die Auswirkungen des sozialen Geschlechts auf die Nutzung des öffentlichen Raums erläutert. Anschließend wird der Begriff Gender Mainstreaming in der Stadtplanung, oder auch Gender Planning, vorgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert das Beispiel des Kollektivs Col·lectiu Punt 6, einer feministischen Organisation aus Barcelona, die sich für die Einbeziehung von Frauen in Raumbildungsprozesse einsetzt. Es werden zwei Projekte des Kollektivs vorgestellt: eine Urban Diagnosis in Carrillo, Buenos Aires, Argentinien und die Urban Transformation in Poble Sec, Barcelona, Spanien. Abschließend werden Grenzen und Problematiken der Inklusivität der vorgestellten partizipativen Methoden diskutiert.
Schlüsselwörter
Gender, Stadtplanung, partizipative Methoden, inklusive Raumentwicklung, Frauen, Col·lectiu Punt 6, Urban Diagnosis, Urban Transformation, Inklusivität, Geschlechtergerechtigkeit, Machtverhältnisse, öffentlicher Raum
- Quote paper
- Cynthia Heel (Author), 2022, Sichtbarmachung von Frauen im urbanen Raum. Partizipative Methoden für eine inklusive Raumentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1330887