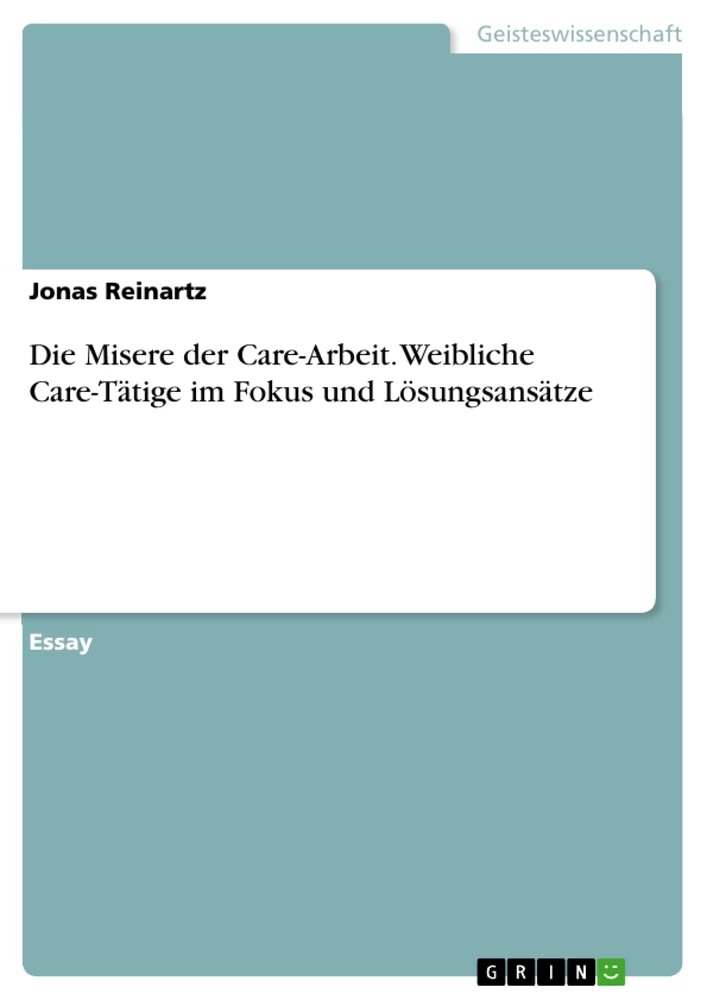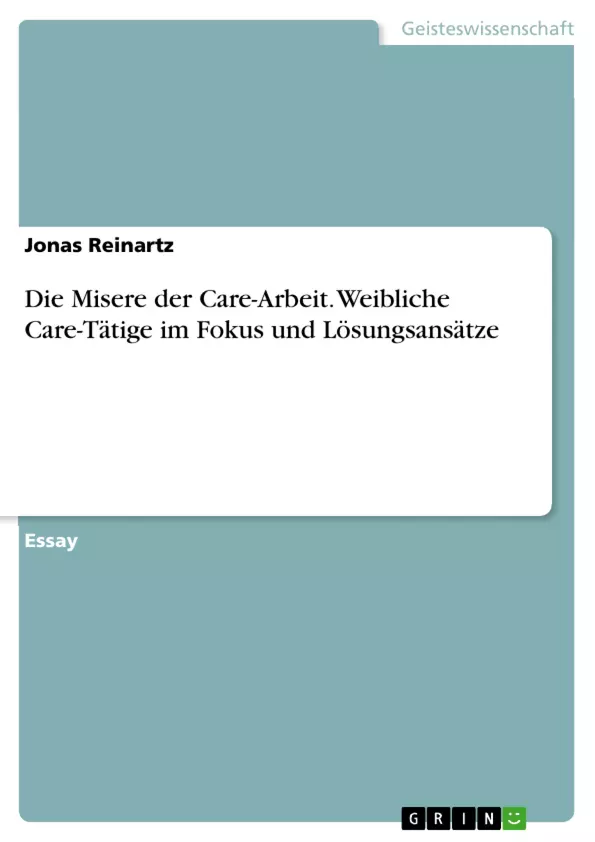Wer kümmert sich um die Kümmerer*innen? Welche gesellschaftlichen Strukturen werden Menschen, die Sorgearbeit leisten, entgegengebracht? Dieser Beitrag soll darstellen, warum sich Care-Tätige oft in prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen wiederfinden. Gleichzeitig soll dargeboten werden, wie ein Ausweg aus dieser Misere gelingen kann. Dazu muss zunächst der Ist-Zustand der Sorgearbeit in Deutschland aufgearbeitet werden. Im Fokus der Stellungnahme stehen hierbei zum Einen weibliche Care-Tätige, die unentlohnt in Familienkonstellationen caretätig sind, zum Anderen entlohnt innerhalb einer prekären Arbeiter*innenklasse angestellt sind. Schließlich wird ein Lösungsansatz versucht, der den Blick auf eine mögliche politische Transformation der gegebenen Strukturen hin zu einer solidarischen Umsetzung der modernen Care-Arbeit richtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Care-Arbeit
- Der Ist-Zustand der Sorgearbeit in Deutschland
- Care-Arbeit und die Leistungsgesellschaft
- Care-Arbeit in der Corona-Pandemie
- Ausweg aus der Misere: Eine solidarische Umsetzung von Care-Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag analysiert die prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen von Care-Arbeitenden in Deutschland und sucht nach Lösungsansätzen für eine solidarische Umsetzung von Care-Arbeit. Im Fokus stehen dabei sowohl unbezahlte Care-Arbeit in Familien als auch entlohnte Care-Arbeit in prekären Beschäftigungsverhältnissen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Care-Arbeit“
- Analyse des Ist-Zustandes der Sorgearbeit in Deutschland, insbesondere die Situation von Frauen
- Der Zusammenhang zwischen Care-Arbeit und den Klassenstrukturen der Leistungsgesellschaft
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Care-Arbeitende
- Möglichkeiten einer politischen Transformation hin zu einer solidarischen Umsetzung von Care-Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Beitrag beginnt mit einem Zitat von Michael Jackson, das die Problematik der Care-Arbeit aufzeigt: Wer kümmert sich um die Kümmerer*innen? Es wird die zentrale These aufgestellt, dass Care-Arbeitende oft in prekären Bedingungen arbeiten und der Beitrag soll sowohl den Ist-Zustand als auch mögliche Auswege aus dieser Misere beleuchten. Der Fokus liegt auf unbezahlter Care-Arbeit von Frauen in Familien und entlohnter Care-Arbeit in prekären Beschäftigungsverhältnissen.
Definition von Care-Arbeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Care-Arbeit“ nach Klische*esc e.V. als die Gesamtheit der bezahlten und unbezahlten reproduktiven Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns, Fürsorge und Selbstsorge. Es umfasst das alltägliche Kümmern und Versorgen sowie den „Mental Load“. Care-Arbeit beinhaltet nicht nur körpernahe Tätigkeiten, sondern auch die Instandhaltung der Lebensumgebung und Nahrungsaufbereitung. Es wird hervorgehoben, dass diese Arbeit oft unbezahlt von Frauen in Familien übernommen wird.
Der Ist-Zustand der Sorgearbeit in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext, in dem sich staatliche Regelungen und Institutionen lange am Leitbild des „Familienernährers“ orientierten. Die traditionelle Arbeitsteilung in heteronormativen Kernfamilien wird analysiert, bei der der Mann für den finanziellen Unterhalt und die Frau für die Kindererziehung und den Haushalt zuständig war. Die Veränderung dieses Modells durch das steigende Bildungsniveau von Frauen wird beleuchtet, wobei betont wird, dass dies oft nur eine Variation des ursprünglichen Modells darstellt. Die daraus resultierenden Risiken für Frauen im Hinblick auf Aufstiegschancen, Einkommen und Renten werden erläutert.
Care-Arbeit und die Leistungsgesellschaft: Dieses Kapitel diskutiert den soziologischen Erklärungsansatz von Oliver Nachtwey, der den Klassenunterschied in der Leistungsgesellschaft und die Rolle „verkannter Leistungsträger*innen“ im Dienstleistungssektor analysiert. Es wird argumentiert, dass die unbemerkte Arbeiter*innenklasse im Dienstleistungssektor, die einen Großteil der entlohnten Care-Arbeit verrichtet, aufgrund eines neoliberalen Credos und eines meritokratischen Narrativs eine fehlende Leistungsbereitschaft zugeschrieben bekommt. Dies führt zu despektierlichen Attributen und verkennt den Nutzen von Care-Arbeit für die Aufrechterhaltung sozialer Systeme.
Care-Arbeit in der Corona-Pandemie: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel, der sich während der Corona-Pandemie zeigte. Care-Beschäftigte wurden als „Alltagsheld*innen“ wahrgenommen und als „systemrelevant“ eingestuft. Es wird jedoch betont, dass diese Anerkennung nicht zu einer Verbesserung der prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen geführt hat. Vielmehr wurden die bestehenden Klassenunterschiede während der Pandemie sichtbar und verfestigt. Beispiele wie Infektionsrisiko, Lohnverlust und familiäre Verwerfungen verdeutlichen die Verschärfung der Probleme für diese Gruppe.
Schlüsselwörter
Care-Arbeit, Sorgearbeit, prekär, Leistungsgesellschaft, Feminismus, soziale Ungleichheit, Corona-Pandemie, politische Transformation, solidarische Umsetzung, Gender, Klassenunterschiede.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen von Care-Arbeitenden in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Die Analyse untersucht die prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen von Care-Arbeitenden in Deutschland, sowohl in unbezahlten (familiären) als auch in bezahlten (prekären Beschäftigungsverhältnissen) Bereichen. Sie sucht nach Lösungsansätzen für eine solidarische Umsetzung von Care-Arbeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse umfasst die Definition von Care-Arbeit, eine Bestandsaufnahme der Situation in Deutschland (insbesondere die Situation von Frauen), den Zusammenhang zwischen Care-Arbeit und Klassenstrukturen der Leistungsgesellschaft, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Möglichkeiten einer politischen Transformation hin zu einer solidarischen Umsetzung von Care-Arbeit.
Wie wird Care-Arbeit definiert?
Care-Arbeit wird als die Gesamtheit der bezahlten und unbezahlten reproduktiven Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns, Fürsorge und Selbstsorge definiert. Dies beinhaltet das alltägliche Kümmern und Versorgen, den „Mental Load“, die Instandhaltung der Lebensumgebung und Nahrungsaufbereitung.
Wie wird der Ist-Zustand der Sorgearbeit in Deutschland beschrieben?
Der Ist-Zustand wird im Kontext der traditionellen Arbeitsteilung in heteronormativen Kernfamilien dargestellt, wobei der Mann für den finanziellen Unterhalt und die Frau für Kindererziehung und Haushalt zuständig war. Die Analyse beleuchtet die Veränderungen durch das steigende Bildungsniveau von Frauen und die damit verbundenen Risiken für Frauen bezüglich Aufstiegschancen, Einkommen und Renten.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Care-Arbeit und der Leistungsgesellschaft?
Die Analyse diskutiert den soziologischen Ansatz von Oliver Nachtwey, der den Klassenunterschied in der Leistungsgesellschaft und die Rolle „verkannter Leistungsträger*innen“ im Dienstleistungssektor analysiert. Es wird argumentiert, dass unbemerkte Arbeiter*innen im Dienstleistungssektor, die einen Großteil der entlohnten Care-Arbeit leisten, aufgrund neoliberaler Ideologien und meritokratischer Narrative eine fehlende Leistungsbereitschaft zugeschrieben bekommen, was den Nutzen von Care-Arbeit für soziale Systeme verkennt.
Wie hat die Corona-Pandemie die Situation von Care-Arbeitenden beeinflusst?
Die Corona-Pandemie hat Care-Beschäftigte zwar als „Alltagsheld*innen“ und „systemrelevant“ sichtbar gemacht, jedoch keine Verbesserung der prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen gebracht. Im Gegenteil: Bestehende Klassenunterschiede wurden verstärkt, mit Problemen wie Infektionsrisiko, Lohnverlust und familiären Verwerfungen.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Analyse plädiert für eine politische Transformation hin zu einer solidarischen Umsetzung von Care-Arbeit. Konkrete Maßnahmen werden nicht detailliert genannt, aber der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer Veränderung, um die prekären Bedingungen von Care-Arbeitenden zu verbessern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Care-Arbeit, Sorgearbeit, prekär, Leistungsgesellschaft, Feminismus, soziale Ungleichheit, Corona-Pandemie, politische Transformation, solidarische Umsetzung, Gender, Klassenunterschiede.
- Arbeit zitieren
- Jonas Reinartz (Autor:in), 2023, Die Misere der Care-Arbeit. Weibliche Care-Tätige im Fokus und Lösungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1330138