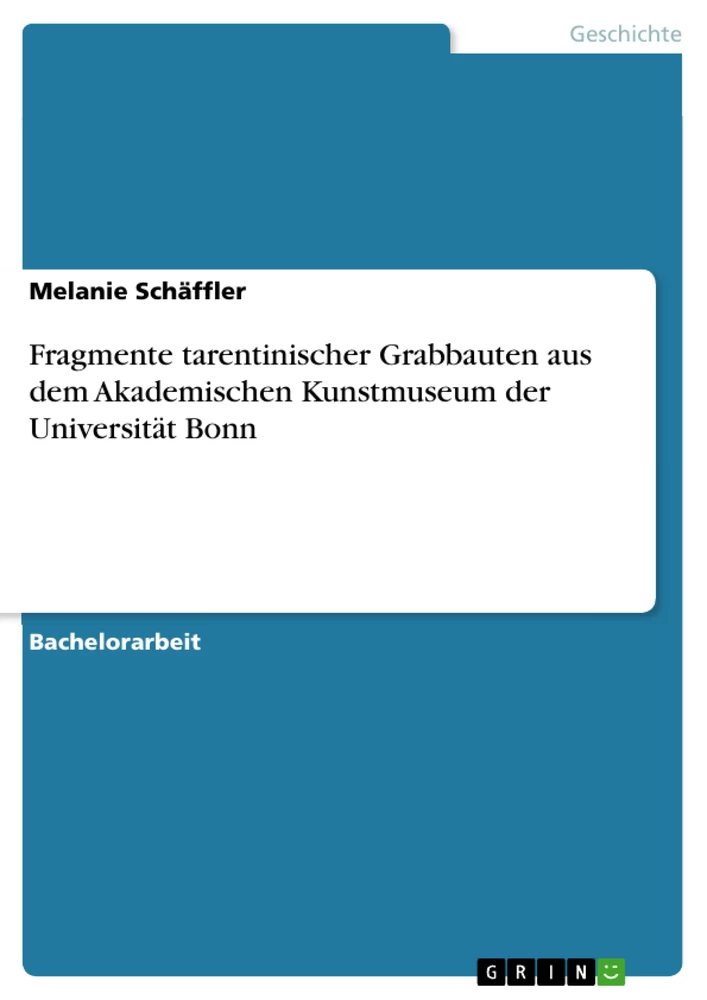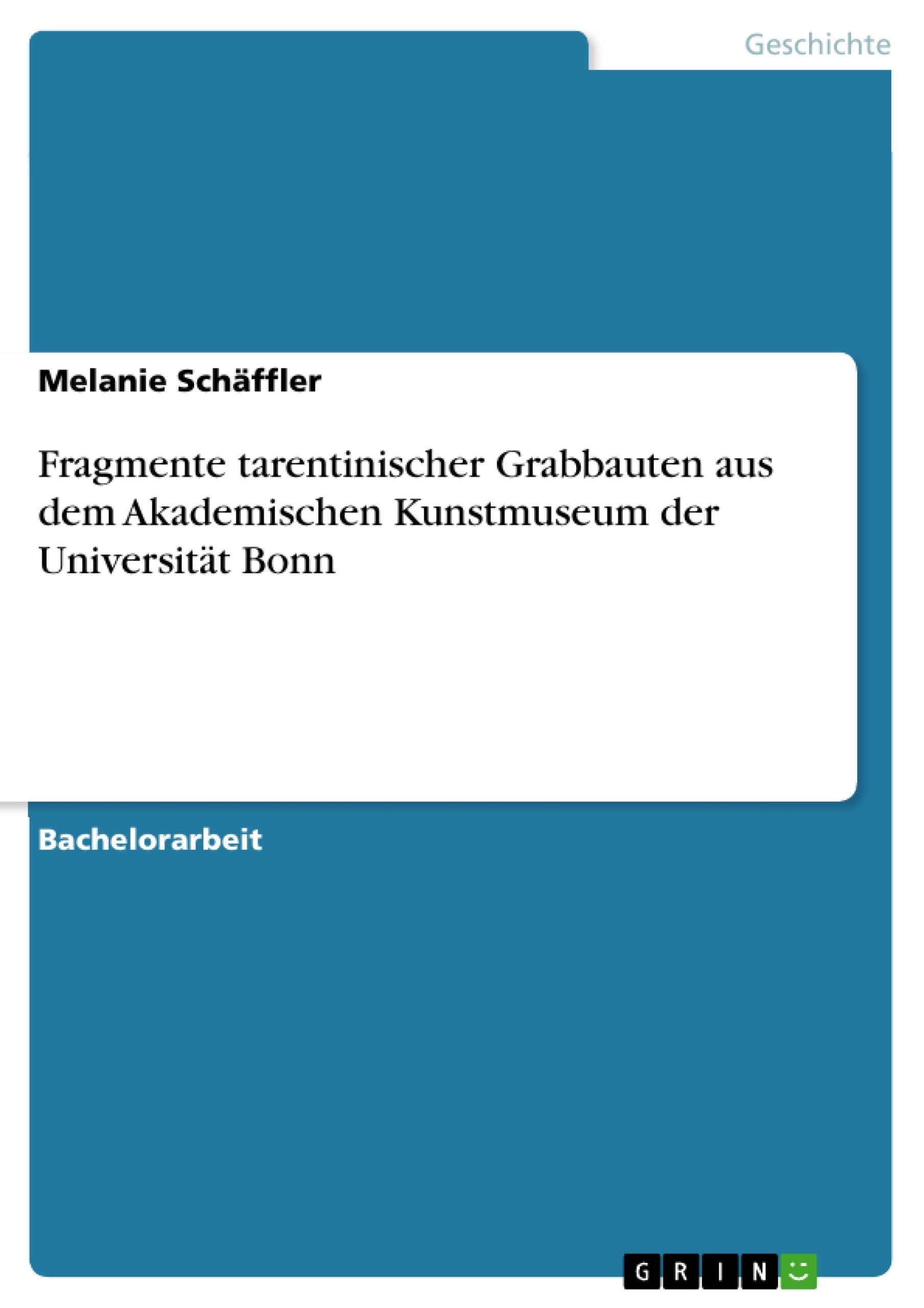Das Akademische Kunstmuseum zählt zu den ältesten Museen in Bonn und fungiert als Antikensammlung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Rund 2400 Gipsabgüsse von Statuen, Reliefs und Kleinkunst sowie eine Originalsammlung von antiken Werken aus Marmor, Ton, Bronze und Glas befinden sich in dem seit 1818 bestehenden Museum.
Diese Untersuchung hat zum Ziel, die bisher zusammenhangslosen Fragmente der tarentinischen Grabbauten im Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn in einen Kontext einzubetten. Ikonographische Besonderheiten sollen dabei herausgearbeitet werden, indem ähnliche Darstellungsformen und Fragmente anderer Sammlungen zum Vergleich herangezogen werden. Außerdem werden die verschiedenen Einflüsse auf unteritalische Kunst und Grabdekoration betrachtet. Hierbei soll der Einfluss attischer Tragödien des 5. Jhs. v. Chr. auf die unteritalische Vasenmalerei und somit die Tradition der unteritalischen Darstellungsformen betrachtet werden. Im Anschluss daran wird eine Verbindung der griechischen Mythen zur Ikonographie der römischen Sarkophage des 2. Jhs. n. Chr. geprüft. Der darauffolgende Teil der Arbeit widmet sich der Einordnung der Objekte in einen Fundkontext. Der Fokus liegt hier auf den tarentinischen Grabbauten selbst, deren Forschungsgeschichte sowie deren historischer Kontext. Dabei werden die Verbreitung und eine mögliche Rekonstruktion herausgearbeitet. Zusätzlich wird ein Blick auf die unteritalischen Vasen geworfen, welche die Abbildungen verschiedener Naiskoi tragen. Es wird ebenfalls auf die Bedeutung der Naiskoi eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fragmente tarentinischer Grabbauten aus dem Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn
- 2.1. Fragmente tarentinischer Grabbauten aus dem Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn
- 3. Untersuchung ausgewählter ikonographischer Aspekte
- 3.1. Ikonographisches Spektrum
- 3.1.1. Vergleiche zur Nereidenfigur
- 3.1.2. Mänadendarstellungen
- 3.1.3. Der Typus der Niobidenfigur
- 3.1.4. Vergleichbare Medeadarstellungen
- 3.1.5. Die Ikonographie des Pädagogen
- 3.2. Der Einfluss attischer Tragödien auf die unteritalische Vasenmalerei
- 3.2.1. Darstellungen der Medea auf unteritalischen Vasen
- 3.2.2. Pädagogen in der unteritalischen Vasenmalerei
- 3.3. Zusammenfassung
- 4. Tarentinische Grabbauten
- 4.1. Topographie Tarents
- 4.2. Forschungsgeschichte zu Tarent und den Grabbauten
- 4.3. Historischer Kontext zur Nekropole von Tarent
- 4.4. Die Form der Naiskoi
- 4.4.1. Naiskoi auf Vasen
- 4.4.2. Bedeutung der Naiskoi
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Fragmente tarentinischer Grabbauten im Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn in einen Kontext zu setzen. Ikonographische Besonderheiten sollen herausgearbeitet und mit ähnlichen Darstellungsformen sowie Fragmenten anderer Sammlungen verglichen werden. Die Arbeit untersucht außerdem die verschiedenen Einflüsse auf unteritalische Kunst und Grabdekoration, insbesondere den Einfluss attischer Tragödien des 5. Jhs. v. Chr. auf die unteritalische Vasenmalerei. Die Einordnung der Objekte in einen Fundkontext, insbesondere der tarentinischen Grabbauten, deren Forschungsgeschichte und deren historischer Kontext, werden ebenfalls beleuchtet.
- Ikonographische Analyse der Fragmente
- Einfluss attischer Tragödien auf die unteritalische Vasenmalerei
- Einordnung der Objekte in einen Fundkontext
- Forschungsgeschichte und historischer Kontext der tarentinischen Grabbauten
- Bedeutung der Naiskoi
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt das Akademische Kunstmuseum in Bonn und seine Antikensammlung vor. Sie beschreibt die Entstehung des Museums und die Geschichte seiner Sammlungen, einschließlich der Schenkungen, die zur Entstehung der Arbeit führten.
- Kapitel 2: Fragmente tarentinischer Grabbauten aus dem Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn: Dieses Kapitel befasst sich mit der Beschreibung der einzelnen Objekte aus der Sammlung des Museums. Es werden die Materialien, die Gestaltung und die möglichen Deutungen der Fragmente diskutiert.
- Kapitel 3: Untersuchung ausgewählter ikonographischer Aspekte: Dieses Kapitel analysiert die ikonographischen Besonderheiten der Objekte. Es untersucht verschiedene Darstellungsformen, vergleicht sie mit anderen Sammlungen und erörtert den Einfluss attischer Tragödien auf die unteritalische Vasenmalerei.
- Kapitel 4: Tarentinische Grabbauten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einordnung der Objekte in einen Fundkontext. Es geht auf die Topographie Tarents, die Forschungsgeschichte der tarentinischen Grabbauten und deren historischen Kontext ein. Außerdem werden die Verbreitung und eine mögliche Rekonstruktion der Grabbauten herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf tarentinische Grabbauten, ikonographische Analyse, Einfluss attischer Tragödien, unteritalische Vasenmalerei, Naiskoi, Forschungsgeschichte und den historischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was sind tarentinische Grabbauten?
Es handelt sich um antike Grabmonumente aus Tarent (Unteritalien), die oft reich mit Reliefs und Skulpturen verziert waren.
Welche Rolle spielt das Akademische Kunstmuseum Bonn in dieser Arbeit?
Das Museum beherbergt Fragmente dieser Grabbauten, die in dieser Untersuchung erstmals wissenschaftlich in einen Gesamtzusammenhang eingeordnet werden.
Welchen Einfluss hatten attische Tragödien auf diese Kunst?
Szenen aus griechischen Tragödien des 5. Jhs. v. Chr. beeinflussten die unteritalische Vasenmalerei und damit auch die ikonographischen Motive der Grabdekorationen.
Was ist ein „Naiskos“?
Ein Naiskos ist ein kleiner tempelartiger Bau, der oft als Grabmonument diente und auf unteritalischen Vasen häufig abgebildet wurde.
Welche mythologischen Figuren werden in den Fragmenten untersucht?
Die Arbeit analysiert unter anderem Darstellungen von Medea, Niobiden, Mänaden und Nereiden sowie den Typus des Pädagogen.
- Arbeit zitieren
- Melanie Schäffler (Autor:in), 2020, Fragmente tarentinischer Grabbauten aus dem Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1330087