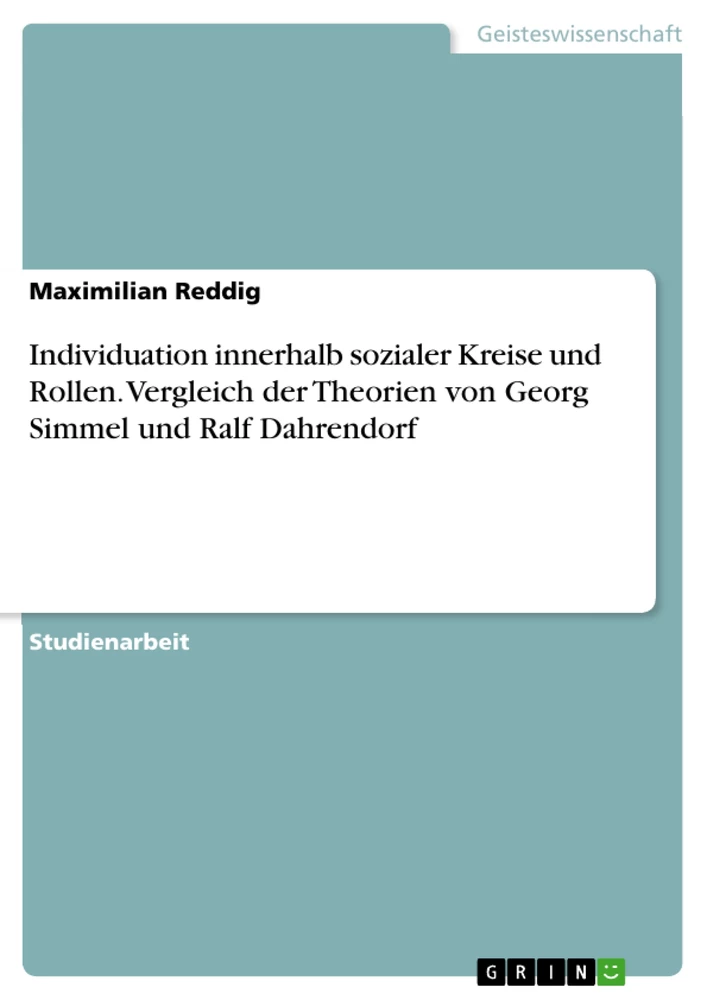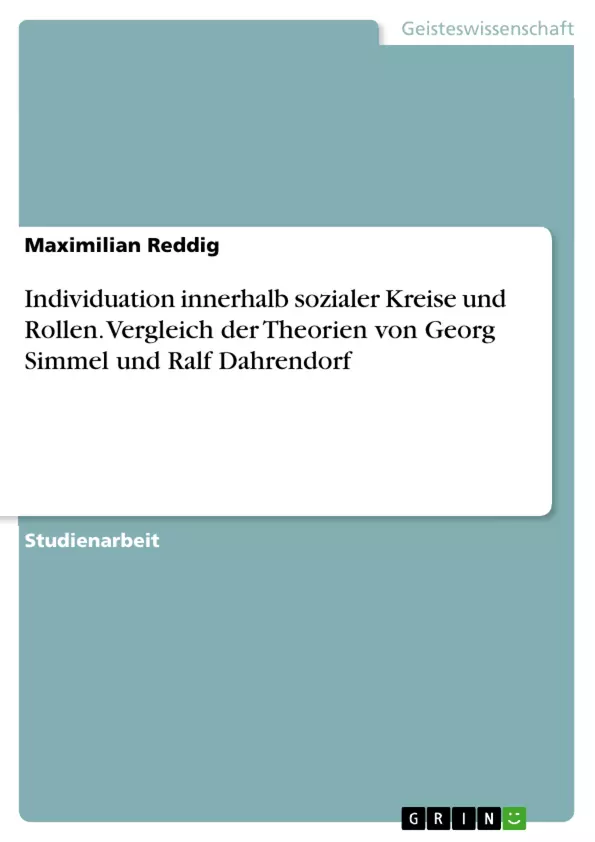In den soziologischen Rollentheorien wird dem Individuum ausschließlich eine stark eingeschränkte Individuation unterstellt. Die Rollentheorien in der Soziologie bedienen sich oft einer ähnlichen Terminologie und haben viele grundsätzliche Übereinstimmungen, dabei werden häufig die vorherigen Ergebnisse aus anderen Theorien übernommen und modifiziert. Eine renommierte und beliebte Rollentheorie ist die von dem deutschen Soziologen Ralf Dahrendorf, veröffentlicht im Jahre 1958, unter dem Namen "Homo Sociologicus".
Bei Dahrendorfs Rollentheorie ist jedes Individuum ein/e Träger/in von mehreren sozialen Positionen, die mit sozialen Rollen verknüpft sind, welche unsere Individuation einschränken. Soziale Positionen sind einzelne und vom Individuum unabhängige Positionen, die einen gesellschaftlichen Kontext beinhalten. Die soziale Position ist sozial, da erst durch sie, der/die Träger:in in einem sozialen Kontext steht oder anders ausgedrückt, Teil der Gesellschaft wird. Dabei steht jede soziale Position in einem direkten Kontakt zu anderen Positionssegmenten. Die sozialen Positionen sind mit den Positionssegmenten verbunden, welche das gesellschaftliche Beziehungsfeld der Position offenbaren. Ein Beispiel wäre die Position "Filialarbeiter:in", die Positionssegmente wären dann "Filialmitarbeiter:innen", "Filialkundinnen und Filialkunden", Filialleiter:in etc. Alle Positionssegmente stehen in einer zwangsläufigen Interaktion mit der sozialen Position. Die soziale Position ist dabei das übergeordnete Element, welches wie in einem von sich ausgehenden Netz mit den Positionssegmenten verbunden ist.
Dabei ist die soziale Position durch ihre direkte Interaktion innerhalb der Gesellschaft Teil dieser. Damit die Interaktionen innerhalb der Positionssegmente und der Position intakt bleiben, werden den sozialen Positionen, soziale Rollen auferlegt. Soziale Rollen sind von der Gesellschaft auferlegte Erwartungen an die jeweilige Position. Sie sind essentiell für das gesellschaftliche Zusammenleben, da durch diese Erwartungsreduktion innerhalb der Gesellschaft, die mannigfaltige Handlungsmöglichkeiten bietet, erzeugt wird. Von einem/einer Polizist:in wird erwartet, das Gesetz zu verteidigen, Straftäter:innen festzunehmen, hilfsbereit und nicht korrupt zu sein. Bei einem Bruch der Erwartungen folgen Sanktionen, dabei ist die Gesellschaft die ausführende Instanz, welche die Einhaltung der Erwartungen beobachtet und die Sanktionen durchführt.
Sanktionen können auf rechtlicher Ebene (diese Ebene wird auch von der Gesellschaft beeinflusst) oder auf sozialer Ebene erfolgen. Auf sozialer Ebene werden Erwartungsbrüche mit Empörung und Abneigung seitens der anderen Mitmenschen begegnet, was zur Ausschließung oder gezielten Desintegration des Individuums führen kann. Somit hat auch das Individuum ein grundsätzliches Interesse, die Rollenerwartungen einzuhalten.
Die Rollenerwartungen widersprechen jedoch oft den persönlichen Wünschen des Individuums, was zu einem inneren Konflikt führt. Zwischen auserwählten Positionen gibt es auch zugeschriebene Positionen, die vorbestimmt sind, wie zum Beispiel das Geschlecht oder das Alter. Besonders die zugeschriebenen Positionen stehen häufig in einem Spannungsverhältnis, zu den persönlichen Wünschen oder anderen Positionen, weil zugeschriebene Rollen in der Regeln nicht verändert werden können. Da man im Laufe der Zeit immer mehr Positionen und Rollen einnimmt und diese untereinander konfligieren, nimmt das Konfliktpotenzial stetig zu.
Genau da setzt Dahrendorf an und bezeichnet die Rollenerwartungen als eine "ärgerliche Tatsache", da sie unsere Individuation durch drohende Sanktionen einschränken. Zudem hinterfragt er den Individuierungsprozess im Ganzen, selbst die Rollen die mit unseren persönlichen Wünschen einhergehen, sind für ihn möglicherweise nur Ergebnis, einer Internalisierung der Rollenerwartungen, welche uns die Gesellschaft in einem Sozialisationsprozess auferlegt hat. Soziale Positionen und soziale Rollen lassen das Individuum gesellschaftlich einordnen, es werden seine sozialen Beziehungsfelder, sein sozialer Status und seine sozialen Handlungsmöglichkeiten offenbart. Bei einem Bruch dieser Variablen wird das Individuum sanktioniert, dies führt zu einer eingeschränkten Auslebung der Persönlichkeit oder der Auslebung einer sozialisierten Identität.
Seit Beginn der Soziologie ist die Individuation innerhalb der Gesellschaft ein zentraler Aspekt. Denn im westlichen Ethos steht Freiheit im Mittelpunkt, somit wird von der Gesellschaft eine soziale Umgebung gefordert, die Individuation ermöglicht. Dies soll in einem rechtlichen Rahmen geschehen, damit die Individuationen der Menschen untereinander sich nicht gegenseitig einschränken.
Jener Ethos wird an den entstandenen Rechten für Frauen und Homosexuellen deutlich. Diese waren vorher in der Gesetzgebung nicht gleichgesetzt mit dem heterosexuellen Mann. So ein Wandel entsteht auf einer kulturellen Ebene, indem Gesellschaft diesen Ethos praktiziert und dann in der Gesetzgebung etabliert. Da jener Wertewandel durch die Gesellschaft hervorgebracht wird und dem gesetzlichen Wandel zugrunde liegt, kann man auch davon ausgehen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für Homosexuelle und Frauen größer wurde. Somit sind Homosexuelle und Frauen freier, in ihrer Individuation, auf rechtlicher Ebene. Auf gesellschaftlicher Ebene, sind beide auch freier in ihrer Individuation, da jener Ethos der Moderne, das erlaubt. Daher müsste in der Theorie jedes Individuum frei in seiner Individuation sein. Die Soziologie untersucht eine mögliche Individuation im Zusammenspiel mit der Gesellschaft. Die soziologischen Untersuchungen liefern unterschiedliche Ergebnisse, mit einer negativen Akzentuierung für den individualistischen Ethos.
1. Einleitung
Seit Beginn der Soziologie ist die Individuation innerhalb der Gesellschaft ein zentraler Aspekt. Denn im westlichen Ethos steht Freiheit im Mittelpunkt, somit wird von der Gesellschaft eine soziale Umgebung gefordert, die Individuation ermöglicht. Dies soll in einem rechtlichen Rahmen geschehen, damit die Individuationen der Menschen untereinander sich nicht gegenseitig einschränken.
Jener Ethos wird an den entstandenen Rechten für Frauen und Homosexuellen deutlich. Diese waren vorher in der Gesetzgebung nicht gleichgesetzt mit dem heterosexuellen Mann. So ein Wandel entsteht auf einer kulturellen Ebene, indem Gesellschaft diesen Ethos praktiziert und dann in der Gesetzgebung etabliert. Da jener Wertewandel durch die Gesellschaft hervorgebracht wird und dem gesetzlichen Wandel zugrunde liegt, kann man auch davon ausgehen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für Homosexuelle und Frauen größer wurde. Somit sind Homosexuelle und Frauen freier, in ihrer Individuation, auf rechtlicher Ebene. Auf gesellschaftlicher Ebene, sind beide auch freier in ihrer Individuation, da jener Ethos der Moderne, das erlaubt. Daher müsste in der Theorie jedes Individuum frei in seiner Individuation sein. Die Soziologie untersucht eine mögliche Individuation im Zusammenspiel mit der Gesellschaft. Die soziologischen Untersuchungen liefern unterschiedliche Ergebnisse, mit einer negativen Akzentuierung für den individualistischen Ethos.
Zum Beispiel wird in den soziologischen Rollentheorien dem Individuum ausschließlich eine stark eingeschränkte Individuation unterstellt. Die Rollentheorien in der Soziologie bedienen sich oft einer ähnlichen Terminologie und haben viele grundsätzliche Übereinstimmungen, dabei werden häufig die vorherigen Ergebnisse aus anderen Theorien übernommen und modifiziert. Eine renommierte und beliebte Rollentheorie ist die von dem deutschen Soziologen Ralf Dahrendorf, veröffentlicht im Jahre 1958, unter dem Namen „Homo Sociologicus” (vgl. Kocka 2009: 346).
Bei Dahrendorfs Rollentheorie ist jedes Individuum ein/e Träger/in von mehreren sozialen Positionen, die mit sozialen Rollen verknüpft sind, welche unsere Individuation einschränken (vgl. Dahrendorf 2017:169-173). Soziale Positionen sind einzelne und vom Individuum unabhängige Positionen, die einen gesellschaftlichen Kontext beinhalten (vgl. ebd.: 171 f.). Die soziale Position ist sozial, da erst durch sie, der/die Trägerin in einem sozialen Kontext steht oder anders ausgedrückt, Teil der Gesellschaft wird. Dabei steht jede soziale Position in einem direkten Kontakt zu anderen Positionssegmenten (vgl. ebd. 171). Die sozialen Positionen sind mit den Positionssegmenten verbunden, welche das gesellschaftliche Beziehungsfeld der Position offenbaren. Ein Beispiel wäre die Position „Filialarbeiterin”, die Positionssegmente wären dann „Filialmitarbeiterinnen”, „Filialkundinnen und Filialkunden ”, Filialleiter:in etc. Alle Positionssegmente stehen in einer zwangsläufigen Interaktion mit der sozialen Position. Die soziale Position ist dabei das übergeordnete Element, welches wie in einem von sich ausgehenden Netz mit den Positionssegmenten verbunden ist.
Dabei ist die soziale Position durch ihre direkte Interaktion innerhalb der Gesellschaft Teil dieser. Damit die Interaktionen innerhalb der Positionssegmente und der Position intakt bleiben, werden den sozialen Positionen, soziale Rollen auferlegt (vgl. ebd. 173).
1.1 Problematik der sozialen Rollen nach Dahrendorf
Soziale Rollen sind von der Gesellschaft auferlegte Erwartungen an die jeweilige Position. Sie sind essentiell für das gesellschaftliche Zusammenleben, da durch diese Erwartungsreduktion innerhalb der Gesellschaft, die mannigfaltige Handlungsmöglichkeiten bietet, erzeugt wird. Von einem/einer Polizist:in wird erwartet, das Gesetz zu verteidigen, Straftäterinnen festzunehmen, hilfsbereit und nicht korrupt zu sein. Bei einem Bruch der Erwartungen folgen Sanktionen, dabei ist die Gesellschaft die ausführende Instanz, welche die Einhaltung der Erwartungen beobachtet und die Sanktionen durchführt (vgl. ebd. 178).
Sanktionen können auf rechtlicher Ebene (diese Ebene wird auch von der Gesellschaft beeinflusst) oder auf sozialer Ebene erfolgen. Auf sozialer Ebene werden Erwartungsbrüche mit Empörung und Abneigung seitens der anderen Mitmenschen begegnet, was zur Ausschließung oder gezielten Desintegration des Individuums führen kann. Somit hat auch das Individuum ein grundsätzliches Interesse, die Rollenerwartungen einzuhalten.
Die Rollenerwartungen widersprechen jedoch oft den persönlichen Wünschen des Individuums, was zu einem inneren Konflikt führt (vgl. ebd. 169-173). Zwischen auserwählten Positionen gibt es auch zugeschriebene Positionen, die vorbestimmt sind, wie zum Beispiel das Geschlecht oder das Alter (vgl. ebd. 187). Besonders die zugeschriebenen Positionen stehen häufig in einem Spannungsverhältnis, zu den persönlichen Wünschen oder anderen Positionen, weil zugeschriebene Rollen in der Regeln nicht verändert werden können. Da man im Laufe der Zeit immer mehr Positionen und Rollen einnimmt und diese untereinander konfligieren, nimmt das Konfliktpotenzial stetig zu.
Genau da setzt Dahrendorf an und bezeichnet die Rollenerwartungen als eine „ärgerliche Tatsache” (ebd. 164), da sie unsere Individuation durch drohende Sanktionen einschränken. Zudem hinterfragt er den Individuierungsprozess im Ganzen, selbst die Rollen die mit unseren persönlichen Wünschen einhergehen, sind für ihn möglicherweise nur Ergebnis, einer Internalisierung der Rollenerwartungen, welche uns die Gesellschaft in einem Sozialisationsprozess auferlegt hat (vgl. ebd. 189 f.).
Soziale Positionen und soziale Rollen lassen das Individuum gesellschaftlich einordnen, es werden seine sozialen Beziehungsfelder, sein sozialer Status und seine sozialen Handlungsmöglichkeiten offenbart. Bei einem Bruch dieser Variablen wird das Individuum sanktioniert, dies führt zu einer eingeschränkten Auslebung der Persönlichkeit oder der Auslebung einer sozialisierten Identität.
1.2 Identitätsbildung nach Simmel
Georg Simmel, geboren im Jahre 1858 in Berlin, ist einer der Vorreiter der Soziologie. Dabei gilt die Philosophie auch als einer seiner Teilgebiete. Simmel hat sich intensiv mit Identitätsbildung und Individuierung beschäftigt, anders als Dahrendorfs Perspektive, ist seine optimistischer, was die Individuierung betrifft.
Für ihn ist der Mensch ein Grenzwesen, welches sich durch das Einhalten, Übertreten und Definieren von Grenzen auszeichnet (vgl. Simmel 1999: 212-215). Diese Grenzen existieren auf einer gesellschaftlichen und individuellen Ebene und genau darin entsteht für Simmel die Erkenntnis und Entfaltung der eigenen Identität, in einem Wechselspiel von Gesellschaft und Individuum. Dies widerspricht vielen soziologischen Rollentheorien, welche die persönliche Grenze ignorieren und die Gesellschaft als alleinige Sozialisationsinstanz ansehen, die eine vollkommene Kontrolle über die Identität der Individuen hat.
Für Simmel besteht die Gesellschaft aus verschiedenen sozialen Kreisen, in denen Interaktionen erfolgen, wie zum Beispiel der Schul-, Familien- und Arbeitskreis (vgl. Simmel 1992b:462-468). Dabei sind, wie bei sozialen Positionen, Erwartungen und Normen an den jeweiligen Kreis geknüpft. Dennoch bietet jeder Kreis einen individuell interpretierbaren Spielraum an, dieser schafft Raum für eine Individuation (vgl. Simmel 1992a: 797). Zudem ist das Auswählen von mehreren verschiedenen Kreisen eine Form von Individuation, da der ausgewählte Komplex an Kreisen auf die persönlichen Individuationswünsche zugeschnitten werden kann (vgl. ebd.: 791-792). Gleichzeitig bietet die Moderne auch mehr Kreise an, die für immer mehr Menschen zugänglich werden (vgl. Simmel 1992b: 464 ff.).
Für Simmel verfällt das Individuum, wegen seiner Anhäufung an Kreisen und ihren freien Spielräumen, nie ganz in seine soziale Rolle, dadurch entsteht ein dynamischer Lebensprozess, indem das Individuum stetig andere Rollen ausprobiert oder die bestehenden Rollen progressieren lässt (vgl. ebd. 456-460). Somit wird die Identität immer neu verformt und dementsprechend anders ausgelebt. Dieser Prozess ermöglicht Individuierung, der mit einer dynamischen Entwicklung der Identität einhergeht.
Simmels Perspektive und Bewertung der sozialen Kreise und Rollen unterscheidet sich zu der von Dahrendorf, dennoch darf Simmels Theorie nicht als ein Äquivalent für Dahrendorfs Theorie angesehen werden, denn Simmel geht ebenfalls, von einer eingeschränkten Individuierung aus, jedoch fokussiert er sich mehr auf einen praktischen Umgang mit den Rollen. Seine Perspektive soll den Blickwinkel für das Thema erweitern, da er noch detaillierter auf den Individuationsprozess, mit persönlicher und gesellschaftlicher Grenze zusammen, eingeht.
Ziel der Arbeit ist es, Möglichkeiten einer Individuation innerhalb der soziologischen Rollentheorie herauszufinden, ohne dabei die persönliche Grenze zu vernachlässigen.
Zwar können die entindividualisierenden Eigenschaften von den sozialen Rollen entkräftet werden, dennoch gibt es keine Möglichkeiten, sie gänzlich zu umgehen. Somit müssen die Möglichkeiten einer Individuation entlang und nicht entgegen der Rollenerwartungen untersucht werden.
2. Hauptteil
Simmel hat die Ansicht, dass alle Individuen ein grundlegendes Interesse haben, sich zu individuieren (vgl. Simmel 2000: 300). Der Mensch ist ein Grenzwesen, da wir uns an der Potentialität von Grenzen, unserem Weltbild und unserer Identität aufbauen (vgl. Simmel 1999: 214). Dabei ist der Mensch nicht nur Betrachterin der Grenze, sondern er ist selbst eine Grenze. Er erlebt Grenzen passiv, aber handelt mit ihnen aktiv, indem er Grenzen einhält, überschreitet oder selbst neue Grenzen setzt.
Das was seinen individuellen Grenzcharakter, aus soziologischer Sicht auszeichnet, ist seine Grenze zwischen Gesellschaft und sich selbst. Er ist Teil beider Grenzen, einer persönlichen und einer gesellschaftlichen Grenze oder nach Simmel, einer einzelnen und generellen Grenze. Das unterscheidet Simmel von herkömmlichen soziologischen Theorien, welche das Individuum auf sein Rollenaggregat reduzieren und ihm seinen individualistischen Charakter als alleinige Produktion der Gesellschaft zuschreiben. Dahrendorf teilt Simmels Meinung und kritisiert auch diese soziologischen Theorien. Anstatt von einem Grenzwesen spricht Dahrendorf von einem nicht greifbaren „zehnten Charakter"(Dahrendorf 2017: 204), der wie bei Simmel eine Freiheitstendez hat, sich zu individuieren. Der zehnte Charakter ist mit der persönlichen Grenze bei Simmel vergleichbar. Jene treiben das Individuum an, sich von den sozialen Rollen abzugrenzen. Für Dahrendorf ist das Individuum wie ein Rollenaggregat anzusehen, jedoch mit diesen eigenen zehnten Charakter. Nichtbeachtung dieses zehnten Charakters birgt große Gefahren mit sich, denn das Individuum rückt in den Hintergrund und wird auf ihre Rollenzugehörigkeiten reduziert. Wenn dieser rollenreduzierender Blick angeeignet wird, neigt man dazu andere und sich selbst zu entpersonalisieren, denn jenen Blick wird man auch auf das eigene Selbstbild projizieren. Darin besteht die Gefahr, dass man in seinen rollenideologischen Frame verhaart und seinen eigenen freien Spielraum, wie auch den von Anderen, nicht berücksichtigt.
Das grundlegende Interesse, sich zu individuieren, wird aber für Simmel hauptsächlich auf sozialer Ebene (bzw. Grenze) praktiziert, indem die sozialen Kreise an sich eine Form der Individualisierung sind und sie einen freien erlebbaren Spielraum anbieten (vgl. Simmel 1992b: 466-468).
Die Kreise selbst geben dem Individuum eine individualistische Färbung, da sie in sich selbst etwas Individuelles sind, jedoch machen sie den/die Teilnehmerin der Gruppe nicht ganz individuell, denn der/die Teilnehmer:in ist nur Teil eines Ganzen, nämlich seiner Gruppe (vgl. Simmel 1992a: 797 f). Somit ist das Individuum erst außerhalb seines Kreises individuell, da der Kreis eine Abgrenzung zu anderen Kreisen markiert, aber im Kreis selbst ist das Individuum nicht individuell, da die individualistische Färbung auf jede:n Teilnehmer:in zutrifft.
2.1 Freiheitsräume der sozialen Kreise
Darin äußert sich auch ein Drang zur stetigen Individuation, indem jeder Kreis dem Individuum ein anfängliches Gefühl von Individuation gibt, aber bei Beharrung im Kreis ein gegensätzliches Gefühl vermittelt, da man als Mitglied im Kreis nicht individuell ist (vgl. ebd. 793). Folge dessen schließt man sich einem anderen Kreis an. Dennoch bietet jeder Kreis einen individuell interpretierbaren Spielraum an, wenn dieser ausgelebt wird, entsteht auch eine Abgrenzung zu den anderen Teilnehmer:innen. An welchem Kreis das Individuum bleibt oder nicht entscheidet es selbst, höchstwahrscheinlich basiert die Entscheidung auf den Wünschen der persönlichen Grenze.
Durch die Auswahl eines Kreises und die Partizipation des freien Spielraumes entsteht für das Individuum geringfügig Individuation, innerhalb der Positionen, Rollen oder Kreise, darin liegt aber nur eine begrenzte Handlungsmöglichkeit vor, da nicht alle Kreise und Positionen ausgesucht oder leicht ersetzt werden können (vgl. Dahrendorf 2017: 187). Das ist auch eines der Hauptprobleme für Dahrendorf, da sehr viele Positionen zugeschrieben sind. Zusätzlich sind die Kreise mit Normen bzw. Rollen verbunden, die wiederum die Persönlichkeit einschränken. Der Bruch der Normen führt zu Sanktionen der Gesellschaft welche, abhängig vom Bruch, unterschiedlich stark ausfallen (vgl. ebd.: 169,178). Zudem ist man immer von den Rollenerwartungen betroffen, solange man Teil der Gesellschaft ist und wie Simmel mit seiner Grenzbegriff herausgestellt hat, ist Gesellschaft essentiell für eine Individuation. Folglich bleibt das Individuum in einem Zwiespalt mit dem eigenen Wunsch zur Individuation und dem Wunsch, die Rollenerwartungen einzuhalten.
Dennoch muss das Individuum nicht alle Rollenerwartungen einhalten für eine Individuation. Sanktionen von Gesellschaftsmitgliedern, die keinen Einfluss auf das Individuum ausüben können, sind dementsprechend nicht relevant für das Individuum. Dennoch gibt es immer einen engeren Kreis, der für das Individuum wichtig ist, wie z.B Freunde oder Familie (vgl. Simmel 1992a: 802-804). Wenn dieser nicht gegeben ist, fehlt dem Individuum die intimen Erfahrungen und der psychische Schutz innerhalb gesellschaftlicher Grenzen, was zu einer übertriebenen Selbstisolierung und Deformierung der Identität führen kann.
Die vollkommene Einhaltung der Rollenerwartungen führt jedoch auch zu einer unbefriedigenden Individuierung, denn individuelle Wünsche, welche im Konflikt zur Norm stehen, können nicht ausgelebt werden. Dahrendorf hat dafür ein menschliches Konstrukt entworfen namens „Homo Sociologicus” ( Dahrendorf 2017: 164), welches die Einhaltung der Rollenerwartungen, gegenüber der Auslebung seiner persönlichen Wünsche präferiert (vgl. ebd.: 169). Dieser ist jedoch als reines Theoriemodell gedacht, schließlich ist der Mensch mehr als eine leere Hülle, die mit Rollen gefüllt und sozialisiert wird.
Dennoch offenbart der Homo Sociologicus, wie die Rollenerwartungen die individuellen Freiheitsräume des Menschen, zum einen einschränken und ihm gleichzeitig vorgeben wollen, wie er seine Rolle auszufüllen hat, ohne Chancen den Rollen zu entrinnen. Simmels Lösungsansätze versuchen daher lediglich, in den nicht freiheitlichen Gebilde der Gesellschaft, die größtmögliche Individuation zu schaffen.
2.2 Dynamische Individuation durch soziale Kreise
Simmels Hauptpunkt liegt in der quantitativen Steigerung verschiedener Kreise, da jeder Kreis oder Rolle zumindest einen kleinen Spielraum für die Ausgestaltung der individuellen Wünsche zulässt (vgl. Simmel 1992a: 797). Dahrendorf bestätigt diesen Spielraum (vgl. Dahrendorf 2017: 189 ff.). Der Spielraum entsteht nach Dahrendorf, da die Rollenerwartungen meistens nicht feste und klare, sondern eher lose, aber intuitiv verständliche Normen für die Gesellschaftsmitglieder sind. Folge dessen verbieten die Rollenerwartungen eher gewisses Verhalten, anstatt ein bestimmtes Verhaltensmuster vorzuschreiben. Das Verhalten muss also in einem normgerechten Rahmen stattfinden. Dies gibt dem Individuum einen minimalen Grad mehr Individuation, denn jener Spielraum kann mit den persönlichen Wünschen ausgefüllt werden. Indem das Individuum in mehreren Kreisen verkehrt, welche sich unterscheiden, häuft sich der Freiheitsraum für die Individuation. Dadurch entsteht aber keine größere Freiheit für das Individuum im Gesamtbild, denn die Freiheitsräume sind verschieden und immer nur innerhalb des jeweiligen Kreises gegeben. Das kann zu einer unbefriedigten Individuation führen, denn für jeden Kreis liegt eine andere Norm und eine anderer Freiheitsraum vor, wodurch sich die Identität nie in einem vollkommenen Zustand entfalten kann. Stattdessen werden die Individuationsmöglichkeiten der Freiheitsräume segmentiert und auf die verschiedenen Kreise verteilt. Zusätzlich können die Kreise untereinander konfligieren, indem die Kreise mit gegenteiligen Rollenerwartungen gefüllt sind. Somit liegt das Individuum in einem Konflikt mit den Rollen untereinander und den eigenen Individuationswünschen.
Wir sind als Individuum immer Teil von mehreren Kreisen mit sozialen Rollen, somit sind wir für viele Theorien nur ein Produkt unserer Rollen, ein Rollenaggregat. Aber da jede Rolle zu einen kleinen Grad frei individuiert werden kann, fallen wir nie ganz mit unseren Rollenaggregat zusammen. Wir bilden vielmehr den dynamischen Schnittpunkt unserer Rollen ab. Dadurch entsteht eine Rollendynamik, in der wir immer weiter progressieren.
Da das Individuum seine Identität aus dem Wechselspiel von gesellschaftlicher und persönlicher Grenze schließt und wir selten in unsere Rolle komplett aufgehen, ist unsere Identität selbst etwas dynamisches, etwas was von der ständigen Wechselwirkung von Gesellschaft und sich selbst betroffen ist. Ein unabschließbarer Prozess, der eine dynamische Umgebung braucht, um seinen eigenen Wunsch nach Dynamik zu befriedigen. Darin konstatiert sich die eigentliche Freiheit der Individuierung und der Sinn des Lebens für Simmel (vgl. Simmel 2017: 184). Die Freiheit schränkt sich dann für das Individuum ein, wenn die Identität in sich selbst verharrt, da ihm keine Möglichkeit der Weiterentwicklung zusteht. Deswegen ist es auch nicht unbedingt von Nöten, ständig ganz verschieden neue Rollen zu finden, es geht vielmehr darum eine erkennbare Progression in einer seiner Rollen oder im gesamten Rollenaggregat zu finden.
Beispielsweise wird ein gläubiger Mönch seine Rolle, die wenig Spielraum zulässt, nicht wechseln und wenig koexistenzielle Rollen besitzen, dennoch kann er sich in seiner Rolle entfalten. Ihm steht eine progressive Bindung mit seinem Glauben, bzw. seiner Rolle bevor. Zudem können andere Instanzen genutzt werden, welche mit seiner Rolle in Verbindung stehen, um seine Identität auszuleben. Zum Beispiel würde die Pflege, bauliche Erweiterung oder allgemein ausgedrückt die Progression seines Gebetshauses, welches ein wichtiger Bestandteil seiner Rolle ist, seine Individuationswünsche befriedigen. Nun mögen seine Rolleneinschränkungen bestehen bleiben, aber durch die positive Progression seiner Rolle, die zu gewissen Teilen seine Individuationswünsche widerspiegelt, entsteht dennoch ein Individuationsprozess der Wünsche, die mit seiner Rolle zusammenfallen. Dadurch wird der ausgelebte Freiheitsraum innerhalb der Rolle für die Individuation erstmal zweitrangig, aber durch den Freiraum selber wird die Dynamik der Identität vorangetrieben. Im Freiheitsraum wird die Progression der Individuation oft ausgelebt, womit der Prozess im Ganzen bekräftigt wird, denn der Schnittpunkt des Rollenaggregats hat sich durch die differente Auslebung verändert. Solange die Möglichkeit einer Progression gegeben ist, die eben auch die Identität und das Selbstbild progressieren lässt, wird die Individuation vorangetrieben.
Dafür muss aber ein weiterer Punkt gegeben sein, die Identität muss mit den Rollenerwartungen einhergehen. Die Rollen müssen auf die eigenen Wünsche zugeschnitten werden, weil die Progression einer Rolle, welche die persönlichen Interessen des/der Rollenträger:in nicht erfüllt, führt zu keiner befriedigenden Progression und Individuierung, für die Identität.
Nun ist es nicht leicht, Kreise und Positionen zu finden, die genau das tun. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es schwierig herauszufinden, was seine eigenen Indivierungswünsche sind, schließlich ist Identität etwas dynamisches und unabgeschlossenes. Zum anderen ist die Teilnahme an einem Kreis mit mehreren Bedingungen geknüpft. Für viele Kreise sind Talente und Fähigkeiten gefragt oder sie sind mit einem finanziellen Beitrag verbunden. Da die Menschen unterschiedliche Anlagen haben, müssen für Simmel, Kreise gefunden werden, die auf die eigenen Talente und Fähigkeiten zugeschnitten sind (Müller 2015: 95). Der jeweilige Kreis gibt dann Raum, um diese Talente entfalten zu können.
2.3 Individuation durch enge Kreise
Das Individuum ist Teil von ausgewählten und aufgezwungenen Kreisen. Jeder Kreis hat seinen Zweck um die Individuationswünsche zu befriedigen. Eine Instanz, die seit Beginn der Menschheit eine große Rolle für das Individuum spielt, ist die Familie. Die Familie ist der erste soziale Kreis, an den sich das Individuum anschließt. Dieser Kreis ist sehr intim, denn das familiäre Zusammenleben findet ihre Basis meistens auf einem romantischen Ethos, der auf Liebe und Zuneigung beruht. Der Mensch als soziales Grenzwesen braucht die Intimität und den psychischen Schutz der Familie, ansonsten wird seine Individuierung niemals vollkommen aufgehen (vgl. Simmel 1992a: 802-804). Denn wenn er nur Intim im Einzelnen (seiner persönlichen Grenze) ist, fehlt ihm das gesellschaftliche Gegenstück, das die individuelle Intimität vollkommen manifestiert. Denn die Identität, konstituiert sich für Simmel, aus der Dyade von Bewusstheit der eigenen und umweltlichen Existenz (vgl. Simmel 2000: 300 f.). Dementsprechend folgt auch die Individuierung auf beiden Ebenen dieser Dyade, bei der die Familie die umweltliche Existenz als enger Kreise präsentiert.
Damit die intimen Wünsche aber auch erfüllt werden, muss die Familie auf dem eben genannten Ethos basieren. In vielen Familien entsteht jedoch immer mehr ein distanziertes und nicht intimes Verhältnis. Dies hat gesellschaftliche Gründe, denn in der Moderne wird das Konstrukt Familie deutlich häufiger kritisiert als zuvor. Gegensätzlich zu Simmel wird die Familie oft als eine Einschränkung, anstatt einer Manifestierung der intimen Wünsche dargestellt. Denn Familien sind oft mit festen Rollen verbunden, die zugeschrieben werden. Simmel sieht den Verlust der Familie aber sehr kritisch, wegen der eben erwähnten Intimität. Ohne eine intimen Kreis entsteht für Simmel eine psychische Deformation für das Individuum (vgl. Simmel 1992a: 802-804).
Dennoch behält auch das moderne Narrativ zum Teil recht, da der Kreis Familie zugeschrieben ist und zugeschriebene Positionen und Rollen führen meistens zu Einschränkungen der Individuation. Der zugeschriebene Familienkreis kann aber durch einen auserwählten Familienkreis ersetzt werden. Indem das Individuum seine:n Ehepartner:in auswählt und mit diesem/dieser Kinder zeugt. Ebenso können enge Freundschaften auch zu einer Erfüllung der intimen Wünsche führen. Daher sollte nach Simmel ein intimer Kreis ständig Bestandteil eines Individuum sein, trotz seiner Rollenerwartungen. Diese Rollenerwartungen werden bei einem Bruch noch härter bestraft, da der enge soziale Kreis das Individuum sanktioniert und dieser Kreis ist für das Individuum sehr wichtig. Da aber der Kreis ziemlich intim ist, werden die Rollenerwartungen viel mehr vom Kreis selbst auferlegt, dadurch kann man einen intimen Kreis finden, der die Individuationswünsche durch seine Rollenerwartung nicht oder zumindest gering einschränkt. Ganz frei ist dieser Kreis als Teil der Gesellschaft nicht, aber er kann in sich selbst frei sein.
Wie in der Einleitung erwähnt, wird die Gesellschaft auch immer offener für untypische Rollen. Zum Beispiel können Homosexuelle einen intimen Familienkreis besser finden, als in der Vormoderne. Hier kann man von einer positiven Entwicklung sprechen, für den individualistischen Ethos, denn der Freiheitsraum war vorher nicht gegeben.
Simmels Perspektive der Individuierung offenbart einen möglichen Umgang mit den Freiheitsräumen, der die persönlichen Wünsche in einem Zusammenspiel mit den sozialen Rollen und Kreisen manifestiert. Die sozialen Kreise müssen eine Progression erlauben, damit die dynamische Identität sich stetig neu individuieren kann. Durch die jeweiligen Freiheitsräume der Kreise wird die Progression gefördert. Zusätzlich müssen die engen Kreise die intimen Wünsche des Individuums befriedigen, ansonsten wird die Identität deformiert.
Fazit
Für Simmel, wie auch Dahrendorf sind soziale Positionen mit Erwartungen verbunden, die unsere Individuation einschränken, zudem sind die Erwartungen unumgänglich, da sie fester Bestandteil unserer Gesellschaft sind.
Dennoch existieren mehrere und verschiedene Freiheitsräume für Individuation, innerhalb der sozialen Rollen und Kreise. Der große Unterschied bei Dahrendorfs und Simmels Perspektive liegt in der Bewertung und Funktion der Freiheitsräume. Simmels Bewertung fällt anders aus, da für ihn ein Hauptaspekt, welchen Dahrendorf nicht beachtet, die Individuation begleitet.
Dieser Hauptaspekt liegt in der progressiven Dynamik der Rollen. Die Identität und somit auch die Individuation, setzen sich aus Dynamiken zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Grenze heraus (vgl. Simmel 1999: 212-215). Die Identität ist nicht fest und starr, sondern ein bewegbarer Schnittpunkt von mehreren Variablen, die sich ständig verändern. Dementsprechend braucht die Identität einen gesellschaftlichen Raum, der eine dynamische Entwicklung zulässt, um eine vollständige Individuation manifestieren zu können. Der Raum entsteht durch den ständigen Wechsel der sozialen Kreise, der Anhäufung von verschiedenen Kreise oder durch Kreise, die eine Progression erlauben.
Die unterschiedlichen Freiheitsräume bieten viel mehr einen Raum für Individuation an, welcher benutzt werden kann. Ob er benutzt wird, hängt von den Handlungsmöglichkeiten und Intentionen des Individuums ab. Es ist nicht möglich jeden Freiheitsraum, aus einem universell repräsentativen Standpunkt zu erleuchten, die meisten Freiheitsräume sind vereinzelt und lokal in den jeweiligen Gruppen verortet, sie äussern sich in jeder Gruppe anders, mal sind sie in einem Kreis größer, mal in einem anderen Kreis kleiner vorhanden. Das Entscheidende ist, dass jede Rolle einen gewissen Freiraum bietet und dementsprechend muss das Individuum seine eigenen Individuationsmöglichkeiten erkennen, um sie dann selbst im Zusammenspiel von Gesellschaft und Identität zu manifestieren. Daher ist die quantitative Steigerung der sozialen Kreise und somit auch der Freiheitsräume, einer der Hauptaspekte, um seine Individuation qualitativ zu verbessern. Zusätzlich muss ein intimer Kreis, in Form einer Familie oder eines engen Freundeskreis gegeben sein, um die intimen Indivduationswünsche zu befriedigen. Ohne diesen Kreis fehlt dem Individuum die Intimität der gesellschaftlichen Grenze, gleichzeitig ist der enge Kreis aber auch mit Rollenerwartungen und Sanktionen verbunden.
Die Einschränkungen und Freiheitsräume waren schon lange für die Soziologie allgegenwärtig bekannt, Simmels Perspektive offenbart aber einen wechselwirkenden Umgang, von persönlicher und sozialer Grenze, der dem Individuum als alleiniger Prozess, Freiheit bzw. Individuation schafft. Er hat eine andere Ebene der Individuation gefunden, die den Blickwinkel für die soziologische Rollentheorie erweitert.
Dahrendorf will mit seinem Theoriemodell Homo Sociologicus, lediglich den freiheitseinschränkenden Charakter und die Unumgänglichkeit der sozialen Rollen aufzeigen. Dabei fokussiert sich Dahrendorf auf die einzelnen Freiheitsräume und entindividualisiert das Individuum, zu einem Homo Sociologicus. Dementsprechend kann das Theoriemodell nicht zu Ergebnissen führen, die den Menschen repräsentieren, lediglich den stark entfremdeten Menschen. Natürlich sind wir Menschen individuelle Wesen, und eine gewisse Entfremdung der Individualität ist essentiell, um soziologische Ergebnisse zu finden. Dennoch findet Simmel einen Weg, die Identität mit der Gesellschaft zu verbinden, er reduziert den Menschen auf seine persönliche und gesellschaftliche Grenze. Die dynamische Identität ist der basale Beweggrund für Individuation und kann in der Praxis auf die soziale Ebene angewandt werden. Simmel zeigt den rollentheoretischen Prozess der Individuation, währenddessen Dahrendorf vielmehr die einzelnen Freiheitsräume untersucht und dabei den wechselwirkenden Prozess mit der persönlichen Grenze vernachlässigt.
Die Ergebnisse der Hausarbeit sind ambivalent, da die ständigen Wechselwirkungen und Kreise, Individuation fördern und gleichzeitig einschränken. Positiv für den individualistischen Ethos, ist Simmels dynamischer Umgang mit den sozialen Rollen und Kreisen. Er bietet einen praktisch normativen Umgang, der Grundlage ist, um Individuation zu erlangen. Indem Umgang liegt die Progression und Dynamik, des Rollenaggregats im Vordergrund. Dabei sind die Freiheitsräume wichtig für die Dynamik, denn durch ihre Auslebung unterscheidet sich das Individuum von seiner Rolle. In dieser ständigen Abgrenzung zur Rolle entwickelt sich die Identität weiter. Somit sind wir mehr als nur ein Rollenaggregat und können unsere Individuation innerhalb der modernen Gesellschaft, die immer mehr Rollen anbietet, manifestieren.
Zwar kann man von einer gewissen Handlungsfreiheit, die in der Moderne nochmal größer wurde, sprechen. Dennoch bleiben soziale Rollen und ihre einschränkenden Charaktereigenschaften bestehen. Zudem ist die mögliche Weiterentwicklung des Rollenaggregats, abhängig von monetären, geographischen und kulturellen Faktoren, wie auch von den eigenen Talente, des Individuums.
Ironischerweise ermöglichen erst soziale Rollen und Kreise eine Individuierung, um dann die Individuierung durch ihre Rollenerwartungen einzuschränken. Wichtig für die Soziologie ist es, dass die Individuierung vom Individuum selbst vorangetrieben werden kann und dass der dynamische Individuantionsprozess mit den Rollenaggregat, essentiell für die Individuation ist. Mit Hinblick auf die Fragestellung, ist es interessant herauszufinden, wie sehr dieser dynamische Prozess, durch unsere eigenen Intention vorangetrieben wird oder doch, wie Dahrendorf vermutet, die Gesellschaft uns die Internalisierung der Rollen, in einem Sozialisationsprozess aufzwingt.
Literaturverzeichnis:
- Dahrendorf, Ralf (2017): Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, (Supple 1), Heft 69, S.159-214.
- Kocka, Jürgen (2009): Wissenschaftliche Nachrichten. Ralf Dahrendorf in historischer Perspektive. Aus Anlass seines Todes am 17. Juni 2009. Geschichte und Gesellschaft, 35 Jg., Heft 2, S.364-352.
- Müller, Hans-Peter (2015): Wie ist Individualität möglich? Strukturelle und kulturelle Bedingungen eines modernen Kulturideals. Zeitschrift für Theoretische Soziologie, Jg. 4, Heft 1, S.89-111.
- Simmel, Georg (2017): Der Konflikt der modernen Kultur. In Otthein Rammstedt, Gregor Fitzi (Hg.), Georg Simmel. Der Krieg und die geistigen Entscheidungen. Grundfragen der Soziologie. Vom Wesen des historischen Verstehens. Der Konflikt der modernen Kultur. Lebensanschauung. Gesamtausgabe. Band 16. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. S.183-207.
- Simmel, Georg (1992a): Die Erweiterung der Gruppe und die Ausbildung von Individualität. In Otthein Rammstedt (Hg.), Georg Simmel. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Gesamtausgabe. Band 11. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. S.791-865.
- Simmel, Georg (1992b): Die Kreuzung sozialer Kreise. In Otthein Rammstedt (Hg.), Georg Simmel. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Gesamtausgabe. Band 11. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. S.456-511.
- Simmel, Georg (2000): Individualismus. In Klaus Latzel (Hg.), Georg Simmel. Aufsätze und Abhandlungen. 1909-1918 Band II. Gesamtausgabe. Band 13. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. S.299-306.
- Simmel, Georg (1999): Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel. In Otthein Rammstedt, Gregor Fitzi (Hg.), Georg Simmel. Der Krieg und die geistigen Entscheidungen. Grundfragen der Soziologie. Vom Wesen des historischen Verstehens. Der Konflikt der modernen Kultur. Lebensanschauung. Gesamtausgabe. Band 16. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. S.209-425.
- Quote paper
- Maximilian Reddig (Author), 2022, Individuation innerhalb sozialer Kreise und Rollen. Vergleich der Theorien von Georg Simmel und Ralf Dahrendorf, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1329629