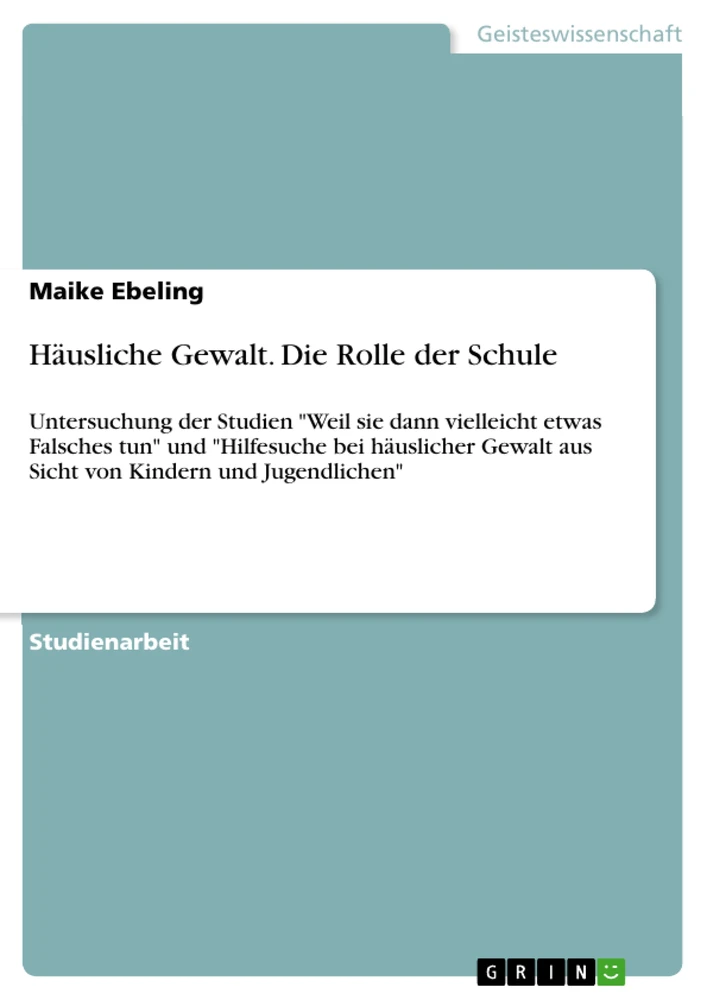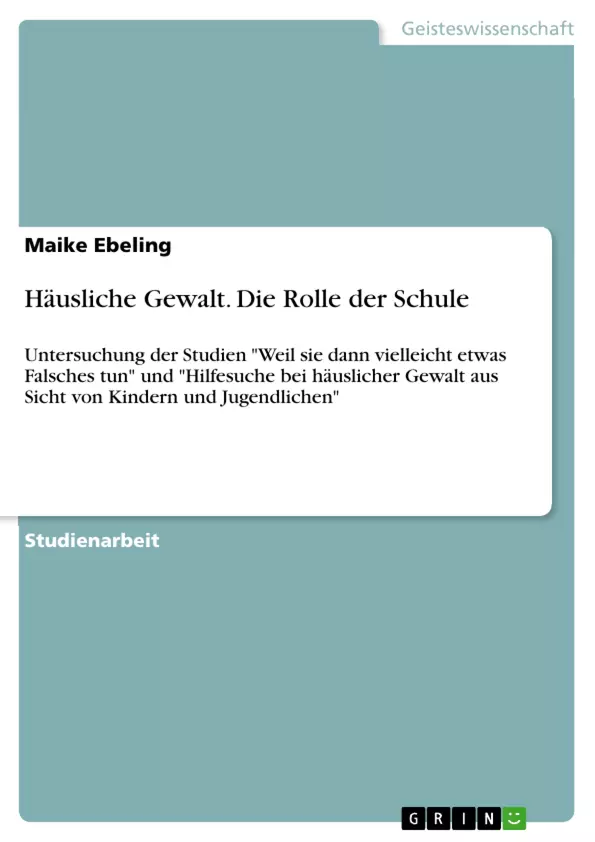Eine Studie aus der Schweiz ist das Thema der hier behandelten Texte. Untersucht werden die Texte „„Weil sie dann vielleicht etwas Falsches tun“ – zur Rolle von Schule und Verwandten für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder aus Sicht der 9- bis 17-jährigen“ (2006) und „Hilfesuche bei häuslicher Gewalt aus Sicht von Kindern und Jugendlichen - Ergebnisse einer quantitativen Befragung unter Berücksichtigung von Geschlecht, Alter und kultureller Herkunft“ (2007). Beide Texte stellen die Ergebnisse dieser Befragung vor und geben Ansätze zur Nutzung dieser Ergebnisse. Im Folgenden werden vorerst die beiden Texte dargestellt, indem auch die Ergebnisse dieser genannten Befragung erläutert werden. Anschließend erfolgt ein Fazit, in dem die Texte reflektiert werden, prägnante Aspekte herausgegriffen werden und weitere Überlegungen angestellt werden.
Das grundlegende Problem im Bezug auf die Kinder und Jugendlichen im Kontext von häuslicher Gewalt ist, dass sie in den seltensten Fällen selbst zu Wort komme. Jedoch kann man sicher sein, dass es sich hier um wichtige bisher unbekannte Informationen handelt, die bezüglich der Intervention mehr als hilfreich sein könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung der Texte
- 2.1 Hilfesuche bei häuslicher Gewalt aus Sicht von Kindern und Jugendlichen - Ergebnisse einer quantitativen Befragung unter Berücksichtigung von Geschlecht, Alter und kultureller Herkunft
- 3. Reflexion
- 4. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle der Schule im Kontext häuslicher Gewalt aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert zwei Texte von Corinna Seith, die sich mit den Ergebnissen einer Studie befassen, in der Kinder und Jugendliche im Kanton Zürich zu ihren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt befragt wurden.
- Die Wahrnehmung von häuslicher Gewalt durch Kinder und Jugendliche
- Die Bedeutung der Schule als potentieller Anlaufstelle für betroffene Kinder und Jugendliche
- Die Rolle von Verwandten und Eltern als potentielle Ansprechpersonen
- Die Auswirkungen von Kultur und Geschlecht auf die Hilfesuche
- Die Herausforderungen der Intervention und Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Problematik, dass Kinder und Jugendliche im Kontext häuslicher Gewalt häufig nicht zu Wort kommen und ihre Sichtweisen und Erfahrungen unzureichend berücksichtigt werden. Die Arbeit bezieht sich auf die Studie von Corinna Seith im Kanton Zürich, die diese Lücke in der Forschung zu schließen versucht.
2. Darstellung der Texte
2.1 Hilfesuche bei häuslicher Gewalt aus Sicht von Kindern und Jugendlichen - Ergebnisse einer quantitativen Befragung unter Berücksichtigung von Geschlecht, Alter und kultureller Herkunft
Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der Studie von Corinna Seith aus dem Jahr 2007. Die Studie erforschte die Einstellungen und Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich im Bezug auf häusliche Gewalt. Dabei wurden verschiedene Aspekte untersucht, wie z.B. ob Kinder mit anderen über die Gewalt sprechen würden, an wen sie sich wenden würden und welche Gründe sie für ihre Entscheidungen angeben.
Die Studie zeigt, dass Kinder und Jugendliche häufig zögern, über häusliche Gewalt zu sprechen, aufgrund von Angst vor Vertrauensbruch, Imageverlust und der Vorstellung, dass es sich um ein privates Problem handelt. Die Studie analysiert auch die Rolle der Schule, der Verwandten und der Eltern als potentielle Ansprechpersonen und beleuchtet die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sowie zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen häusliche Gewalt, Kinder- und Jugendschutz, Schule, Verwandte, Eltern, Hilfesuche, Befragung, Studie, Geschlecht, Alter, Kultur, Interventionsmöglichkeiten.
- Arbeit zitieren
- Maike Ebeling (Autor:in), 2010, Häusliche Gewalt. Die Rolle der Schule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1326515