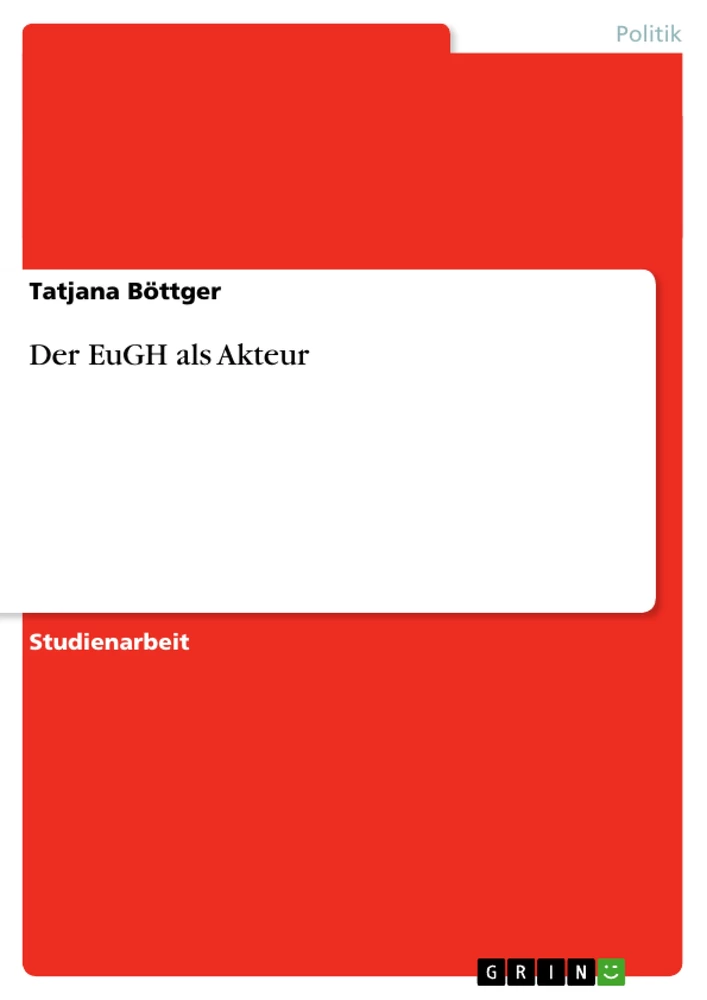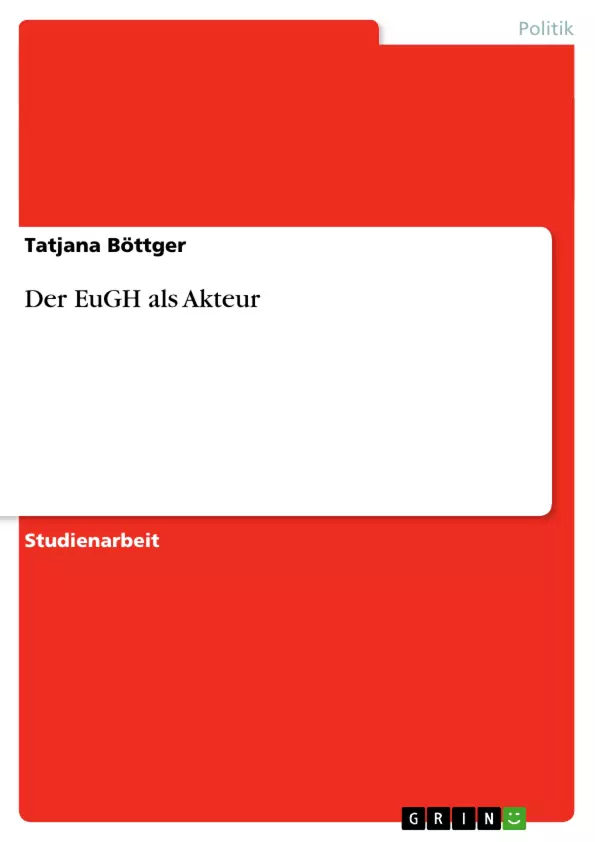Ausgehend von Scharpfs Theorie zum akteurszentrierten Institutionalismus soll der EuGH als Akteur im europäischen Prozess untersucht werden. Was zeichnet den EuGH als aktives – auch Recht setzendes – Element aus, welche spezifische Komposition seiner selbst sowie des institutionellen Umfelds erlauben ihm ungewöhnliche Verhaltensweisen? Nach den frühen Meilensteinen „kreativer“ Rechtsprechung wurde dem EuGH für die heutige Zeit angesichts schwieriger neuer Politikfelder nach Maastricht eine bedächtigere Vorgehensweise prognostiziert. Anhand aktueller Urteile wird allerdings deutlich, dass der EuGH seine alte Linie nicht aufgegeben hat: Er setzt weiter auf die Ermächtigung seines wichtigsten Partners, des Bürgers im weiteren Sinne, um die EU ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden zu lassen. Diese Vorgehensweise gilt insbesondere auch für neue Politikbereiche wie die GASP.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Akteurszentrierter Institutionalismus
- Integration durch Recht
- EuGH als Akteur?
- Besonderheiten des EuGH
- Meilensteine „kreativer“ Rechtsprechung
- Gründe für die Machtentfaltung: Der institutionelle Rahmen
- Selbstverständnis und Komposition der Institution EuGH
- Der EuGH im institutionellen Gefüge der EU
- Quo vadis, EuGH?
- Politisches Umfeld der EuGH-Entscheidungen
- Einordnung aktueller Rechtsprechung und Entwicklungen
- Fortführung der Ermächtigung der Bürger
- Versuche des Machterhalts bzw. -ausbaus des EuGH auch bei GASP und Strafrecht
- Zusammenfassung und Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Europäischen Gerichtshof (EuGH) als Akteur im europäischen Integrationsprozess. Sie analysiert, inwiefern der EuGH seine Machtposition erhält oder ausbaut, indem er seine Rechtsprechung nutzt, um die Europäische Union weiterzuentwickeln. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der EuGH seine Machtbasis sichert und welche Rolle dabei seine Komposition und das institutionelle Umfeld spielen.
- Der EuGH als Akteur im europäischen Integrationsprozess
- Die Rolle des EuGH bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union
- Die Machtentfaltung des EuGH und seine Komposition
- Der institutionelle Rahmen des EuGH und seine Auswirkungen auf seine Rechtsprechung
- Die aktuelle Rechtsprechung des EuGH und ihre Bedeutung für die Europäische Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Forschungsfrage. Sie beschreibt den EuGH als eine Institution, die eine erstaunliche Eigendynamik entwickelt hat und innerhalb des europäischen Governance-Prozesses als selbstbewusster und selbstständiger Akteur agiert.
Der theoretische Teil der Arbeit behandelt die Theorie des akteurszentrierten Institutionalismus nach Mayntz und Scharpf sowie die rechtswissenschaftliche Schule „Integration durch Recht“. Diese Ansätze dienen als theoretische Grundlage für die Analyse des EuGH als Akteur.
Das Kapitel „EuGH als Akteur?“ untersucht die Besonderheiten des EuGH und seine Meilenstein-Entscheidungen. Es analysiert die Gründe für die Machtentfaltung des EuGH, insbesondere seine Komposition und das institutionelle Umfeld.
Das Kapitel „Quo vadis, EuGH?“ beleuchtet das politische Umfeld der EuGH-Entscheidungen und ordnet aktuelle Urteile und Entwicklungen den Tendenzen „fortschreitende Ermächtigung des Bürgers“ sowie „Machterhalt auch in neuen Politikbereichen“ zu.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Europäischen Gerichtshof (EuGH), den akteurszentrierten Institutionalismus, die Integration durch Recht, die Europäische Union, die Rechtsprechung des EuGH, die Macht des EuGH, die Komposition des EuGH, das institutionelle Umfeld des EuGH, die Ermächtigung der Bürger, die GASP und das Strafrecht.
- Arbeit zitieren
- Tatjana Böttger (Autor:in), 2008, Der EuGH als Akteur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/132621