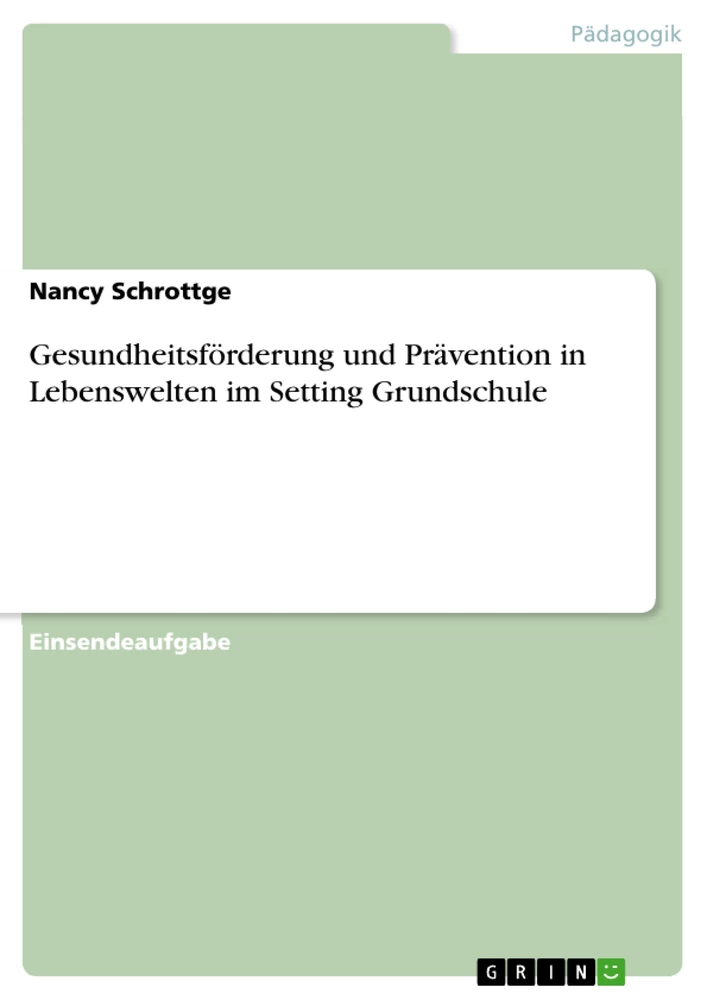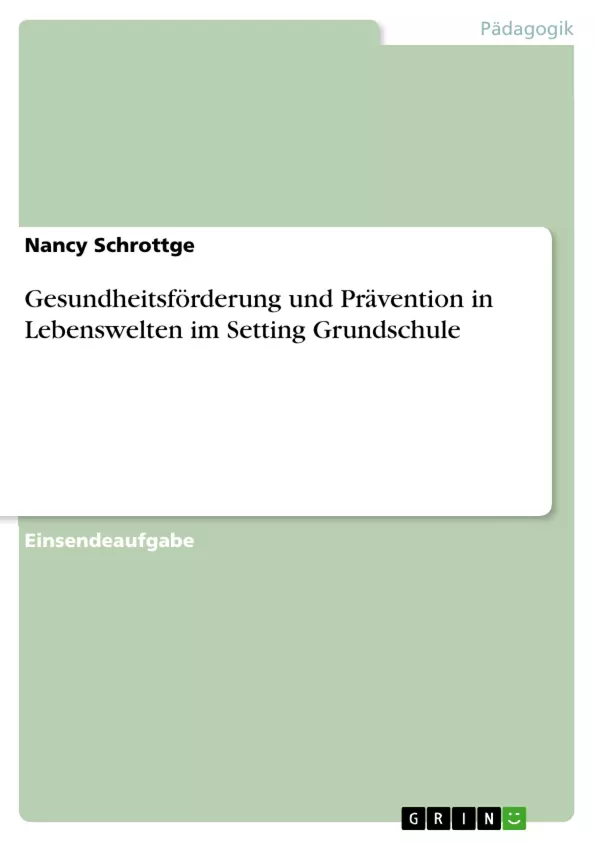Die Aufgabe dieser Arbeit bestand darin, eine zentrale Lebenswelt, in diesem Fall das Setting Grundschule, aus gesundheitlicher Perspektive zu analysieren und praxistaugliche Handlungsansätze zur Gesundheitsförderung zu identifizieren. Zunächst wird die gesundheitliche Ausgangssituation analysiert. Im Anschluss wird ein Modellprojekt vorgestellt und bewertet. Die Arbeit schließt mit Schlussfolgerungen für die Praxis.
Inhaltsverzeichnis
- 1 ANALYSE DER GESUNDHEITLICHEN AUSGANGSSITUATION ............ 3
- 1.1 Gesundheitsbezogene Datenlage.
- 1.1.1 Übergewicht und Adipositas.
- 1.1.2 Unfälle
- 1.1.3 Bewegungsverhalten
- 1.1.4 Ernährungsverhalten…..\n
- 1.1.5 Medienkonsum
- 1.1.6 Psychische Auffälligkeiten.
- 1.1.7 Diskussion der gesundheitlichen Daten.
- 1.2 Ableitung von drei Handlungsansätzen.
- 2 RECHERCHE „MODELLPROJEKT“.
- BEWERTUNG MODELLPROJEKT
- 3.1 Good-Practice-Kriterien.........
- 3.2 Schlussfolgerung für die Praxis
- LITERATURVERZEICHNIS .\n
- ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.
- 5.1 Abbildungsverzeichnis..\n
- 5.2 Tabellenverzeichnis...\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die gesundheitliche Ausgangssituation von Kindern im Grundschulalter (6-10 Jahre) in Deutschland. Die Analyse stützt sich auf aktuelle, evidenzbasierte Literatur und untersucht verschiedene gesundheitsbezogene Daten, um praxistaugliche Handlungsansätze zur Gesundheitsförderung in diesem Setting zu identifizieren.
- Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
- Häufigkeit und Trends von Unfällen im Grundschulalter
- Bewegungsverhalten von Grundschulkindern und Vergleich mit WHO-Empfehlungen
- Zusammenhänge zwischen sozioökonomischem Status und gesundheitlichen Daten
- Potenzielle Handlungsansätze zur Verbesserung der Gesundheit von Grundschulkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit analysiert die gesundheitliche Datenlage von Grundschulkindern in Deutschland, indem es Daten zu Übergewicht und Adipositas, Unfällen, Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten, Medienkonsum und psychischen Auffälligkeiten beleuchtet. Es werden aktuelle Studien und Statistiken herangezogen, um die verschiedenen Faktoren und Trends aufzuzeigen.
Das zweite Kapitel widmet sich der Recherche und Bewertung eines "Modellprojekts", dessen Good-Practice-Kriterien und Schlussfolgerungen für die Praxis im dritten Kapitel beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Grundschule, Gesundheitsförderung, Prävention, Übergewicht, Adipositas, Unfälle, Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten, Medienkonsum, psychische Auffälligkeiten, sozioökonomischer Status, Handlungsansätze, Modellprojekt, Good Practice.
- Arbeit zitieren
- Nancy Schrottge (Autor:in), 2022, Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten im Setting Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1324885