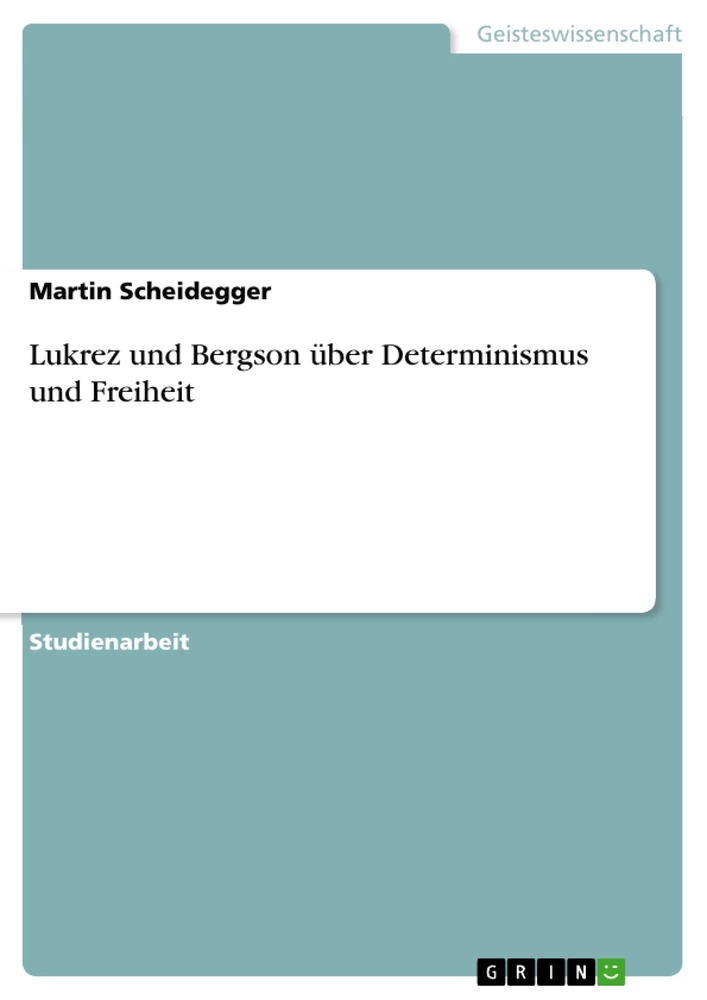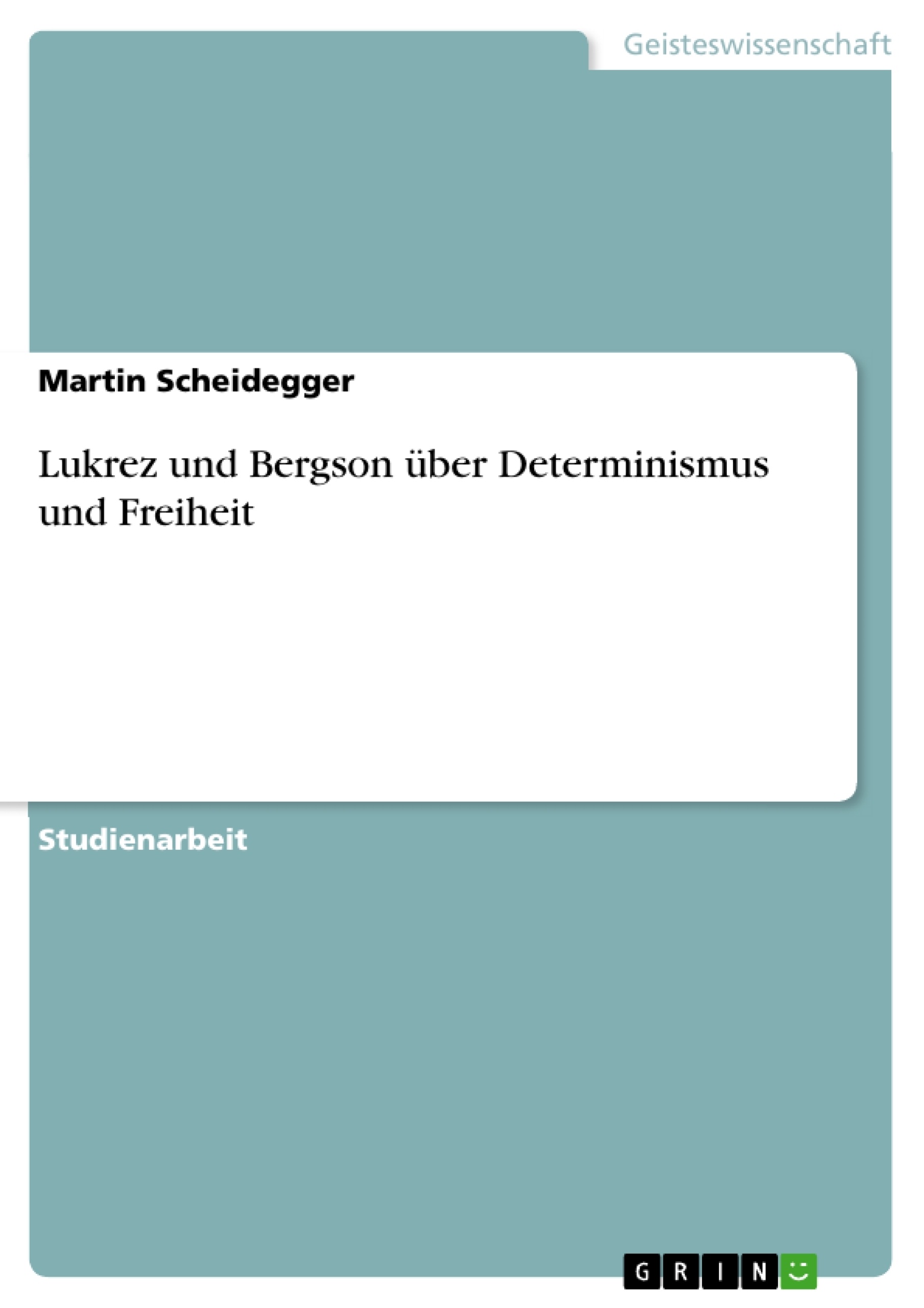In der vorliegenden Arbeit wird das Verhältnis von clinamen und Willensfreiheit in Lukrez’ De rerum natura erörtert und anhand von Henri Bergsons Lukrez-Edition sowie aus der Perspektive von dessen späterer Dissertation, Zeit und Freiheit, kritisch analysiert, wobei der Ansatz verfolgt wird, Lukrez’ Position zunächst im begrifflichen Rahmen der aktuellen Willensfreiheitsdebatte zu verorten. Das erfordert zunächst, dass das clinamen in die Reihe der Bewegungsursachen bei Lukrez eingeordnet wird und danach unter Zuhilfenahme bestimmter begrifflicher Unterscheidungen, die in der aktuellen Literatur zur Willensfreiheit eingesetzt werden – positive und negative Freiheit, Willens- und Handlungsfreiheit, Determinismus und Indeterminismus, Kompatibilismus und Inkompatibilismus –, Lukrez’ Position klarer herauszuarbeiten und von anderen theoretischen Optionen abzugrenzen. Des Weiteren wird die Relevanz der Möglichkeit und Wirklichkeit von Willensfreiheit für die epikureische Ethik beleuchtet. Denn die naturphilosophisch-metaphysischen Überlegungen sollen als Grundlage für Lukrez’ Ziele in der praktischen Philosophie erwiesen werden, nämlich die Selbstbeherrschung und Ermächtigung des Geistes im Verhältnis zur Welt und was daraus für unser gesellschaftliches Handeln folgt. Jedoch ist zu fragen, wie kompatibel in diesem Fall die theoretische und die praktische Philosophie der Epikureer miteinander sind und von welcher Perspektive aus Lukrez bzw. Epikur (primär) denken, d.h., ob es einen Primat der Physik oder einen der Ethik gibt. Im Anschluss wird die Nähe und Ferne von Lukrez’ Ansatz zu dem Bergsons genauer betrachtet, indem Bergsons Lukrez-Interpretation in dessen Edition herangezogen wird. Abschließend wird Bergsons Darstellung und Kritik des Determinismus in den Fokus genommen, da dieser sowohl für ihn als auch für Lukrez unvereinbar mit der menschlichen Freiheit ist.
Inhalt
1. Einleitung
2. Lukrez über die Ursachen der Bewegung
3. Lukrez über die Willensfreiheit
4. Bewertung von Lukrez’ Begründung der Willensfreiheit
5. Bergsons Lukrez-Interpretation
6. Bergsons Kritik am physikalischen und psychologischen Determinismus
1. Einleitung
Im Folgenden soll das Verhältnis von clinamen und Willensfreiheit in Lukrez' De rerum natura erörtert und anhand von Henri Bergsons Lukrez-Edition sowie aus der Perspektive von dessen späterer Dissertation, Zeit und Freiheit, kritisch analysiert werden, wobei der Ansatz verfolgt wird, Lukrez' Position zunächst im begrifflichen Rahmen der aktuellen Willensfreiheitsdebatte zu verorten. Das erfordert zunächst, dass das clinamen in die Reihe der Bewegungsursachen bei Lukrez eingeordnet wird und danach unter Zuhilfenahme bestimmter begrifflicher Unterscheidungen, die in der aktuellen Literatur zur Willensfreiheit eingesetzt werden - positive und negative Freiheit, Willens- und Handlungsfreiheit, Determinismus und Indeterminismus, Kompatibilismus und Inkompatibilismus -, Lukrez' Position klarer herauszuarbeiten und von anderen theoretischen Optionen abzugrenzen. Des Weiteren wird die Relevanz der Möglichkeit und Wirklichkeit von Willensfreiheit für die epikureische Ethik beleuchtet. Denn die naturphilosophisch-metaphysischen Überlegungen sollen als Grundlage für Lukrez' Ziele in der praktischen Philosophie erwiesen werden, nämlich die Selbstbeherrschung und Ermächtigung des Geistes im Verhältnis zur Welt und was daraus für unser gesellschaftliches Handeln folgt. Jedoch ist zu fragen, wie kompatibel in diesem Fall die theoretische und die praktische Philosophie der Epikureer miteinander sind und von welcher Perspektive aus Lukrez bzw. Epikur (primär) denken, d.h., ob es einen Primat der Physik oder einen der Ethik gibt. Im Anschluss wird die Nähe und Ferne von Lukrez' Ansatz zu dem
Bergsons genauer betrachtet, indem Bergsons Lukrez-Interpretation in dessen Edition herangezogen wird. Abschließend wird Bergsons Darstellung und Kritik des Determinismus in den Fokus genommen, da dieser sowohl für ihn als auch für Lukrez unvereinbar mit der menschlichen Freiheit ist.
2. Lukrez über die Ursachen der Bewegung
Lukrez schildert seine Theorie der Willensfreiheit im Rahmen eines umfassenderen Kapitels zur Kinetik in Buch II, das in der Übersetzung von Klaus Binder mit „Bewegung der Urelemente“ betitelt ist (DRN 2.62-2.332). Die Bewegung der Urelemente ist der Grund für das Entstehen, die Vielfalt und das Vergehen der aus ihnen zusammengesetzten Dinge (vgl. DRN 2.62-2.63). So erklärt Lukrez Wachstum und Altern entsprechend dadurch, dass Urelemente zu Körpern hinzukommen bzw. sich von diesen lösen, was jeweils Bewegungsvorgänge voraussetzt (vgl. DRN 2.69-2.74). Ohne die Bewegung der Urelemente gibt es auch keine Bewegung der aus ihnen zusammengesetzten Körper. (Das hat Lukrez zu Recht gegen Demokrit eingewandt, da es zumindest in einem globalen Bezugssystem gesehen falsch wäre, die Urelemente als unbewegte Teile bewegter Körper anzusehen.) Ein Grund für die Bewegung der Urelemente kann ihre Schwere sein (vgl. DRN 2.84), als innere Kraft, durch die sich die Urelemente von selbst bewegen, wovon für Lukrez wohl kein Urelement ausgeschlossen ist. Die Bewegung geht dabei in gerader Linie „nach unten“, wobei fragwürdig ist, welchen Sinn die Richtungen „oben“ und „unten“ in einem unendlichen Universum haben sollen. Hier geht Lukrez wohl eher von der sinnlichen Wahrnehmung des Erdenbewohners aus. Ein weiterer Grund der Bewegung kann der (zufällig erfolgende) Stoß (vgl. DRN 2.85) durch ein anderes Teilchen sein, was also eine äußere Kraft darstellt, sofern ein Teilchen nicht durch sich selbst, sondern durch ein anderes bewegt wird. Voraussetzung für die Existenz von Stößen ist jedoch das clinamen, wie wir im Folgenden sehen werden, da die Schwere allein keine Kollisionen ermöglicht.
Die Bewegung der Urelemente ist Lukrez zufolge unaufhörlich und das wird (als Minimalbedingung) durch das clinamen gewährleistet, denn selbst, wenn der Schwere eines Teilchens permanent entgegengewirkt und ein Stoß ausbleiben würde, gäbe es immer noch die zufällige, spontane Abweichung. Die grundsätzliche Bewegtheit aller Teilchen bleibt erhalten, nur ihre Bewegungsrichtung ändert sich (daher mag es mitunter problematisch sein, das clinamen wie Schwere und Stoß als ,Bewegungsursache‘ zu klassifizieren). Eine Bedingung für diese unendliche Bewegung der Urelemente ist die räumliche Unendlichkeit des Universums und damit auch die Unendlichkeit der Leere (als materiefreiem Raum zwischen den Teilchen), die die Bewegung mit ihrer Widerstandslosigkeit möglich macht. Zudem ist wichtig, dass es im Universum keinen tiefsten Punkt (oder tiefere Regionen) gibt (DRN 2.912.92), wie Lukrez schreibt, also kein unabhängig von den Körpern bestehendes Gefälle, das bestimmte Regionen im Universum als höher oder tiefer auszeichnen würde (damit ist nicht „oben“ und „unten“ gemeint), aufgrund dessen die Urelemente sich wegen ihrer Schwere sammeln könnten (bzw. müssten) und so ihre Bewegung einstellen würden.
Je nach Gestalt der Urelemente (welche wiederum von den minima abhängig ist (vgl. DRN 1.599-1.634), aus denen die unzerstörbaren Atome zusammengesetzt sind) prallen, Lukrez zufolge, die Urelemente im Falle eines Stoßes unterschiedlich stark (und damit unterschiedlich weit) voneinander ab (man kann aber annehmen, dass Lukrez auch davon ausging, dass nicht nur die Gestalt, sondern auch die Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung der zusammenprallenden Elemente für die Stoßeffekte von Relevanz sind). Die Verbindung, unterschiedliche Dichte und Festigkeit der aus Urelementen zusammengesetzten Stoffe und Körper (z.B. Eisen, Felsen, Luft) erklärt sich aus den Differenzen dieser von den Urelementtypen abhängigen Abpralldistanzen (vgl. DRN 2.100-2.104). Damit Teilchen eine Verbindung eingehen können, müssen sie, wie Lukrez behauptet, eine ähnliche Bewegungsform (Geschwindigkeit, Stoßverhalten) aufweisen. Andernfalls fliegen sie frei umher (vgl. DRN 2.109-2.111). Die Bewegung eines Körpers kann umso schneller sein, je weniger dicht das Medium ist, durch das er sich bewegt (der Idealfall wäre der leere Raum), da Stöße mit anderen Teilchen einen Körper bremsen oder seine Bewegungsrichtung verändern können.
Zur Bewegung durch Schwere und Stoß kommt noch die zufällige Abweichung der Teilchen von ihrer Bahn, genannt clinamen (vgl. DRN 2.216-2.293). (Hier könnte man sich fragen, ob diese Abweichung als Änderung der Bewegungsrichtung schon das Vorhandensein der Schwere als Bewegungsursache voraussetzt bzw. davon unabhängig ist.) Die Zufälligkeit der Abweichung bezieht sich sowohl auf deren räumlichen als auch deren zeitlichen Aspekt. Lukrez beschreibt diese Abweichung aber als minimal (wodurch sich näherungsweise gesetzmäßige Zusammenhänge formulieren lassen). In der Unendlichkeit des Universums reicht eine äußerst geringe Abweichung von einer geraden Bahn aus, um so verschiedene Partikel aufeinandertreffen zu lassen, die dann durch Stöße weitere Bewegungen nach sich ziehen und zur Formung komplexerer Körper führen. (Man könnte also sagen, dass es eine Kette von Bedingungsverhältnissen bzw. Hierarchie zwischen den drei Bewegungsursachen gibt: Schwere bedingt clinamen und beide zusammen ermöglichen Stöße.) Andernfalls würden die Urelemente einzeln und ohne Interaktion bloß ewig gerade „nach unten“ fallen (vgl. DRN 2.221-2.222). Daher schreibt Binder in seinem Kommentar auch zu Recht: Der Zufall des clinamen „sprengt die Einheit der Natur nicht, er ermöglicht diese erst“ (DRN 274n215). An dieser Stelle scheint Lukrez eher vom Ende her zu Denken und das clinamen als notwendige Bedingung der Möglichkeit komplexer Körper (und letztlich der Willensfreiheit) vorauszusetzen (das gleicht der Struktur nach einem transzendentalen Argument auf naturphilosophischem Gebiet). Wird denn überhaupt eine davon unabhängige Herleitung des clinamen gegeben? Das clinamen erscheint als unerklärter Erklärer etwas willkürlich, mysteriös oder vielleicht sogar unnötig (auch wenn Erklärungen irgendwo an ein Ende kommen müssen, sollten sie nicht zirkulär sein bzw. in einen unendlichen Regress führen (Münchhausen-Trilemma')'), da man die Stöße der Partikel auch anders erklären könnte, indem man z.B. die Annahme verwirft, dass sich alle Teilchen durch ihre Schwere in dieselbe Richtung bewegen würden (z.B. auch, weil sich ihre Massen gegenseitig anziehen). Ich denke, dass die Sinne Lukrez in diesem Fall nicht zu einer guten Analogie oder Verallgemeinerung verleitet haben, aber das lässt sich in der Rückschau vor dem Hintergrund des heutigen physikalischen Wissens leicht sagen. So wie Lukrez die Zufälligkeit des clinamen beschreibt, scheint mir deutlich zu sein, dass er sie als ontologisch versteht, es also nicht so ist, dass uns endlichen Erkenntnissubjekten gewisse Bewegungen lediglich als zufällig erscheinen (was bloß ein epistemischer Mangel wäre), sondern dass es tatsächliche subjektunabhängige Zufälligkeiten in der Welt gibt.
Lukrez' weitere, negative Begründung des clinamen ist meines Erachtens sehr problematisch. Er sieht es nämlich als methodologisch gerechtfertigt an, aus der Abwesenheit gegenläufiger Evidenz auf die Existenz des clinamen zu schließen: „Dass ein Ding jedoch nie von seiner geraden Bahn um Weniges abweichen könne, wer hätte das je beobachtet?“ (DRN 2.249-2.250) Absurd ist hier (in dieser Übersetzung) die Konstruktion „nie ... könne ... je“, da „nie“ ja eine Ewigkeit bedeuten würde, die endliche Subjekte prinzipiell nicht erfahren können. Das „könne“ spricht zudem eine Potenzialität an, die als nicht aktualisierte auch nicht wahrnehmbar ist. Das „je“ suggeriert zeitlich begrenzte Wahrnehmungsakte, was grundsätzlich nicht mit einer unendlichen Zeitspanne zusammenpasst. Außerdem könnte und müsste man wohl noch viele weitere Dinge als existent annehmen, wenn man strikt Lukrez' Methode folgen würde. Darin zeigt sich auch, dass die Abwesenheit von Evidenz mit Unterbestimmtheit einhergeht. Da die prinzipielle Falsifizierbarkeit von Theorien häufig als Kriterium für deren Wissenschaftlichkeit angeführt wird (wie z.B. von Karl Popper), wäre im Falle der Nichtwahrnehmbarkeit des clinamen
Lukrez' Hypothese methodologisch als fragwürdig einzustufen. Andererseits spricht Lukrez davon, dass das clinamen nur ein „fast Unmerkliches“ (DRN 2.244) sei, was man so deuten könnte, dass es, entsprechende Instrumente vorausgesetzt, doch möglich wäre, es wahrzunehmen.
3. Lukrez über die Willensfreiheit
Wenn man alle Vorgänge in der Welt als determiniert ansehen würde, würde es wohl nicht viel bringen, eine Ethik aufzustellen, die den Menschen sagt, was sie wollen und tun sollten, da dafür eine Wahl und Autonomie vorausgesetzt wird, die Willens- und eventuell auch Handlungsfreiheit erfordert (wobei man erstere als notwendige Bedingung für letztere ansehen könnte). Andernfalls müsste man den Entwurf der Ethik und auch Lukrez' gesamtes Werk selbst als Produkt determinierter Kausalketten begreifen, Strafe (in einem normativen Sinne) wäre ohne die Verantwortung, die Willens- und Handlungsfreiheit implizieren, auch nicht sinnvoll, jedoch im Falle der Wahrheit des Determinismus nicht vermeidbar.
Die Richtung der Begründung, die Lukrez in Buch II vorbringt, ist aber nicht der Schluss vom clinamen auf die Willensfreiheit, sondern für ihn ist zunächst primär die weitere Stützung der clinamen-These zentral, weshalb er vielmehr vom höherstufigen Phänomen anscheinend freier Handlungen zurückschließt auf die notwendige Existenz des clinamen. Er war also noch nicht fertig mit seinem Beweisgang, was das so gerichtete argumentative Vorgehen erklärt. Genauer gesagt geht dem eine reductio ad absurdum voran, ein in De rerum natura beliebtes Mittel, mithilfe dessen Lukrez seine philosophischen Gegner diskreditiert, indem er ihre Position einnimmt - hier den Determinismus -, um sie kurz darauf durch Verweis auf simple Alltagserfahrungen zu widerlegen - hier das Gefühl oder gar stärker das für Lukrez offenkundige Faktum der Freiheit des Willens. Lukrez arbeitet damit, dass den Menschen angesichts ihrer Lebensrealität für gewöhnlich die Freiheit ihres Willens plausibler erscheint als die Existenz eines clinamen, weshalb er auch letzteres durch erstere rechtfertigt.
Andersherum will Lukrez aber auch zeigen, wie Binder zu Recht anmerkt, dass wir „moralisch handeln [können], weil es der Natur nach möglich ist“ (DRN 276n255). Denn darum geht es Lukrez wie zuvor Epikur: zu zeigen, was in der Natur wirklich und möglich ist und welche normativen Vorgaben für unser Denken und Handeln dem am besten entsprechen. Wie Lukrez unablässig betont, sind Aberglaube bzw. Religion und die Überzeugungssysteme sowie Praktiken, die sie konstituieren, mit einer richtigen Auffassung der Natur unvereinbar. Falsche Götterbilder und vermeintliches (durch sie bestimmtes) Schicksal (als Form von Determinismus) fallen darunter. Mit dem clinamen wird das Gesetz des Schicksals, aber nicht das der Natur gebrochen. Binder schreibt: „Epikurs und Lukrez' Ziel war die Widerlegung des demokritischen Determinismus und dessen Wiederkehr in der Stoa“ (DRN 274n219). „Sie wollten nur, dass die Menschen ihr Leben nach dem einrichten, was in der Natur wirklich und möglich ist. Und sie wollten wissen, ob und wie das wiederum möglich ist.“ (DRN 275n219) Naturerkenntnis ist dabei für Lukrez immer auch Selbsterkenntnis und umgekehrt.
Lukrez liefert uns eine mechanistische1 Erklärung der Freiheit. Der Wille ist ihm zufolge leiblich lokal situiert (in der Brust als Sitz des Geistes) und physisch aktiv. Er ist der Ursprung jeder freien Handlung und gibt den Anstoß für die Bewegung der Körperteile (vgl. DRN 2.2662.271). Die Ausübung des freien Willens ist mit Lust verknüpft und folglich mit dem Ziel der epikureischen Philosophie. Denn nur durch einen freien Willen vermag es der Mensch, seine Lust (d.h. Abwesenheit von Schmerzen und anderen negativen Wirkungen auf die Seele) zu optimieren. Ohne die Voraussetzung dieser Fähigkeit wäre die epikureische Moral sinnlos.
Um Lukrez' Beitrag systematisch in der Willensfreiheitsdebatte verorten zu können, ist es ratsam, zunächst einige Grundbegrifflichkeiten zu klären, die man dann für die Bewertung seines Ansatzes heranziehen kann. Eine erste grobe Einteilung von Freiheiten, die zur Orientierung hilfreich sein mag, ist die, der zufolge man frei zu etwas (z.B. zu reisen) und frei von etwas (z.B. Strafen) sein kann. Entsprechend wird dies allgemein als positive bzw. negative Freiheit bezeichnet (vgl. Keil 2017, 1). Spezifischere Freiheitsarten buchstabieren dies unterschiedlich aus. So beabsichtigt Lukrez, dass wir frei von Todes- und Götterfurcht werden und setzt für den Weg dorthin voraus, dass wir frei sind, zu denken, unseren Willen zu bilden und zu handeln. Für die Frage nach der Willens- und Handlungsfreiheit ist aber nicht nur eine positive Beschreibung der Freiheit relevant, sondern auch die negative der Abwesenheit des inneren und äußeren Zwangs, wie wir bei Lukrez sehen (vgl. DRN 2.272-2.276). Unter Handlungsfreiheit ist dabei die Freiheit zu verstehen, „das zu tun oder zu lassen, was man will“ (Keil 2017, 1). Dieses Konzept kann man auch so deuten, dass für Handlungsfreiheit keine Willensfreiheit nötig ist, also die Freiheit, „seinen Willen zu bilden, frei zu wählen oder frei zu entscheiden“ (ebd., 2), sondern nur die Abwesenheit von Zwängen, die die Manifestation des Willens in Handlungen verhindern würden. Wie man sieht, ist der Wille aber den Handlungen (die ferner begrifflich oftmals von bloßem Verhalten unterschieden werden) vorgeordnet, weshalb das Problem der Willensfreiheit als fundamental für die Freiheit von Personen anzusehen ist und daher auch im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht. (Lukrez hat diesen Punkt selbst eingesehen.)
Äußerer Zwang tangiert primär die Handlungsfreiheit, nicht die Willensfreiheit: „Willensfreiheit [ist] mit einem großen Maß an politischer Unfreiheit und äußeren Zwängen verträglich“ (ebd., 4). Das könnte auch eine Lehre sein, die man aus dem abschließenden PestKapitel von De rerum natura ziehen könnte. Schließlich ist die kontemplative Einstellung, die durch die epikureische Naturerkenntnis eingeübt wird, eine, die auch die Freiheit des Willens stärken soll. Denn die internalisierten Zwänge (z.B. durch Religion und sozialen Druck verursacht) sind es, die uns hindern, unseren Willen frei und angemessen zu bilden. Darin liegt die Wurzel allen Übels, die Lukrez anpackt.
Zwar stellen innere Zwänge eine Gefahr für die Willensfreiheit dar, aber Lukrez behandelt diese nicht explizit im Kapitel über die Bewegung der Urelemente. Vielmehr geht es ihm um die zweite große Gefahr für die Willensfreiheit, die eine metaphysische und nicht eine psychologische ist: Es ist der Determinismus, der alternative freie Willensbildungsprozesse ausschließt, da diesem zufolge alles von jeher unabänderlich vorherbestimmt ist. Die Position, der zufolge Determinismus und Willensfreiheit unvereinbar (also inkompatibel) sind, nennt sich Inkompatibilismus. Die Gegenposition wäre entsprechend der Kompatibilismus, der erstaunlich stark in der heutigen akademischen Philosophie vertreten ist, obwohl er den meisten Laien kontraintuitiv erscheint. Lukrez' Ansatz ist dem Inkompatibilismus zuzuordnen, auch wenn er das Ausmaß an Freiheit scheinbar als relativ gering eingeschätzt hat. Ich denke, dass die Einführung des clinamen gerade dem Zweck dient, zu einer solchen inkompatibilistischen Position zu gelangen, da er die Willensfreiheit als empirisches Faktum als gesetzt ansieht und es ihm klar zu sein scheint, dass dies nicht mit einem absoluten Determinismus zu vereinbaren ist.2 Daher kommt die Invention und Intervention des clinamen ins Spiel, um einerseits durch die Bewegungsursachen Schwere und Stoß die Regelmäßigkeit in der Natur zu erfassen und andererseits einen kleinen Spielraum für das freie Verhalten der Subjekte gegenüber der Welt und ihren eigenen inneren Zuständen zu gewähren. Ich spreche hier allgemeiner von ,Subjekten‘, da Lukrez in Bezug auf den freien Willen von „lebende[n] Wesen“ statt spezifischer nur von Menschen spricht (wodurch er sich von anderen, wie etwa Giovanni Pico della Mirandola, abhebt, die die Willensfreiheit als Charakteristikum für die anthropologische Differenz heranzogen); er erwähnt als Beispiel auch Pferde (DRN 2.264). Eine kompatibilistische Position (in der Philosophiegeschichte u.a. vertreten von Hobbes und Locke), die den Determinismus implizieren würde, kommt für Lukrez daher nicht infrage (und auch erst recht nicht die Variante des Inkompatibilismus, die die Willensfreiheit ausschließt und allein den Determinismus für wahr hält). In der neueren Willensfreiheitsdebatte gibt es auch eine Position, die gegenüber der Frage nach der Wahrheit des Determinismus indifferent ist (z.B. begründet durch epistemische Grenzen, die die Klärung der Frage unmöglich machen), für die Verantwortlichkeit aber auch unabhängig davon gegeben ist. Dieser Ansatz kann als agnostischer Kompatibilismus bezeichnet werden (vgl. Keil 2017, 8). Lukrez will in diesem Fall diese Offenheit oder Unklarheit aber unter keinen Umständen so stehen lassen (in anderen, weniger fundamentalen Bereichen wie etwa der Astronomie erlaubt er es hingegen), auch wenn die Abweichung durch das clinamen empirisch nicht erfassbar sein sollte; der zu zahlende Preis wäre für ihn zu groß. Die Falschheit des Determinismus muss für Lukrez erwiesen werden, denn dies ist die Basis für die freie Bildung der Weltsicht (bzw. gewünschte Umbildung nach epikureischem Vorbild) und das daran ausgerichtete Handeln, die durch die Lektüre von De rerum natura befördert werden sollen. Ein umfassenderer Agnostizismus, der sowohl die Frage nach der Wahrheit des Determinismus als auch nach der der Willensfreiheit einschlösse, ist dementsprechend für den Epikureer auch aus dem Spiel.
Was bleibt, ist eine Form von indeterministischem Inkompatibilismus, den man Lukrez' Ansatz zuschreiben könnte. Jedoch führt die Charakteristik des clinamen dazu, dass hier weiter differenziert werden muss. Denn die Zufälligkeit, die für Lukrez die Willensfreiheit ermöglicht, ist ein Spezifikum, das diese Form von indeterministischem Inkompatibilismus von der viel geläufigeren des sogenannten Libertarismus abhebt, welcher wohl eher unserer vorphilosophischen Alltagsauffassung von Freiheit entspricht. Einerseits versucht Lukrez mit seiner Verteidigung der Willensfreiheit einem Denken entlang dieser Alltagserfahrung Rechnung zu tragen, aber andererseits macht er den Zufall durch dessen für die Willensfreiheit konstitutive Rolle zu stark, wodurch er wiederum vom Common Sense abrückt, der gerade nicht den unbeherrschbaren Zufall, sondern die bewusste Kontrolle als Kernelement der Willensfreiheit betont (was nicht heißen soll, dass sich gewisse Zufälligkeiten und Willensfreiheit generell ausschließen würden). Ich würde Lukrez' Position, um es auf den Punkt zu bringen, daher als aleatorisch-indeterministischen Inkompatibilismus bezeichnen.
4. Bewertung von Lukrez' Begründung der Willensfreiheit
Wie wir gesehen haben, ist Lukrez' Begründung des freien Willens durch das clinamen (bzw. umgekehrt) in De rerum natura 2.251-2.293 wichtig (wenn auch nur kurz behandelt), aber zugleich sehr problematisch. Zwar scheint es mir auch aus heutiger Sicht plausibel, wie Lukrez einen inkompatibilistischen und indeterministischen Ansatz in der Willensfreiheitsdebatte zu vertreten, aber seine Begründung der Willensfreiheit durch den Zufall (in Form von nicht weiter erklärbaren Bewegungsänderungen) scheint mir grundlegend verfehlt zu sein, da dieser ebenso wie die notwendig vorherbestimmten Kausalketten des Determinismus keine Freiheit im Sinne autonomer Kontrolle ermöglicht. Zwar beschreibt Lukrez die Phänomenologie der Willensfreiheit sehr anschaulich, das Ankämpfen gegen Impulse und die Fähigkeit des So-oderanders-Könnens (vgl. Keil 2017, 9), aber all das erscheint vor dem Hintergrund der atomistischen Lehre mit den drei Bewegungsursachen Schwere, Stoß und clinamen als eine Illusion, ein bloßes Freiheitsgefühl und eben das reicht für wahre Freiheit und Verantwortlichkeit meiner Ansicht nach nicht aus. Letztlich zeigt sich darin eine Inkohärenz im Verhältnis von epikureischer Physik und Ethik, die jeweils für sich genommen fruchtbar, aber im Grunde genommen nicht miteinander vereinbar sind. Zwar könnte man sagen, dass es bei Lukrez einen Primat der Ethik gibt, insofern für ihn die epikureische Physik Mittel zum Zweck der rechten Lebensführung ist, aber andererseits gewinnt die Physik in De rerum natura eine solche Eigenständigkeit, dass man innerhalb dieses Werks eher von Perspektivenwechseln sprechen müsste. Das clinamen sollte Lukrez als das die Willensfreiheit begründende Brückenelement zwischen Physik und Ethik dienen, was jedoch bereits seinen Zeitgenossen problematisch erschien, und aus heutiger Sicht - mit erweiterten begrifflichen und argumentativen Mitteln - wird noch klarer, warum und inwiefern diese Kritik berechtigt ist. Im folgenden Abschnitt, der sich mit Henri Bergsons Lukrez-Interpretation befasst, soll dies exemplarisch noch aus einer anderen methodischen Perspektive heraus verdeutlicht werden.
5. Bergsons Lukrez-Interpretation
1883/84 (die Datierung variiert in den Editionen bzw. der Sekundärliteratur) publizierte Henri Bergson eine kommentierte Edition ausgewählter Passagen aus De rerum natura, der er eine Einleitung voranstellte, in der er u.a. die physikalischen und philosophischen Aspekte des Werks beleuchtete. Wie Wade Baskin, der Übersetzer der englischen Fassung dieser Einleitung, bemerkt, verdient dieser Text eine eingehendere Auseinandersetzung, da er uns einen Einblick in Bergsons frühes Denken vor der 1889 publizierten Dissertation Zeit und Freiheit gewährt und dessen Kritik am materialistischen Denken vorwegnimmt (vgl. Baskin 1959, 3), denn der Materialismus ist oftmals ein Mechanizismus, der der kreativen Lebendigkeit zuwiderläuft. Spezifischer noch lässt sich Bergsons Denken als antiatomistisch klassifizieren (denn auch der in Zeit und Freiheit angegriffene psychologische Assoziationismus ist ein Atomismus im Bereich des Mentalen). Baskin weist jedoch auch auf positive Anknüpfungspunkte für Bergsons Philosophie hin, insofern letzterer bei Lukrez u.a. einen ersten - wenn auch unzureichenden - Ansatz zur Auflösung des problematischen Verhältnisses von Determinismus und Willensfreiheit gefunden haben mag (vgl. ebd., 4). Um ebendieses Verhältnis soll es vorrangig in diesem Abschnitt gehen.
Für die Edition hat Bergson sich die Maxime gesetzt, sich mit Kritik an Lukrez - abgesehen von groben Fehlern, die er bei ihm gefunden hat - zurückzuhalten (was ein Grund für die spärliche Forschungsliteratur zu dieser Edition sein mag) - vermutlich, weil es ihm in diesem Rahmen und für den Zweck der Textauswahl unangemessen erschien, aber andererseits begründet er diese Haltung auch mit der erstaunlichen Behauptung, es sei leicht, jegliches philosophische System zu widerlegen (vgl. Bergson 1884, VI). Nun ist es besonders interessant, in welchen Ausnahmefällen Bergson Lukrez in seiner Einleitung bzw. seinem Kommentar kritisiert. Zählen Lukrez' Äußerungen zu Determinismus und Willensfreiheit zu den erwähnten groben Fehlern, die nicht respektvoll übergangen werden können? Einen mit Blick auf Zeit und Freiheit entscheidenden Punkt markiert Bergson, indem er feststellt, dass es nicht nötig sei, die Fehlerhaftigkeit der Argumentation aufzuzeigen, die u.a. Zeit (temps) auf eine Kombination von (Eigenschaften von) Atomen reduziert (vgl. ebd., 17). Dieser ,Fehler‘ scheint für Bergson so offensichtlich zu sein, dass es an dieser Stelle für ihn keiner umfangreichen Erläuterung bedarf. Jedoch deutet er an, dass Lukrez' These der Grundintuition widerspricht, dass Zeit jenseits der zwei Optionen Materie und Leere besteht, woraus man ableiten könnte, dass sie nicht räumlich - aber nichtsdestotrotz wirklich - ist. In Zeit und Freiheit wird Bergson die diskontinuierlichen räumlichen Strukturen, die die Atome konstituieren, für inkommensurabel zur kontinuierlichen Dauer erklären. Da der materialistische Reduktionismus auf einer Verräumlichung der Dauer beruht, ermöglicht er in Bergsons Sicht deterministische Vorstellungen des Weltlaufs. Der Begriff der ,Dauer‘ (durée) in diesem Sinne taucht in Bergsons Lukrez-Edition zwar noch nicht auf, aber man könnte dessen Gehalt bereits zum Teil im dort vorfindlichen Begriff der ,Zeit‘ festmachen.
Bergson zufolge hat Epikur - und mit ihm Lukrez als sein geistiger Nachfolger - das clinamen aus zwei Gründen eingeführt (vgl. ebd., 32): erstens, um erklären zu können, wie Atome überhaupt zusammenkommen und größere Einheiten formen können (da sie sich ohne es, der Theorie zufolge, alle parallel zueinander in dieselbe Richtung bewegen würden); zweitens, um die Freiheit des Menschen zu begründen, da er eingesehen habe, dass sie mit einem harten Determinismus nicht kompatibel ist. Bergson meint, das clinamen gebe den Atomen eine ,Initiative‘ (vgl. ebd., 32) oder ein ,Vermögen‘ zur Abweichung, von dem sie Gebrauch machen könnten (vgl. ebd., XVII). Dieses Verständnis suggeriert jedoch eine kontrollierte Steuerung, die der rein zufälligen Abweichung widerspricht. Lukrez spricht aber in der Tat von einer (bewusst lenkbaren) ,Kraft‘ zur Bewegungsänderung, die auf dem clinamen basiert, was zwar Bergsons Interpretation unterstützt, aber einen Widerspruch in Lukrez' Theorie erkennen lässt. Auch eine Akkumulation der Zufälle führt nicht dazu, dass ein Bewusstsein über Willensfreiheit verfügt (ganz im Gegenteil). Vom Atom zum Menschen zu springen, ist ein fragwürdiger Schritt. Die zufällige Bewegung ist immer noch mechanisch, wenn auch nicht gesetzmäßig. Wenn das Zufallselement, das das clinamen darstellt, überhaupt die Freiheit des Menschen (oder gar der Welt als ganzer) begründen kann, dann nur in einem beschränkten negativen Sinne als Freiheit von ausnahmslosen Naturgesetzen, die den Lauf der Dinge determinieren. (Die Naturgesetze de dicto können nur grob richtig sein, denn es gibt de facto zumindest eine minimale Abweichung davon aufgrund des Zufallsfaktors.) Bergson schreibt es an anderer Stelle selbst: Das clinamen folgt keinem Gesetz und ist unvorhersehbar (das letztere, epistemische Charakteristikum mag als Folge des ersteren angesehen werden) (vgl. ebd., XVI). Diese Unvorhersehbarkeit - wenn sie sogar uneingeschränkt für die Selbstreflexion des Subjekts gilt - passt gut zu Bergsons späterer Konzeption der Dauer in Zeit und Freiheit, ohne dass diese jedoch des Zufalls bedürfte. Andererseits wird in Bergsons Darstellung ein Widerspruch deutlich, der schon bei Lukrez angelegt ist, wenn er schreibt, dass alle Phänomene aufgrund ihrer Determiniertheit mathematisch berechenbar und somit vorhersehbar seien (vgl. ebd., VII). Bergson kritisiert dieses scheinbar widersprüchliche Verhältnis jedoch nicht.
Bergson legt den Fokus seiner Darstellung auf die eher deterministischen Aspekte in Lukrez' Theorie und sieht entsprechend darin das Hauptziel des Texts. Im Zuge dessen kommt Bergson auf seine vermutlich originellste Interpretation zu sprechen, die die dem Text zugrunde liegende Befindlichkeit des Autors betrifft. (In der Sekundärliteratur zu Bergsons Lukrez-Edition wurde dieser Punkt wohl am häufigsten und intensivsten beleuchtet.) So zeige sich Lukrez' Text von Melancholie und Mitleid durchdrungen, die Konsequenz des deterministischen Grundgedankens seien, dass der Mensch den Naturgesetzen ausgeliefert sei (vgl. ebd., II-IV, VIII). Wie das mit Lukrez' Begründung der Freiheit zusammenpassen soll, ist wiederum fraglich. Der Nihilismus, der die Melancholie zu fundieren scheint, widerstrebt zudem der epikureischen Ethik, die einen Sinn im Streben nach einem guten (leidfreien) Leben sieht. Bergson zufolge besteht Lukrez' Ausweg für die Menschen darin, ihre Ohnmacht einzusehen, denn das sei der einzige mögliche Trost (vgl. ebd., VIII). Diese These erscheint aber erneut selbstwidersprüchlich, außer man meint damit rein deskriptiv das determinierte Faktum, dass die Menschen dieses Bewusstsein ausbilden (also nicht frei dazu gelangen). Außerdem ist nicht klar, warum Lukrez noch melancholisch sein soll, wenn er diese Einsicht scheinbar hat. War er kein guter Epikureer? Oder ist es gar nicht Lukrez' Melancholie, die hier verhandelt wird, sondern Bergsons eigene, die durch die Lektüre in ihm aufkam? Diese Fragen müssen hier offenbleiben.
6. Bergsons Kritik am physikalischen und psychologischen Determinismus
Im Folgenden soll kritisch auf einige Aspekte von Bergsons Darstellung und Kritik des physikalischen und psychologischen Determinismus im dritten Kapitel von Zeit und Freiheit eingegangen werden, da er in diesem Werk seine Überlegungen aus der Lukrez-Edition fortführt und eine Gegenposition zu Lukrez ausbuchstabiert. Dabei hat Bergsons Auseinandersetzung mit den Kontrahenten Determinismus und Libertarismus den Zweck, ein Verständnis von Freiheit zu entwerfen, das deren - von ihm diagnostizierte - Defizite, die auf der Verräumlichung der Dauer (bzw. der verwobenen Mannigfaltigkeit der Bewusstseinszustände) beruhen, überwindet.
Bergson vertritt in Zeit und Freiheit eine dualistische Konzeption des Menschen, der zufolge er sowohl Körper als auch Geist ist (vgl. Sinclair 2020, 65). Dementsprechend akzeptiert er auch die Unterscheidung von physikalischem und psychologischem Determinismus. Hierin wird schon ein erster Kontrast zu Lukrez offenbar, den man dementgegen als einen (atomistisch-materialistischen) Monisten ansehen könnte. Ungewöhnlich ist, dass Bergson die beiden Determinismen als „empirische Beweise der universalen Notwendigkeit“ (Bergson 2016, 127) einführt, die also als solche aposteriori gegen die Freiheit ins Feld geführt werden (vgl. ebd.). Die Art und Weise, wie Bergson die beiden Determinismen charakterisiert, zeigt aber, dass sie (wie üblich) in Wirklichkeit apriorischer Natur sind - andernfalls hätten sie aus prinzipiellen Gründen auch nichts im Hinblick auf die metaphysische Frage nach der (Willens- oder Handlungsfreiheit zu sagen. Dem psychologischen Determinismus zufolge werden „unsere Handlungen durch unsere Gefühle, unsere Ideen und die gesamte vorausliegende Reihe unserer Bewußtseinszustände notwendig gemacht“ (ebd.). Der physikalische Determinismus, der laut Bergson den psychologischen Determinismus voraussetzt3 (was überraschen mag, aber vor dem Hintergrund von Bergsons Primat des Psychischen verständlich ist), besagt, dass „die Freiheit [...] inkompatibel mit den fundamentalen Eigenschaften der Materie [...] und insbesondere mit dem Prinzip der Krafterhaltung“ ist (ebd.). Bergson kritisiert an späterer Stelle, dass man einen Fehler begeht, wenn man das Gesetz der Energieerhaltung ungebührlich universalisiert und über den Bereich des Physikalischen hinaus auch auf die Bewusstseinszustände anwendet, die erlebte Dauer also keinen Unterschied mache und die gleichen Ursachen immer zu den gleichen Wirkungen führen (vgl. ebd., 137 f.; letzteres wäre aufgrund des clinamen laut Lukrez nicht der Fall): „Denn man müßte zuerst nachweisen, daß einem gegebenen Hirnzustand ein streng determinierter psychologischer Zustand entspricht, und dieser Beweis steht noch aus“ (ebd., 131) - auch heute noch (wobei unklar ist, was genau unter der genannten ,Entsprechung‘ oder dem „Parallelismus“ (ebd.) zu verstehen ist). Neben diesem Zuordnungsproblem in Bezug auf Zustände gibt es Bergson zufolge aber auch das prinzipielle Problem der Nachweisbarkeit einer Kausalverbindung zwischen dem Physischen und dem Mentalen:
„[M]an beweist nicht und wird nie beweisen, daß die psychologische Tatsache durch die Molekularbewegung notwendig determiniert ist. Denn in einer Bewegung wird man den Grund einer anderen Bewegung finden, nicht aber den eines Bewußtseinszustands“ (ebd., 132).
Bergson verschiebt hier die Beweislast auf die (physikalistischen) Deterministen bzw. Reduktionisten/Eliminativisten (vgl. Sinclair 2020, 66). Diese könnten die (methodologische) Behauptung aufstellen, man müsse die Gesetzmäßigkeit nicht im Bewusstsein nachweisen, solange die physische Grundlage sie aufweise. In der Beschreibung des physikalischen Determinismus greift Bergson zudem auf ein Bild von Laplace zurück (ohne dessen Namen jedoch zu nennen):
„[D]er Mathematiker, der die Position der Moleküle oder Atome eines menschlichen Organismus in einem gegebenen Moment sowie die Position und die Bewegung aller Atome des Universums kennen würde, die in der Lage sind, diesen zu beeinflussen, würde mit unfehlbarer Präzision die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Handlungen der Person, der dieser Organismus angehört, berechnen, so wie man ein astronomisches Phänomen vorhersagt“ (Bergson 2016, 128).
Dies ist jedoch eine besondere, nämlich epistemische Formulierung des physikalischen Determinismus. Durch den implizierten Bezug auf den Geist eines Erkenntnis subjekts wird diese epistemische Spielart des physikalischen Determinismus letztlich wiederum psychologisiert. Das scheint ein unnötiger und problematischer Schritt für den physikalischen Determinismus zu sein.
Der psychologische Determinismus ist die These (abstrakter als im obigen Zitat definiert), dass psychologische Zustände (oder besser: Ereignisse4 ) einander determinieren. Bergson erscheint die dieser Form von Determinismus zugrunde liegende Konzeption der Psyche als atomistisch und assoziationistisch (vgl. Sinclair 2020, 67), da mentale Zustände darin als isolierte Einheiten gelten, die sich verknüpfen lassen, aber keine interne Relationalität aufweisen. Dies widerspricht seinem phänomenologisch fundierten Verständnis der Dauer, da dadurch konzeptuell eine Verräumlichung des Mentalen stattfindet (vgl. ebd., 69). Mark Sinclair bringt davon ausgehend Bergsons fundamentale Kritik an jeglicher Form von Determinismus auf den Punkt: „Given that psychical life is a qualitative multiplicity, quality without quantity, there is no repeatable element within it that could serve as the basis of a causal law describing necessary relations between causes and effects“ (ebd.). Hier wird die absolute Singularität mentaler Ereignisse angesprochen, die Gesetzmäßigkeiten ausschließt (vgl. Bergson 2016, 175 f, 192, 204). Nehmen wir folgende Erklärung von Geert Keil zu Hilfe:
„Wenn die Relata der Kausalbeziehung Ereignisse sind, dann können Kausalgesetze nicht von beliebigen Gegenständen handeln, sondern nur von Veränderungen in der Zeit.5 Kausale Gesetze sind demnach keine Koexistenzgesetze (Zustandsgesetze), sondern Sukzessionsgesetze (Verlaufsgesetze). Im Vorder- und Nachsatz eines Sukzessionsgesetzes werden aufeinanderfolgende Geschehnisse beschrieben, in einem Koexistenzgesetz hingegen Zustände oder Größen, die gleichzeitig oder gar zeitlos bestehen.“ (Keil 2015, 168)
Wenn die Typisierung (als Form der Abstraktion) von Ereignissen (als token) für Sukzessionsgesetze nicht legitim ist und der Begriff des ,Gesetzes‘ eine Allgemeinheit implizieren soll, deren Extension mehr als einen besonderen Fall umfasst, kann es sinnvollerweise keine Kausalgesetze geben. Jedoch sollte auch angemerkt werden, dass Bergson ein problematisches Verständnis des ,Kausalprinzips‘ pflegt (vgl. Bergson 2016, 178), denn er nimmt - ohne Begründung - an, dieses weise einen nomologischen Charakter auf, womit er mehr Kant als den Empiristen nahesteht (vgl. Keil 2001). Die gesetzmäßige Verknüpfung von Ursache und Wirkung ist jedoch keine notwendige Bedingung für den Begriff der Kausalität. Es hätte Bergson daher geholfen, zwei verschiedene Manifestationen von Notwendigkeit zu unterscheiden: Ursache-Wirkung-Relation und Naturgesetze. Der Notwendigkeit des Kausalprinzips, wie er es versteht, stellt Bergson die Kontingenz der Dauer entgegen (vgl. Bergson 2016, 189), wobei zu beachten ist, dass zwar alle zufälligen Ereignisse kontingent sind, aber nicht alle kontingenten Ereignisse zufällig (von Bergson also kein aleatorischer Ansatz wie der von Lukrez vertreten wird, dem zufolge sich letztlich das Freiheitspotenzial auf Bewegungsmöglichkeiten im Raum reduziert). Letztlich baut Bergson seine graduelle und expressivistische Konzeption von Freiheit darauf auf (die angesichts der Prämissen nicht unbedingt naheliegt): Freiheit besteht im Verhältnis des Ich zu dessen Akt und umso mehr sich das Selbst im Akt ausdrückt, desto freier ist er (vgl. ebd., 192; Sinclair 2020, 74). Dieses Verhältnis ist undefinierbar. Definiert man es, was Analyse voraussetzt, verräumlicht man die Dauer und muss man dem Determinismus recht geben (vgl. Bergson 2016, 200 f.). Daher spricht Bergson auch nur vage vom ,Emanieren‘ des Akts. Die Vermutung liegt nahe, dass Bergson das Verb ,emanieren‘ verwendet (wie aus dem sprachlich/kognitiv nicht erfassbaren, weil nicht gegenständlichen Einen‘ bei Plotin), weil er das Zustandekommen von Akten aus der Durée heraus nicht genauer erklären kann. Bergson geht es mehr um Authentizität (negativ gesprochen: Freiheit vom Heideggerschen Man) als um die metaphysische Frage nach der Willensfreiheit (obwohl die Klärung letzterer Bedingung dafür ist, dass erstere nicht bloß Schein ist).6 Wir finden bei Bergson demnach, wie bei Lukrez, eine inkompatibilistische Theorie der Freiheit, die jedoch anders geartet ist und die in gewisser Hinsicht aufgrund fundamental anderer Prämissen das Thema wechselt, weil sie sich gezwungen sieht, aus dem geläufigen Diskurs zwischen Deterministen, Kompatibilisten und Libertariern auszubrechen. Ob dies an bestimmten Fehlern oder Missverständnissen Bergsons liegt oder nicht, kann an dieser Stelle nicht mehr geklärt werden und sei nur als mögliches Forschungsdesiderat für weitere Untersuchungen genannt. Um ein vollständigeres Bild von Bergsons Verhältnis zu Lukrez zu gewinnen, müssten ferner weitere Schriften bzw. Vorlesungen Bergsons (die teilweise, wie seine Kommentare in der Lukrez-Edition, noch nicht übersetzt wurden) in die Untersuchung einbezogen werden.
Literaturverzeichnis
Baskin, Wade: Preface, in: Henri Bergson: The Philosophy of Poetry: The Genius of Lucretius. New York: Philosophical Library, 1959, 1-11.
Bergson, Henri: Zeit und Freiheit. Versuch über das dem Bewußtsein unmittelbar Gegebene. Hamburg: Meiner, 2016.
Keil, Geert: Wo hat Kant das Prinzip vom nomologischen Charakter der Kausalität begründet?, in: Rolf-Peter Horstmann; Volker Gerhardt; Ralph Schumacher (Hg.): Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. Bd. IV. Berlin/New York: De Gruyter, 2001, 562-571.
Keil, Geert: Handeln und Verursachen, 2. Auflage. Frankfurt am Main: Klostermann, 2015.
Keil, Geert: Willensfreiheit, 3. Auflage. Berlin: De Gruyter, 2017.
Lukrez: Über die Natur der Dinge, übersetzt von Klaus Binder. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2017. [Zitiert als ,DRN‘]
Lukrez; Bergson, Henri: Extraits de Lucrèce. Paris: Delagrave 1884. [Zitiert als ,Bergson 1884‘]
Sinclair, Mark: Bergson. London/New York: Routledge, 2020.
[...]
1 Jedoch nicht in dem Sinne, in dem heutzutage in der Wissenschaftstheorie von ,Mechanismen‘ die Rede ist.
2 Die Willensfreiheit ist eine (positive) Freiheit zu etwas und nicht mit der (negativen) Freiheit von etwas automatisch gegeben. Das clinamen impliziert aufgrund seiner Zufälligkeit zwar - meiner Ansicht nach - zumindest eine (subjektunabhängige) Freiheit vom Determinismus, kann aber weder die Tatsache der Freiheit zu etwas begründen noch die Unmöglichkeit der Freiheit zu etwas ausschließen.
3 Diese Voraus-Setzung ist aber auch im genealogisch-psychologischen Sinne in Bezug auf den Prozess der philosophischen Theoriebildung zu verstehen.
4 Ereignisse sind ontologisch gesehen die besseren Kandidaten für kausale Relata, wie Geert Keil herausgearbeitet hat (Keil 2015, 170 f.). Sie sind „lokalisierte, datierte und insofern unwiederholbare [...] [Einzel]vorkommnisse“ (ebd., 167).
5 Es geht hierbei um die konkrete Zeit, nicht um die (mathematische) Abstraktion von Zeit punkten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Inhalt"?
Der Text "Inhalt" ist eine akademische Analyse, die sich mit dem Verhältnis von clinamen und Willensfreiheit bei Lukrez, insbesondere in seinem Werk De rerum natura, auseinandersetzt. Er analysiert auch Henri Bergsons Interpretation von Lukrez und dessen Kritik am Determinismus.
Welche Hauptthemen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung umreißt die Schwerpunkte der Analyse: die Verortung von Lukrez' Position innerhalb der aktuellen Willensfreiheitsdebatte, die Relevanz der Willensfreiheit für die epikureische Ethik, und die Beziehung zwischen Lukrez' Ansatz und Bergsons Lukrez-Interpretation sowie Bergsons Kritik am Determinismus.
Was sind die Ursachen der Bewegung nach Lukrez?
Lukrez nennt drei Ursachen für die Bewegung der Urelemente: Schwere, Stoß und clinamen (zufällige Abweichung). Die Schwere ist eine innere Kraft, während der Stoß eine äußere Kraft darstellt. Das clinamen gewährleistet die unaufhörliche Bewegung, selbst wenn Schwere und Stoß nicht wirken.
Was ist das clinamen und welche Rolle spielt es?
Das clinamen ist die zufällige, spontane Abweichung der Teilchen von ihrer Bahn. Lukrez sieht es als notwendig an, um die Kollision von Teilchen und die Formung komplexerer Körper zu ermöglichen. Es wird auch als Grundlage für die Willensfreiheit des Menschen betrachtet.
Wie begründet Lukrez die Willensfreiheit?
Lukrez argumentiert, dass die Willensfreiheit notwendig ist, um die epikureische Ethik zu begründen, die Selbstbeherrschung und die Optimierung der Lust (Abwesenheit von Schmerzen) anstrebt. Er sieht das clinamen als mechanistische Erklärung für die Möglichkeit freier Handlungen.
Welche Arten von Freiheit werden im Text unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen positiver und negativer Freiheit, Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Positive Freiheit ist die Freiheit zu etwas, während negative Freiheit die Freiheit von etwas ist. Willensfreiheit bezieht sich auf die Fähigkeit, seinen Willen frei zu bilden, während Handlungsfreiheit die Freiheit ist, das zu tun oder zu lassen, was man will.
Was ist Determinismus und wie steht Lukrez dazu?
Determinismus ist die Vorstellung, dass alles von jeher unabänderlich vorherbestimmt ist. Lukrez ist ein Inkompatibilist, d.h. er glaubt, dass Determinismus und Willensfreiheit unvereinbar sind. Er führt das clinamen ein, um einen Spielraum für freies Verhalten zu schaffen.
Wie bewertet der Text Lukrez' Begründung der Willensfreiheit?
Der Text kritisiert Lukrez' Begründung des freien Willens durch das clinamen als problematisch, da der Zufall ebenso wie der Determinismus keine Freiheit im Sinne autonomer Kontrolle ermöglicht. Es wird eine Inkohärenz zwischen epikureischer Physik und Ethik festgestellt.
Was ist Bergsons Interpretation von Lukrez?
Henri Bergson hat ausgewählte Passagen aus De rerum natura ediert und kommentiert. Er sieht das clinamen als Versuch, die Zusammenkunft von Atomen zu erklären und die Freiheit des Menschen zu begründen. Er interpretiert Lukrez' Text als von Melancholie und Mitleid durchdrungen.
Wie kritisiert Bergson den Determinismus?
Bergson kritisiert den physikalischen und psychologischen Determinismus in seinem Werk Zeit und Freiheit. Er argumentiert, dass die Reduktion von Bewusstseinszuständen auf physikalische Prozesse und die atomistische Konzeption der Psyche zu einer Verräumlichung der Dauer führen und somit die Freiheit untergraben.
- Arbeit zitieren
- Martin Scheidegger (Autor:in), 2023, Lukrez und Bergson über Determinismus und Freiheit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1324620