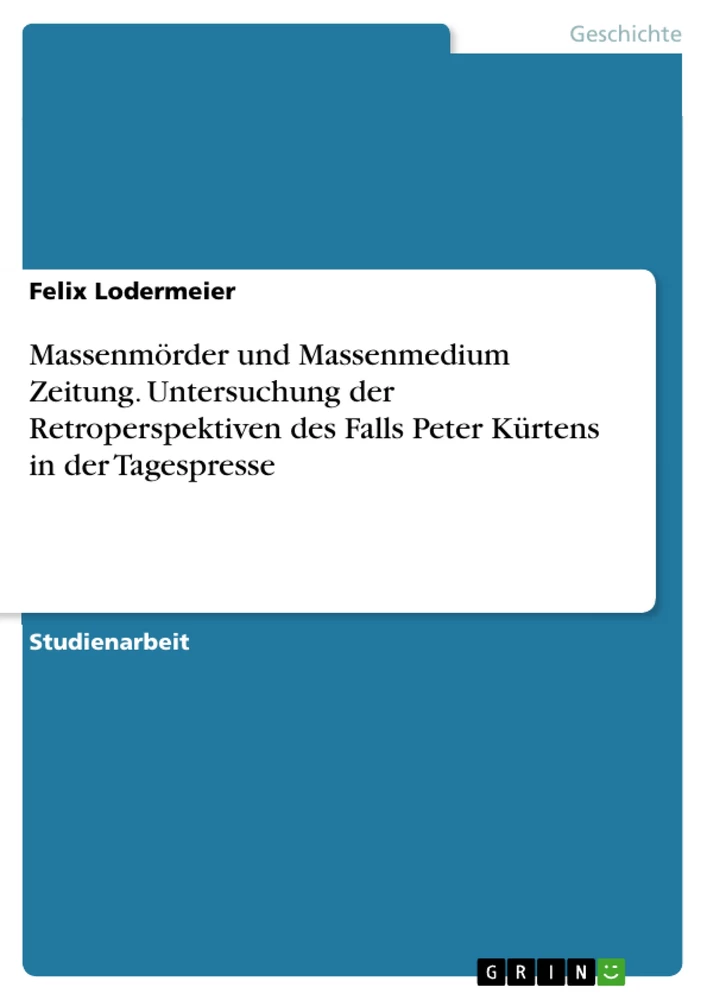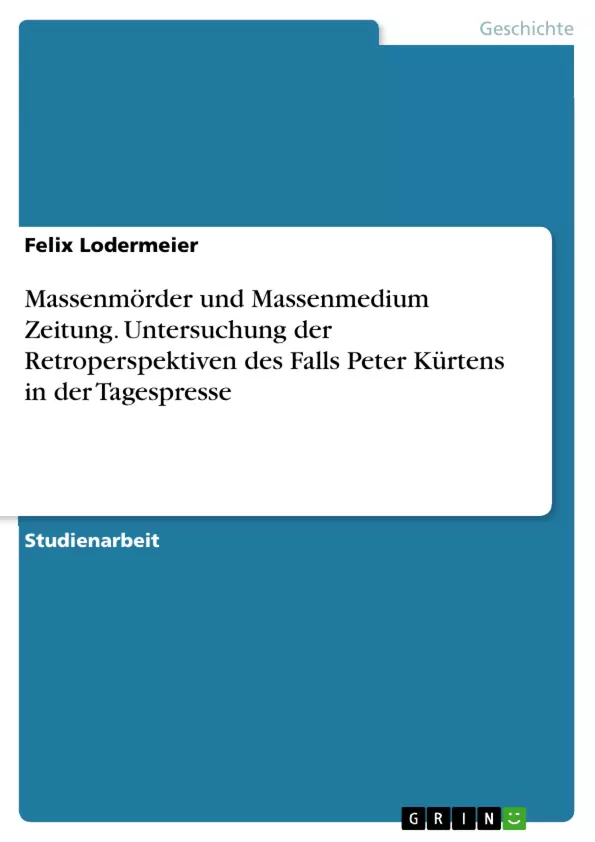In der vorliegenden Hausarbeit soll daher exemplarisch das retroperspektive Wiederaufgreifen der Taten Peter Kürtens durch die (über-)regionale Tagespresse, im Zeitraum von 1930 bis 2021, untersucht werden. Dafür wurden Beiträge verschiedener Zeitungen stichprobenartig ausgewählt. Von diesen wird ausschließlich der schriftliche Teil analysiert. Dabei soll der Fragestellung auf den Grund gegangen werden, wieso die Fälle berühmter Gewaltverbrecher uns immer wieder in Tageszeitungen begegnen und ob sie dabei Konjunkturen oder Veränderungen unterworfen sind.
Im zweiten Kapitel, welches in thematische Unterkapitel geordnet und chronologisch aufgebaut ist, werden daher die Texte, nach einer kleinen Erklärung zur Stichprobenwahl, formal untersucht. Indem Zeitpunkt der Veröffentlichung, Platzierung und der Anlass für die Retroperspektive, sowie die Art und Weise des Erzählens, genauer beleuchtet werden. So wird bei Letzt genanntem ein besonderes Augenmerk auf inhaltliche Schwerpunkte, die Bezeichnung des Täters und sprachliche oder sonstige Auffälligkeiten in den Beiträgen gelegt. Im nachfolgenden dritten Kapitel wird eine zweite allgemein vergleichende Analyse aller Artikel stattfinden, die die Konjunkturen und Veränderungen ergründet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Textanalyse
- Tagesaktuelle Berichterstattung
- Teil einer Fallreihe
- Kurze Rückblicke
- Buchbesprechungen
- Zeitzeugengespräch
- Allgemein vergleichende Analyse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Primärquellen
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht retrospektiv die Berichterstattung über den Fall Peter Kürtens in der überregionalen Tagespresse von 1930 bis 2021. Ziel ist es, die Gründe für das wiederkehrende Interesse der Presse an berühmten Gewaltverbrechen zu beleuchten und mögliche Veränderungen in der Berichterstattung über die Zeit zu analysieren.
- Formale Analyse der Berichterstattung über Peter Kürten in verschiedenen Zeitungen
- Untersuchung der Konjunkturen und Veränderungen in der retrospektiven Berichterstattung über den Fall
- Analyse der sprachlichen und inhaltlichen Schwerpunkte der Berichterstattung
- Vergleich der verschiedenen Formen der Berichterstattung (z.B. Nachrichtenartikel, Fallreihen, Buchbesprechungen)
- Bedeutung von Peter Kürten als Symbolfigur für Gewaltverbrechen in der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Peter Kürten als einen der bekanntesten Serienmörder der Weimarer Republik vor und beschreibt die öffentliche Aufmerksamkeit, die sein Fall damals erregte. Die Arbeit untersucht, wie die Taten Kürtens in der Tagespresse über 90 Jahre später immer noch rezipiert werden. Die Forschungsfrage befasst sich mit dem Grund für die nachhaltige Präsenz von Gewaltverbrechen in den Medien und untersucht, ob Veränderungen in der Berichterstattung erkennbar sind.
Formale Textanalyse
Dieses Kapitel analysiert die formalen Merkmale der Berichterstattung über Peter Kürten. Dabei wird auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, die Platzierung und den Anlass für die retrospektive Betrachtung sowie die Art und Weise des Erzählens eingegangen. Die Analyse umfasst sowohl tagesaktuelle Berichterstattung als auch spätere Rückblicke, Fallreihen und Buchbesprechungen. Besondere Aufmerksamkeit wird den inhaltlichen Schwerpunkten, der Bezeichnung des Täters und sprachlichen Auffälligkeiten in den Beiträgen gewidmet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die Themengebiete True Crime, Medien und Public History. Sie befasst sich mit der retrospektiven Berichterstattung über den Fall Peter Kürtens in der Tagespresse und untersucht die Konjunkturen und Veränderungen in der Berichterstattung über die Zeit. Zentrale Begriffe sind dabei: Serienmörder, Medienlandschaft, Sensationalismus, Kriminalitätsgeschichte, Public History, Zeitgeist und Sprache der Medien.
- Quote paper
- Felix Lodermeier (Author), 2022, Massenmörder und Massenmedium Zeitung. Untersuchung der Retroperspektiven des Falls Peter Kürtens in der Tagespresse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1319140