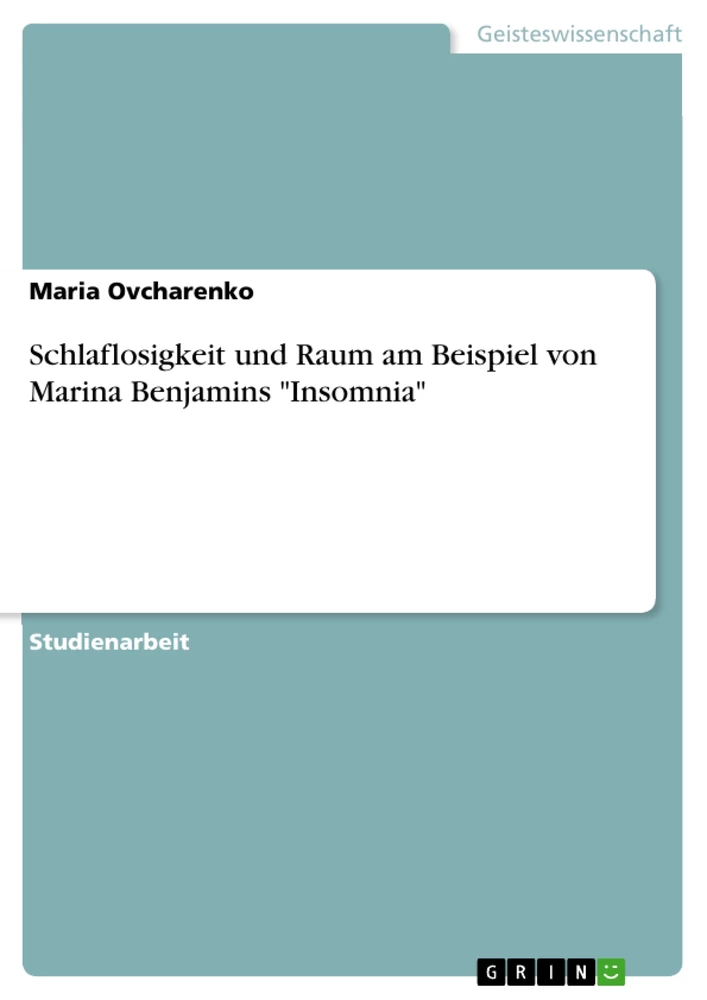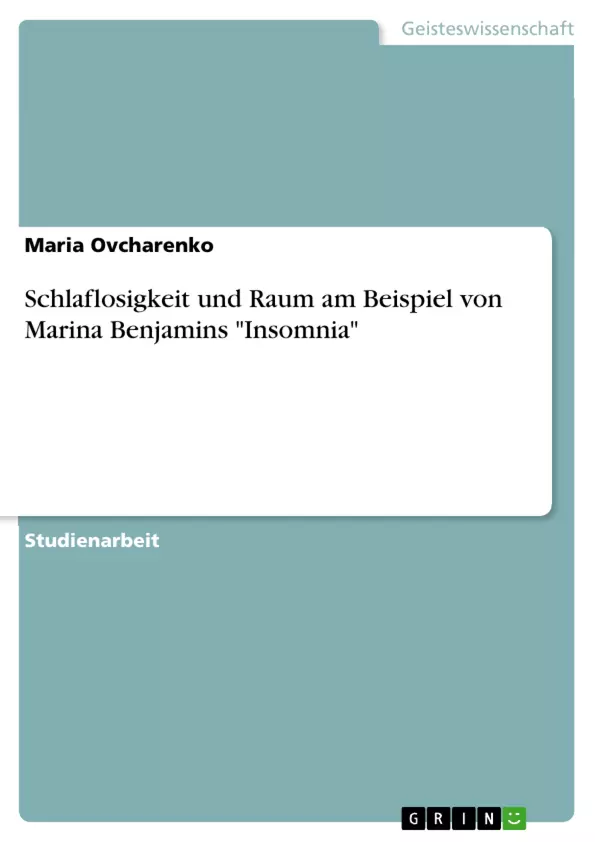Diese Arbeit ist ein Versuch, sich dem Phänomen der Schlaflosigkeit in Verbindung mit diversen Aspekten des Raumdiskurses anzunähern. Im Zentrum der Untersuchung steht das literarische Werk von Marina Benjamin "Insomnia".
Die Autorin nimmt die Lesenden mit auf eine Reise zu ihrer persönlichen Erfahrung mit Schlaflosigkeit, ihren Kämpfen und Beobachtungen. Die Struktur des Buches an sich gleicht einem möglichen Schlaflosigkeitsablauf, bestehend aus diversen, voneinander unabhängigen Gedanken: Die einzelnen Abschnitte enthalten persönliche Berichte, politische Überlegungen sowie Vergleiche aus der Mythologie und aus der Kunst. Außerdem enthält das Buch mehrere Stellen, die In Verbindung mit privaten und öffentlich-kollektiven Räumen sowie der Stellung der Zeit gebracht werden können.
Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wird der Raumbegriff problematisiert, und der Zusammenhang mit der Nacht als Rahmen für die Insomnie wird nachverfolgt. Dabei kann Elisabeth Bronfens Bezeichnung von der Nacht als Zeitraum ins Zentrum gestellt werden. Eine wichtige Eigenschaft von Räumen ist deren Hierarchisierung und Verbindungen mit bestimmten Machtstrukturen. Dabei werden in dieser Untersuchung Michel Foucaults Aussagen in Bezug auf Machtverhältnisse zitiert. Die Nacht als Zeitraum des Schlafens wird im Rahmen des Spätkapitalismus abgewertet. Die Schlaflosigkeit nimmt dabei eine sonderbare Stelle zwischen den bekannten Räumen ein und überschreitet die Grenzen zwischen Schlafen und Wachen, Tag und Nacht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenhang zwischen dem Diskurs des Raums und der Insomnie
- Insomnie und öffentlicher Raum
- Verbindung mit Kolonialisierung und Kapitalismus
- Schlaftherapie
- Insomnie und Raum des Privaten
- Rolle des Bettes in Benjamins Schlaflosigkeitsgeschichte
- „Mind“ und „Unconsciousness“ im Zusammenhang mit Benjamins Insomnie
- Verbindung von Raum und Zeit in Bezug auf Schlaflosigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Schlaflosigkeit im Zusammenhang mit dem Raumdiskurs am Beispiel von Marina Benjamins Werk „Insomnia“. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Schlafentzug, privaten und öffentlichen Räumen, sowie Zeitlichkeit zu erforschen und zu analysieren, wie Insomnie als ein Zustand des Verlangens nach Schlaf die Grenzen zwischen Tag und Nacht verschwimmen lässt.
- Der Diskurs des Raums und seine Relevanz in der Insomnie-Erfahrung
- Die Verbindung von Insomnie mit Kapitalismus und Kolonialisierung
- Die Rolle des Bettes und des privaten Raums in der Bewältigung von Schlaflosigkeit
- Die Zeitlichkeit der Insomnie und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Welt
- Die Auseinandersetzung mit dem Unbewussten im Kontext der Schlaflosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Schlaflosigkeit ein und stellt die Bedeutung von Marina Benjamins „Insomnia“ als Quelle für die Untersuchung dar. Es beleuchtet die vielschichtigen Aspekte der Schlaflosigkeit und ihre Potenziale als künstlerische und existenzielle Ressource.
Das zweite Kapitel untersucht die Verbindung zwischen dem Raumdiskurs und der Insomnie. Es analysiert die komplexe Beziehung zwischen Raum und Ort und verdeutlicht, wie die Nacht als Zeitraum der Insomnie als ein Raum der Unordnung und Vieldeutigkeit verstanden werden kann.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum und seiner Verbindung zur Insomnie. Es beleuchtet die Verbindung zwischen Schlaflosigkeit und dem Spätkapitalismus sowie die passive Rolle des Subjekts im medizinischen Raum.
Das vierte Kapitel fokussiert auf den privaten Raum und seine Bedeutung für die Insomnieerfahrung. Es untersucht die Rolle des Bettes als Zentrum des nächtlichen Zeitraums und die Isolation des Individuums durch den Schlafentzug. Darüber hinaus betrachtet es die Konfrontation mit dem Unbewussten als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Schlaflosigkeit.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Insomnie, Raum, Zeit, Schlaf, Nacht, öffentlicher Raum, privater Raum, Kapitalismus, Kolonialisierung, Unbewusstes, Bett, Zeitlichkeit, Marina Benjamin, „Insomnia“.
- Quote paper
- Maria Ovcharenko (Author), 2022, Schlaflosigkeit und Raum am Beispiel von Marina Benjamins "Insomnia", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1319102