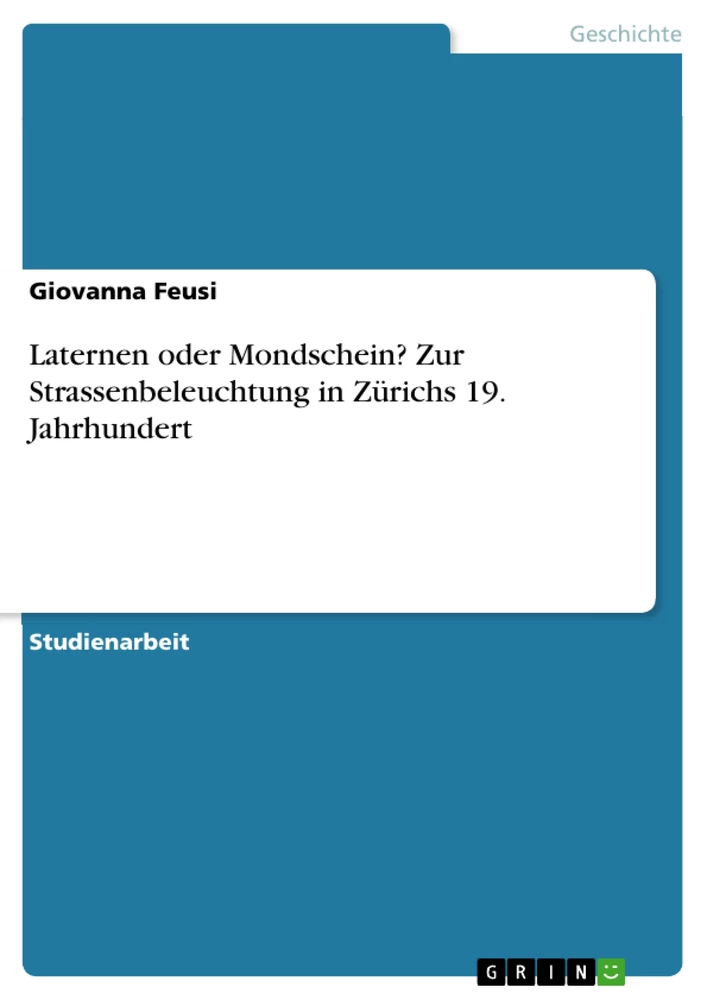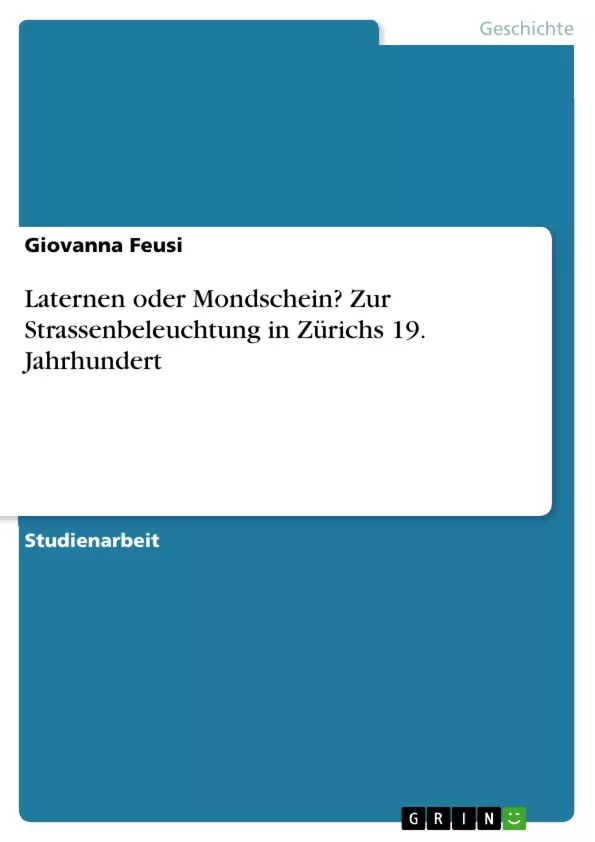Die öffentliche Beleuchtung der Straßen wird in Zürich vergleichsweise spät eingeführt: Erst 1806 mit wenigen Öllaternen und ab 1856 durch Gaslaternen, welche vom ersten Gaswerk versorgt wurden. Da die nächtliche Beleuchtung von Zeitgenossen einerseits als dürftig und ungenügend, andererseits auch als teuer und überflüssig bewertet wurde, interessiert in dieser Arbeit die Organisation der Straßenbeleuchtung – die Reglemente und Kontrollaufsicht einerseits und die Situation der Laternenanzünder andererseits.
Quellen zur Organisation und Durchführung und zur Rezeption der Straßenbeleuchtung sind im Stadtarchiv Zürich gut fassbar; die Situation der Arbeitenden wird jedoch erst ab dem späten 19. indirekt durch Zeitungsartikel z.B. über Lohndiskussionen und später durch Erinnerungen von Laternenwärtern greifbar.
Die Arbeit als Laternenanzünder war eine strenge, schlecht bezahlte und vom «Publikum» auch schlecht honorierte Arbeit – im "Sandwich" zwischen Anforderungen an lückenlos erhellte Nächte und der eigenen Gesundheit.
Inhaltsverzeichnis
Laternen oder Mondschein? Strassenbeleuchtung in Zürichs 19. Jahrhundert
Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Die Stadt Zürich im 19. Jahrhundert
Licht in der Nacht für Zürich: Die Anfänge
Um 1850: Aufbruchstimmung in Zürich
1856: Die Einführung der Gasbeleuchtung
Licht-Qualität oder -Quantität?
Und die Laternenanzünder?
Ausblick: Die Zeit des Gaswerkes als städtisches Unternehmen
Fazit
Bibliografie
Forschungsliteratur
Lexikonartikel
Quellen
Abbildungen
Anhang: Handschriftliche Archivquellen, Auswahl
Anhang: Zusätzliche Bilder, Quellen und Informationen
Zusammenfassung
Die öffentliche Beleuchtung der Strassen wird in Zürich vergleichsweise spät eingeführt: Erst 1806 mit wenigen Öllaternen und ab 1856 durch Gaslaternen, welche vom ersten Gaswerk versorgt wurden. Da die nächtliche Beleuchtung von Zeitgenossen einerseits als dürftig und ungenügend, andererseits auch als teuer und überflüssig bewertet wurde, interessiert in dieser Arbeit die Organisation der Strassenbeleuchtung - die Reglemente und Kontrollaufsicht einerseits und die Situation der Laternenanzünder andererseits.
Quellen zur Organisation und Durchführung und zur Rezeption der Strassenbeleuchtung sind im Stadtarchiv Zürich gut fassbar; die Situation der Arbeitenden wird jedoch erst ab dem späten 19. indirekt durch Zeitungsartikel z.B. über Lohndiskussionen und später durch Erinnerungen von Laternenwärtern greifbar.
Die Arbeit als Laternenanzünder war eine strenge, schlecht bezahlte und vom «Publikum» auch schlecht honorierte Arbeit - im «Sandwich» zwischen Anforderungen an lückenlos erhellte Nächte und der eigenen Gesundheit.
Die Arbeit umfasst 37'650 Zeichen ohne Inhaltsverzeichnis, Bibliografie und Anhang.
Einleitung: Die Stadt Zürich im 19. Jahrhundert
Das 19. Jahrhundert war eine Zeit unglaublich grosser Umwälzungen in politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. Zu Beginn des Jahrhunderts erst wurde die Landschaft der Stadt rechtlich gleichgestellt, die Stadt öffnete sich; sichtbar durch den stufenweisen Abbau der massiven Schanzen und der Öffnung der Tore, durch den öffentlich unterstützen Bau von Repräsentationsgebäuden, Boulevards und Promenaden am Fluss und am See und nicht zuletzt durch den grundlegenden Umbruch von Industrie und Handel.
An einem kleinen Ausschnitt des öffentlichen Lebens, der Strassenbeleuchtung soll dieser Umbruch «beleuchtet» werden. «Beleuchtung» ist in dieser Epoche allerdings nicht nur materiell gemeint: Wer in Schweizer Zeitungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach diesem Stichwort sucht, findet das Wort häufig in einem heute ungewohnten Zusammenhang: «Beleuchtung» bedeutet Erklärung, Information, Erläuterung, auch im Sinn von Einladung zur öffentlichen Debatte über ein Thema. «Beleuchtung» wird geradezu zur Metapher der Zeit, zum Zeichen des gleichberechtigten Informations- und Entscheidungsanspruches der (männlichen) Bürger dieser Zeit.
Ziel dieser Arbeit ist aber nicht dieser Aspekt des Themas, sondern «Beleuchtung» ganz auf der materiellen Ebene: Beleuchten möchte ich, wie das öffentliche Zürich die «Nacht zum Tag» gemacht hatte, wie die einzelnen Schritte dazu verliefen, was die Schwierigkeiten und die Missverständnisse in der Organisation und Kommunikation zwischen Kundinnen und Kunden, Stadt und Lieferanten waren. Ursache der häufig nicht erfüllbaren Erwartungen lagen auch in der zu dieser Zeit ganz neuen, sich erst entwickelnden Gas-Technologie.
Die Forschungsliteratur zu Strassenbeleuchtungen in der Schweiz beschäftigt sich nicht oder nur am Rande mit den sozialen Dimensionen und der Organisation der konkreten Arbeit an den Laternen. Eine Ausnahme davon ist die Arbeit «Nacht-Leben» von Christian Casanova: Casanova beschreibt alle erdenklichen Facetten des Nachtlebens von der frühen Neuzeit bis zur Periode der Öllampen-Beleuchtung von Zürich1.
Zu den Verhältnissen nach 1850, also zur Gasbeleuchtung habe ich vor allem Quellen herangezogen: zum einen Zeitungsartikel, zum anderen gedruckte und handschriftliche Akten aus dem Stadtarchiv Zürich. Technische Details der Produktion, Speicherung, Verteilung von Leuchtgas, die Lampenkonstruktion ist ausführlich im Werk von Hugo Strache beschrieben, welches die Kenntnisse darüber etwa um 1900 zeigt.2
In den Polizei-Akten3 des Stadtarchivs sind vor allem für Perioden, in denen die Stadt die Besorgung der Beleuchtung extern vergab, detaillierte Reglemente für Laternenanzünder, für «Controleure» und Polizeidiener abgelegt. Es fanden sich tägliche Beleuchtungsrapporte und Abrechnungen über die offensichtlich beträchtlichen Kosten der Ölbeleuchtung von 1806 bis 1856 als auch der Gasbeleuchtung. Von grossen und nicht immer erfüllten Erwartungen an ein erhelltes Nachtleben geben Beschwerdebriefe an den Polizeipräsidenten und Tageszeitungsartikel Zeugnis.
Magerer ist die Quellenlage zu konkreten Erfahrungen der Menschen, welche in diesem «Sandwich» von widersprüchlichen Erwartungen an den Beleuchtungs-«Service public» ihre Arbeit taten. Erst im Rückblick, Mitte des 20. Jahrhunderts beschreiben einige Zeitungsartikel die «guten alten Zeiten» des Gaslichtes durch Lebenserinnerungen von Laternenanzündern.4 Interessant ist die Idee, dass diese Zeit der Gaslaternen eine Gemächliche gewesen sei; wenn man aber die konkreten Reglemente und Kontrollrapporte liest, zieht man daraus einen anderer Schluss.
Licht in der Nacht für Zürich: Die Anfänge
Um 1800 waren die Nächte der Stadt Zürich nach Sonnenuntergang stockdunkel - ausser dem Mond und privaten Laternen erhellte nichts die Gassen. Das wurde auch nicht als notwendig erachtet, denn Einheimische hatten nachts eine eigene Laterne dabei, und für Fremde waren die Stadttore geschlossen. Erst ab 1830 gab es als grosse Neuerung die Möglichkeit, die ganze Nacht Einlass in die Stadt zu bekommen - gegen ein Sperrgeld von mindestens 2 Schilling, ab 23 Uhr 4 Schilling.5
Dann, nach den Wirren der Helvetischen Republik, nach Entstehung des eidgenössischen Kantons und der schrittweisen Etablierung der Stadt-Land-Gleichberechtigung ab 1803 wollte die Enge der dunklen, sich sogar gegen den See verschanzten Stadt nicht mehr passen. Eine der «modernen» Ideen war der Wunsch nach erhellten Strassen: 1806 beschloss die Stadt, Öllaternen aufzuhängen und verpachtete den Betrieb der Strassenbeleuchtung.6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Über der Strasse aufgehängte Öllaterne in Zürich. Quelle: «Das Katzenthor, mit seinen Umgebungen nach der Natur gezeichnet.»
Öllichter waren nicht einfach zu betreiben: Lampenöl7 musste nachgefüllt, der Docht geputzt und eingestellt werden, andernfalls verrusste die Lampe oder löschte vorzeitig aus. Die Öllichter waren an Seilen, oft mittig über der Strasse zwischen zwei Häusern aufgehängt, sodass sie zum Nachfüllen und «Schneuzen» der Dochte herunterlassen werden konnten (siehe Abb. 2). Die Enden der Seile waren in verschliessbaren Holzkästen versorgt, damit sie für Nachtschwärmer nicht zugänglich waren.8 Trotzdem gab es immer wieder Probleme: Im Tagesrapport vom 31. Dezember 1851 und vom 1. Januar 18529 schreibt der Pächter des «Beleuchtungsmanagements»:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Heute gegen Morgen wurde das Seil v. No 171 durchgeschnitten, wodurch die Laterne zu Boden fiel, die 5 Scheiben zertrümmert & das Gestell ebenso eingedrückt wurde. Cilinder- & (Tropfglas) blieben dagegen unversehrt. () wurde diese Lat. durch eine überzählige remplacirt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
An vorletzter Nacht sind ferner an No 151 (Bb. Brücke) 1 [eine] & [an] No 29. (Kaufhaus) 2 Seitenscheiben eingeschlagen worden.
Der Pächter, Hans Wirz10 Sehr hell war diese Beleuchtung nicht, etwa vergleichbar mit einfachen Kerzen. Schon bald gab es Klagen über zu spät oder gar nicht angezündete Beleuchtung - schliesslich musste man seit der Einführung 1807 pro Haushalt eine eigens eingeführte «Beleuchtungssteuer» bezahlen. Vermögende Familien sowie Wirtshäuser, welche von der Beleuchtung profitierten, wurden zusätzlich zu einer «freiwilligen Beitrag» angehalten, zu welchem man sich für 6 Jahre verpflichtete.11 Ausführlich geht Casanova auf die Klagen zur mangelhaften Ölbeleuchtung und die Verbesserungsversuche ein.12
Um 1850: Aufbruchstimmung in Zürich
Handelsreisende Zürcher hatten bestimmt die mit Gaslaternen hell erleuchteten europäischen Grossstädte besucht und sich über die wenigen, kümmerlichen «Pfun- zeln» ihrer Heimatstadt gewundert oder geärgert: London hatte seit 1812, Paris seit 1821 eine öffentliche Strassenbeleuchtung aus Steinkohle-Gas. Doch das Risiko dieser absolut neuen Technologie wurde in der ersten Hälfte des 19. Jhr. noch nicht gewagt: Wie kann man gasförmige Stoffe speichern? Welche Rohre, Ventile, Hahne sind wirklich dicht13 und wie bannt man die Explosionsgefahr? Konservative Kreise befürchteten Zunahme von Trunkenheit, Verbrechen und Zunahme der Prostitution.
Einige Verbesserungen, nämlich pünktlichere, vollständigere und billigere Helligkeit der Ölbeleuchtung erhoffte man sich1850 mit der Verpachtung des städtischen Laternenmanagements14 und dessen strengen Kontrolle: Zur Überwachung der Einhaltung des Pachtvertrages wurden eigens ein «Controleur» angestellt, und die Polizeidiener wurden angehalten, in ihren mehrfachen nächtlichen «Ronden» jede Laterne zu kontrollieren und Meldung über Defekt, über zu frühes Anzünden oder zu spätes Löschen zu erstatten. In zweiseitigen Tagesrapporten15 (siehe Abb. 3 und 4) wurde festgehalten, wie die Strassenbeleuchtung «funktionierte»:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Beispiel eines Tagesrapportes der Beleuchtungskontrolle: Seite 1 des Rapportes Nr. 1 vom 1. Januar 1851, StadtAZ V.E.c.10.:3
Im ersten Abschnitt der Rapporte (siehe Abb. 3) setzte der Controleur die Beleuchtungsdauer für jeden Tag neu fest: Die 226 «halbnächtigen» Laternen sollten an diesem 1. Januar von 16:45 Uhr bis Mitternacht und die 7 «ganznächtigen» Laternen ebenfalls von 16:45 Uhr bis morgens um 5 Uhr brennen. Das Theater (damals in der ehemaligen Barfüsserkirche an der «Unteren Zäune») wurde nur bis 23 Uhr beleuch- tet. An Markttagen,16 für öffentliche Bauten oder auf Antrag (!) und Rechnung von Privaten konnten zusätzliche Beleuchtungszeiten angeordnet werden.
Im Abschnitt «Dienstvorrichtungen» kommentierte der Controleur die Beleuchtung, z.B. am 1. Januar 1851:
[Gedruckt:] b. Meldung über das Beleuchtungspersonal im Allgemeinen, und über Schädigungen durch dieselben im Besondern.
[Handschriftlich:] Da das Beleuchtungspersonal ganz neu ist, so läßt sich hierüber in der ersten Zeit noch nicht viel sagen, hingegen scheint mir, es seien allerdings zu wenig Angestellte, die das Anzünden zu besorgen haben.
Von den Nachtwächteraufseher habe keinen Rapport erhalten, auch von den Polizeidiener kann ich über ihr Rapportwesen nichts weiteres mittheilen was zuvor der Herr Polizeicommisair nicht schon mitgetheilt haben.
Der Kommentar zur Nacht vom «31t. Decbr 1860»:
Die Beleuchtung war zu der so stürmischen Witterung so zimmlich befriedigend. Auch (seien) die Anzünder beschäftigt, die vom Winde erloschenen Laternen wieder zu erstellen.
Und ähnlich schrieb der Controleur am 1. Januar 1861:
Die Erstellung der Beleuchtung, so wie auch die Erleuchtung derselben, war sehr Mangelhaft. Allein die so stürmische () regnerische Witterung, () die Ursache davon. Die Anzünder mit denen ich mehr mal zusammentraf, thaten ihr möglichstes, um ausgelöschte Laternen wieder zu erstellen.
Wie bereits beschrieben, machten den Laternenanzündern auch Beschädigungen bzw. unzeitiges Anzünden oder zu frühes Auslöschen von Nachtschwärmern zu schaffen.
Das Verhältnis von Controleur und Polizeipräsident zum Pächter scheint anspruchsvoll gewesen zu sein. Die Anforderungen in stürmischen Nächten sowie die kurzfristig angeordneten ausserordentlichen Beleuchtungen waren nicht einfach zu organisieren. Das zeigt eine ausserordentlich höfliche Bitte des Pächters um frühzeitige Mitteilung über spezielle Anordnungen für den 1. Januar:
Im Fall die Beleuchtung heute durch die ganze Nacht stattfinden soll, bittet der Pächter angelegen um gef. Bericht bis um 12 Uhr (...) Leider sind in diesem Aktenbündel nur die Rapporte vom ersten und letzten Tag der Jahre erhalten - das sind sicher nicht die repräsentativsten Nächte. In den späteren vollständig erhaltenen Tagesrapporten von 1889-1900 sind weniger Reklamationen oder Schäden vermerkt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Beispiel eines Tagesrapportes der Beleuchtungskontrolle: Seite 2 des Rapportes Nr. 1 vom 1. Januar 1851, StadtAZ V.E.c.10.:3
Den Abschluss der Rapporte bildet die Abrechnung über den Ölverbrauch. Dabei wird dem Pächter nicht der tatsächliche Verbrauch entschädigt, sondern ein mutmasslicher Betrag in Abhängigkeit der Beleuchtungsdauer.17
1856: Die Einführung der Gasbeleuchtung
Mittlerweile schien auch in Zürich die Zeit gekommen, die umständliche und wenig effektive Ölbeleuchtung zu überdenken. Die Technologie der Strassenbeleuchtung mit Gas war aus den ersten Kinderschuhen herausgewachsen.18 Ebenso scheint die öffentliche und die obrigkeitliche Meinung gegenüber einem möglichen nächtlichen Strassenleben toleranter geworden zu sein.19
Am 10. Oktober 1854 wurde ein «Bedingungsheft» für die Einführung der Gasbeleuchtung erstellt, welches detailliert die Anforderungen der Stadt festlegte: Fabrikareal, Produktionsausrüstung, (zur Versorgungssicherheit alles in doppelter Ausführung), Anforderung an Rohre, Zweigleitungen, Kandelaber. Ebenso wurde die Anforderungen an Reinigung des Gases von aggressiven Nebenprodukten, die Leuchtkraft, Gaspreis und Rohstoff Holz definiert.20 Aus technischer Sicht fällt auf, dass Angaben zur maximalen Länge des Leitungsnetzes und zum vorgesehenen bzw. nötigen Gasdruck fehlen, ebenso Bestimmungen zu Gasverdichtungsstationen oder Druckregulatoren. Auch werden keine Vereinbarungen zu Anzahl privater Verbraucher getroffen. Diese aus Unkenntnis oder Willkür vergessenen Details im Vertrag sollten schon bald zu bedeutenden Unstimmigkeiten führen.
Im Februar 1856 begutachtete der Stadtrat den favorisierten Bauplatz auf der letzten grösseren Freifläche in der noch kleinen Stadt,21 das Areal der «Bürgergärten» auf der Platzpromenade, welches schon 1847 wegen des Bahnhofbaus verkleinert wurde. Grosser und kleiner Stadtrat und die Bürgergemeinde stimmten zu. Am 23. Juli wurde der Vertrag22 mit Ludwig August Riedinger23 unterzeichnet und bereits am 18. Dezember 1856 leuchteten in Zürichs Strassen, im Theater und in privaten Bürgerhäusern zum ersten Mal Gaslaternen: 436 öffentliche und etwa 3000 private «Flammen», d.h. einzelne Leuchten.24
Die Laternenanzünder wurden vom Gaswerk angestellt und angewiesen - und die Stadt organisierte die Kontrolle: Erstellt wurde ein «Regulativ über die Besorgung und Controllirung der Strassenbeleuchtung25 ». Es gab eine «regelmässige» und eine «ausserordentliche Beleuchtung», beide wurden jeden Tag neu angeordnet. Die Beleuchtungszeiten berücksichtigen nicht nur Sonnenauf- und -untergang, sondern auch den Stand des Mondes: Bei Vollmond wurde nicht oder nur kurz und beschränkt beleuchtet, aber bei voraussehbar schlechter Witterung musste der Controlleur beim Polizeipräsidenten nachfragen, ob trotzdem beleuchtet werden dürfe - und dies musste der Gasfabrik auch noch rechtzeitig, das heisst minimal bis 1 % Stunden vor Beginn der Beleuchtung gemeldet werden. 10 Minuten nach Beginn der definierten Anzündezeit sollten alle Laternen brennen, und das Auslöschen der halbnächtigen Laternen durfte maximal 10 Minuten vor der Löschzeit beginnen.
Die «Pflichtordnung»26 vom 30.12.1856 beschreibt die Aufgaben des Strassenbe- leuchtungs-Controleur: Er musste zu Beginn und zu Schluss der Beleuchtung eine Inspektionstour vornehmen und «Mängel, Unordnung, Nachlässigkeit» der Laternenanzünder rapportieren, ebenso musste er überwachen, ob die Polizeidiener ihre «Laternenronden» vornahmen: Auch diese kontrollierten die korrekte Anzünd- und Löschzeit in der ersten und letzten Viertelstunde der Beleuchtungszeit und meldeten Fehlbares für den Tagesrapport. Ebenso kontrollierten sie die «ganznächtigen» Laternen bis zum Morgengrauen und meldeten ausgelöschte Laternen dem Dienstpersonal der Gasfabrik (welches dann offensichtlich zum Wiederanzünden angehalten war).
Der Controleur beschaffte auch Ersatzmaterial und führte Buch über Anschaffungen und Reparaturen, erstellte jährlich ein Inventar und erhielt als Lohn 1'000 Fr. pro Jahr, musste aber eine «Personal-Kaution» von 2'000 Franken hinterlegen.
Nicht nur an die Gasfabrik und die Angestellten, sondern auch an das Publikum richteten sich Reglemente: Neben detaillierten Anweisungen zu Bau und Verwendung von privater Gasbeleuchtung wurde im September eine Verordnung27 verabschiedet, welche das Erklettern, Hahne öffnen, Anzünden und löschen sowie auch das Anbinden von Vieh an den Kandelabern unter Strafe stellte.
Licht-Qualität oder -Quantität?
Bereits 1857 gab es erste Unstimmigkeiten: Im «Protocoll»-Buch der Aktiengesellschaft ist von «Conventionalstrafen» wegen mangelhafter Beleuchtung die Rede, welche abgestritten werden.28 Am 28.Juni 1858 wurde von einer Strafe von 200 Fr. berichtet (das sind mehr als zwei Monatslöhne des städtischen Controleur29 ), welche mittels eines Schiedsgerichtes geklärt werden soll. Ebenso liest man aber im selben Protokollbuch von Angebotsverhandlungen mit verschiedensten öffentlichen Kunden und Ausgemeinden für zusätzliche Beleuchtungsprojekte.30 Dass der bald erfolgte bedeutende Ausbau des Leitungsnetzes zu Problemen beitrug, das war kein Wunder: Die Leuchtkraft von Gaslaternen ist abhängig vom Gasdruck und von der passenden Mischung mit Luftsauerstoff.
Zwei der vielen Reklamationen seien hier stellvertretend abgebildet: Die erste, ein Zeitungsartikel, betraff die Schwierigkeiten bei Vollmond und unsicherem Wetter. Der Polizeivorstand forderte den Controleur zu einer schriftlichen Stellungnahme auf:31
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[Ausgeschnittener und aufgeklebter Zeitungsartikel ohne Quellenangabe]
Mittheilungen aus dem Publikum.
Offenbar hatten Polizei und Gasgesellschaft am Mittwoch Abend auf Mondschein gerechnet; denn Zürichs Gasbeleuchtung war in der That eigentlich zu suchen. Wer das Unglück hatte, Abends zwischen 7 und 8 Uhr in den volksbelebten Straßen den Weg finden zu müssen, der durfte mit allem Ingrimm ausgerufen haben: Ist das eine Ordnung, ist das die Grossstadt Zürich? Brannte doch nicht einmal der große Gaskandelaber auf dem Paradeplatz. Der nicht angezündeten Laternen waren mehr, als der angezündeten. Die Sache sah bedenklich aus.
Zürich 15.1.86.
Der Polizeivorstand der Stadt Zürich
Die vorstehende Reklamation ist in der Hauptsache vollkommen richtig. Ich habe die Dunkelheit auch bemerkt u. angenommen es wurde diesfalls eine Entschuldigung erfolgen. (...) Hochachtungsvoll (Unterschrift)
Herr Präsident.
Infolge günstiger Witterung bei schon starkem Mondschein glaubte ich ein Ersparniss von ca. 120 Frk machen zu können, habe dann desshalb nur die ganznächtige Beleuchtung angeordnet, welche dann auch bis vor 8 Uhr vollständig genügte, da ich anfangs schon der Witterung nicht recht traute, habe ich dem Chef der Anzünder die Weisung ertheilt, die ganze Beleuchtung müsse vieleicht auf 77 Uhr erstellt werden, welche Weisung ich dann nach 7 Uhr wieder zurückgenommen habe. Indem der Mond zu dieser Zeit sich recht günstig zeigte, freilich noch etwas schwach, auf 8 Uhr wurde der Mond dann bedeutend, durch zwar leichtere Bewölkung, bedeckt, allein ich glaubte dass auch diese Beleuchtung für diese schon spätern Stunden genüge und besonders weil ja 235 Gasflammen ganznächtig brannten, somit beinahe jedes Gässchen und auch die Hauptstrassen zimlich beleuchtet sind, auch eine Aenderung der Beleuchtung hätte erst nach 172 Stunden, also auf 972 Uhr stattfinden können, freilich war die Poststrasse nicht, aber der Paradeplatz zimlich dunkel indem derselbe auch durch günstigen Mondschein nur spärlich beleuchtet ist, und die grosse Gaslaterne bei Mondbeleuchtung nicht angezündet wird. auch war in dieser Strasse der auf derselben liegende Schnee schwärzlich anzusehen, was die Beleuchtung immer bedeutend beeinträchtigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein zweites Beispiel ist ein «Memorial» an den Stadtrat im Namen einiger Privatbezüger,32 welches detailliert die Vermutung aufzeigte, dass das immer ausgedehntere Netz (erwähnt wurde z.B. die Versorgung von Neumünster) und das vetragswidrig aus Steinkohle hergestellte Gas bei den städtischen Privatbezügern zu Mehrverbrauch und gleichzeitig verminderter Lichtstärke führte.
Waren diese Vorwürfe berechtigt? Es scheint tatsächlich so, dass die Zürcher Actien- Gesellschaft für Gas zuwenig Vorkehrungen traf, um die Qualität ihres Angebots zu sichern: In den Akten zur Gasbeleuchtung der Polizei ist eine 8-seitige Expertise eines Ingenieurs H. Gruner aus Basel33 abgelegt, welche aufschlussreich darlegt, was mittlerweile, ca. 1865 über die Gastechnologie bekannt war: Der Gasdruck sei - wenn nicht reguliert, bereits im Gasbehälter («Gasometer»), erst recht in den Leitungen, vor allem in der Peripherie sehr unterschiedlich. Dies habe jedoch Einfluss auf Lichtqualität. Noch problematischer sei, dass die verwendeten Gasmesser die verbrauchte Gasmenge der Haushalte in Abhängigkeit des Druckes und auch der Umgebungstemperatur unterschiedlich messe. Weitere Schwierigkeiten wurden von H. Gruner technisch nachvollziehbar aufgezählt. Es erscheint seltsam, dass innerhalb nur einem Jahrzehnt nach dem Entscheid für die Anlage von Riedinger derart viele technische Parameter sich als falsch oder problematisch herausstellten.
Und die Laternenanzünder?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Ulme und 2 blühende Zwetschgenbäumchen beim Güetli, Schulhausstrasse 18 in Zürich- Enge, Fotografie von Robert Breitinger 1905.
Die Menschen, welche allabendlich ihren Feierabend und ihre Nachtruhe für das Anzünden und Auslöschen der Zürcher Laternen unterbrachen, sind in zeitgenössischen Quellen fast unsichtbar. Nur durch Zufall (so scheint es), kommen sie ins Bild:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Ausschnitt aus Abb. 5: Eine Gaslaterne wird gewartet.
Als 1887 die Stadt das «Laternenmanagement» wieder übernahm (etwa gleichzeitig mit der erfolgten Vergrösserung und Verlegung der Gasfabrik nach Aussersihl), bestimmte sie in einem Reglement34 die Arbeitsbedingungen der Laternenanzünder: Per Los bekamen sie alle zwei Monate ein anderes Revier zugeteilt. Ausgerüstet wurden sie mit Anzündlaterne und Mantel. Sie versammelten sich im Lokal In Gassen 1, wo der Controleur die aktuelle Anzünd- und Löschzeiten im Rapportbuch vermerkt hatte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Tägliche «Beleuchtungsanordnung», StadtAZ V.G.b.527, Seite «Monat Januar 1889», Ausschnitt. Transkription: Monat Jan. 1889.
1. Für die Nacht vom 1/2 Januar 1889 wird die Beleuchtung angeordnet wie folgt: Anzündezeit der halb u. ganznächtigen Laternen 4 3/4 Uhr. Löschzeit der halbnächtigen Laternen 12 Uhr, Löschzeit der ganznächtigen Laternen 6 3/4 Uhr. Der Controleur d. Strassenbel. Brändli.
Der Laternenchef «befiehlt Antritt der Routen», welche «mit thunlichster Schnelligkeit vollzogen werden» soll. Nach Beendigung muss im Lokal Rapport gegeben werden, ebenso nach der ersten Löschtour der halbnächtigen Laternen.
Die durch Los für das Morgenlöschen der ganznächtigen Laternen bestimmten Arbeiter müssen im Lokal übernachten. Sie sind auch zuständig für Anzünden oder Auslöschen im Brandfall. Einige Laternenanzünder sind zusätzlich zu ihrem Nachtdienst auch Laternenputzer oder -besorger: Sie putzen die Laternen, regulieren die Flammen und tauen ggf. die Zuleitungsrohre auf.35
Von ihrem ersten Lohn wird eine «Decompte» von 10 Fr. als Sicherheit abgezogen - und wenn eine Lampe ihres Reviers zu lange brennt, wird ihnen das mit 3 Rappen pro Brennstunde belastet.36
Dass die Laternentouren nicht so einfach durchgeführt werden konnten wie auf Papier beschrieben, davon zeugen zahlreiche Zeitungsartikel und Bemerkungen in Rapporten: Bei stürmischem oder kaltem Wetter löschten die Laternen aus und mussten in vermutlich nicht entschädigten Extratouren wieder angezündet werden.37
Der karge Lohn für die anstrengende Nachtarbeit war immer wieder Thema - in Zeitungsartikeln fassbar werden die Klagen darüber allerdings erst ab 1887, als die Stadt das Gaswerk als städtischen Betrieb übernommen hatte: 1890 wurde in der Sitzung des grossen Stadtrates eine «bessere Löhnung für Laternenanzünder» gewünscht. Aber «Oberstlt. Wirz weist nach, dass diese Leute für ihre Leistung durchaus genügend honorirt werden».38 Im Juli 1893 wurde durch Morf39 erneut eine Erhöhung der «ungenügenden Entschädigung der Laternenwärter» verlangt. Diese hätten eine dementsprechende Eingabe an den Stadtrat gemacht, welche abgewiesen worden sei. Auch andere Redner engagierten sich für höhere Löhne dieser Berufsgruppe; «die Leute haben schwere Arbeit». Stadtrat Usteri erachtete den aktuellen Lohn als gerecht, versprach aber Beratung über eine Revision des Anzünderdienstes.40
Morf liess nicht nach: 1897 sprach er wieder im grossen Stadtrat von Zürich die prekäre Situation der Laternenanzünder an: Grobe Behandlung und Entlassung ohne Kündigung seien üblich.41 Von Klagen weiss der Verwalter des Gaswerkes, Süss nichts - und solche seien auch vorsichtig aufzunehmen. Man werde die Sache untersuchen.
Ein Artikel in der NZZ vom 15. Februar 190642 erhellt die Arbeits- und Lohnverhältnisse der städtischen Arbeiter Zürichs: Handwerker der Gasfabrik bezogen 147 Fr. pro Monat, ähnlich wie übrige Handwerksberufe. Die Laternenanzünder gehörten zu den Taglöhnern und erhielten etwa 2.70 Fr., das sei etwa die Hälfte von anderen Taglohnberufen gewesen.
Ein weiteres Thema im Grossen Stadtrates war die Pflicht zur Übernachtung im Laternenlokal:42 43 44 «Die Laternenanzünder sind nicht zufrieden mit dem zwangsweisen gemeinsamen Nachtquartier.» Der Bauvorstand II entgegnete: «Die Schlafgelegenheit für die Laternenanzünder in Gassen besteht seit 50 Jahren, dreizehn Mann sind je- weilen dahin abkommandiert [...] Auf dem Lokal schlafen gelegentlich auch Freiwillige, also muss es so schlimm nicht sein.»
1912 waren die Arbeiter des Gaswerkes und die Laternenanzünder Vorreiter im «Zürcher Generalstreik»: «[Fritz] Platten hatte die Absicht, die Stadt nachts in Dunkelheit zu hüllen», so lautete es im Bericht der Grossstadträtlichen Kommission über den Streik.44 Mittlerweile hatte also die Versorgung mit Energie und Licht vom Gaswerk ein strategisch wichtiges Gewicht in der Zürcher Wirtschaft erhalten - ohne Gas blieben die Rädchen still, und das wussten beide Seiten im Konflikt.
Bald jedoch verlor das Leuchtgas seine Monopolstellung. Als dann im 1. Weltkrieg die importierte Steinkohle knapp und damit Gas teuer wurde, wurden Strassenzüge und private Haushalte immer häufiger mit elektrischem Licht ausgestattet. Eine weitere einschneidende Einsparung war die Einführung der automatische Zündung: 1919 wurden deshalb 20 Laternenbesorger entlassen. Nur jene davon, welche keinen anderen Verdienst hatten und jung genug waren, wurden weiterbeschäftigt, die «alten» Laternenanzünder erhielten eine Abfindung.45
Und wie beurteilten die Laternenwärter selbst ihre Arbeitsbedingungen? Darüber schweigen zeitgenössische Artikel; erst im Rückblick auf die «gute alte Zeit» wurden die harten Arbeitsbedingungen ein Thema: 1934 berichtete die NZZ darüber:46 Um 1910 seien in Zürich etwa 8'000 Gaslaternen von etwa 44 Anzündern besorgt worden. Sie besammelten sich im «Anzünderlokal» neben der St. Peter-Kirche (immer noch an der Adresse In Gassen 1), nur einige wenige besorgten ihr Revier in den Aussenquartieren von zu Hause aus. An einem Stock trugen sie ein Spirituslicht.47 Die Arbeit wurde meist nebenberuflich ausgeführt, Kleinhandwerker besserten damit ihr Einkommen auf. Die Arbeit sei streng gewesen.
Ausblick: Die Zeit des Gaswerkes als städtisches Unternehmen
Obwohl die Ursachen vieler technischer Probleme mit dem Umzug nach Aussersihl und verbesserter Laternen48 mindestens teilweise gelöst werden konnten, blieb das Verhältnis zwischen Anspruch und Möglichkeiten angespannt.
Der Leiter der Licht- & Wasserwerke, zu der auch das Gaswerk gehörte, ist in seiner an den Polizeivorstand adressierten Stellungnahme zu einer Reklamation wegen ungenügender Beleuchtung des Theaters ziemlich deutlich:49 (...) Der Unterzeichnete befindet sich in diesen Fällen jeweilen in einer höchst peinlichen Lage. Abgesehen davon, daß ich nicht zwei Herren dienen kann, werde ich von einer Wand an die andere geworfen. Ich teilte dem Präsidenten der Theatervorsteherschaft auf deren Reklamation die Verfügung des Herrn Stadtpräsidenten mündlich mit, worauf er erwiderte, ja das wäre ihm sonderbar, es existiren über dieses Verhältniß Vereinbarungen & er wende sich nun an die Polizei. Sodann kommt Ihre Verfügung, die uns anweist anzuzünden. Was haben wir nun zu tun? Wir hätten Sie ersuchen können, den ordentlichen Dienstweg zu gehen, aber das hat in Abwesenheit unseres Präsidenten & Vice-Präsidenten eben seine Schwierigkeit. Wir begnügten uns also, Sie auf unsere gegenteilige Anweisung aufmerksam zu machen & gewärtigen nun Ihre Verfügung in (Sachen). Selbstverständlich werden wir mit nunmehr der Ausführung derselben keinen Augenblick wiedersetzen & braucht es daher des Interventum des Stadtrathes nicht.
Sie werden aber gewiss begreifen, wenn wir sagen, es sei für uns peinlich, heute so & morgen gegentheilig beordert zu werden, dieser Dualismus ist wohl auch kaum geeignet, eine günstige Wirkung nach aussen zu machen.
Was die Notiz des Herrn Commissärs wegen dem Aufreissen der Niederdorfstraße von Unterstraß her anbelangt - es sind 120 Cabelgraben in Arbeit - so haben wir dem Herrn (Stadtingenieur) davon Mittheilung gemacht, eine spezielle Begrüssung der Polizeiorgane ausser bei Verkehrseinstellungen war bisher bei Erstellen von Leitungen nicht verlangt. Wenn der dort stationierte Posten sich der Sache etwas mehr annimmt sind wir dafür sehr dankbar. (M Burkhard-Streuli)
Viele weitere Reklamationen finden sich im «Reklamationenbuch» des Gaswerks, welches für 1897-1907 erhalten ist.50
Fazit
Die Geschichte der Zürcher Strassenbeleuchtung im 19. Jahrhundert zeigt das Arbeitsfeld eines marginalisierten Nebenberufes, welches durch anstrengende Touren im Winter, in stürmischem Wetter und durch die mehrfach unterbrochene Ruhezeit gesundheitlich sehr anspruchsvoll gewesen war. Ebenso belastend muss die Rolle im «Sandwich» von Spot und Ärger der Stadtbewohner wegen ungenügendem Licht und den Ansprüchen der Beleuchtungsgesellschaften gewesen sein. Ein Vergleich anhand sozialhistorischen Studien zu anderen nicht sehr geachteten Arbeitsfeldern wie Dienstmännern, Handlangern, Trägern, Boten und Mägden würde diese Einschätzung ergänzen.
Offen bleiben einige Fragen, zum Beispiel zu arbeitsfreien Nächten. Nirgends ist mir eine Quelle begegnet, welche Sonn- oder Feiertage oder überhaupt freie Tage anspricht. Im Gegenteil, wer sich (ohne Abmeldung z.B. wegen Krankheit) für einen Dienst vertreten liess, wurde sofort entlassen und verlor seine «Decompte», eine Art Kaution51. Haben die Laternenanzünder wirklich keine Nacht durchschlafen können? Diese Frage könnte durch Lohnlisten oder weitere Beleuchtungsrapporte erhellt werden. Solange in Vollmondnächten und im Sommer keine Beleuchtung «stattfand», gab es immerhin etwas Entspannung (aber dann auch keinen Verdienst).
Erhellend wäre zudem, den Hauptberuf und die materielle Situation der Laternenanzünderfamilien zu kennen. Wurde dieser Nebenberuf auch «vererbt»? Darüber gäben evtl. Lohnlisten und weitere Akten Auskunft. Leider gibt es im Stadtarchiv keine direkten Quellen, etwa ein Tage- oder Familienbuch eines solchen Arbeiters. Vielleicht fände sich in Gerichtsprotokollen Näheres zu den Lebensbedingungen der Laternenanzünder-Familien.
Alles in Allem wurde mir bei der Recherche bewusst, dass die Geschichte der Stras- senbleuchtung und der damit verbundenen Geschichte der Arbeitenden und Familien nicht so einfach und romantisch war, wie Bilder zeigen.
Bibliografie
Forschungsliteratur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lexikonartikel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungen
Abb. 1: Gaslaterne des ersten Brennertyps mit offener Flamme im Zürcher Kratzquartier. Quelle: Baugarten mit Kratzturm, 1877, e-manuscripta.ch, Zentralbibliothek Zürich, Zürich-Stadt H 2 Fraumünster-Qu. Baugarten I,7. Online: <https://doi.org/10.7891/e-manuscripta- 61412 >, Stand 12.9.2022.
Abb. 2: Über der Strasse aufgehängtes Öllaterne in Zürich. Quelle: Das Katzenthor, mit seinen Umgebungen nach der Natur gezeichnet. Signiert mit «GIB», Zürich 1813. Online: <https://uzb.swisscovery.slsp.ch/view/delivery/41SLSP UZB/12463783580005508>, Stand: 07.10.2022.
Abb. 3: Beispiel eines Tagesrapportes der Beleuchtungskontrolle: Seite 1 des Rapportes Nr. 1 vom 1. Januar 1851, StadtAZ V.E.c.10.:3.
Abb. 4: Ebd. Seite 2.
Abb. 5: Ulme und 2 blühende Zwetschgenbäumchen beim Güetli, Schulhausstrasse 18 in Zürich- Enge, Breitinger Robert, Fotografie, Zürich 1905, <https://uzb.swisscovery.slsp.ch/view/delivery/41SLSP UZB/12462469500005508 >, Stand: 08.10.2022. Der Kontrast wurde durch G. Feusi mit dem Programm «Affinity Photo» erhöht.
Abb. 6: Ausschnitt aus Abb. 4: Eine Gaslaterne wird gewartet. Der Kontrast wurde wie bei Abb. 4 erhöht.
Abb. 7: StadtAZ V.G.b.527, Tägliche Beleuchtungsanordnung, Ausschnitt aus Seite «Monat Januar 1889».
Anhang: Handschriftliche Archivquellen, Auswahl
Beschwerdeartikel (Zeitung unbekannt) und Stellungnahme, StadtAZ V.E.c.10.:1-1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Stellungnahme der Direktion Licht- & Wasserwerke, 11.12.1891. StadtAZ V.E.c.6.24
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang: Zusätzliche Bilder, Quellen und Informationen
Nach Einreichung der Seminararbeit fanden sich spannende Hinweise, die das Bild auf die Geschichte der Zürcher Strassenbeleuchtung abrunden:
Oel-Strassenlaterne in Zürich
Schulthess, Gustav Walter von: Von der Krone zum Rechberg: 500 Jahre Geschichte eines Hauses am Zürcher Hirschengraben, Stäfa (Zürich) 1996, Seite 41.
Das Bild zeigt, dass trotz Vollmond und der quer über der Strasse aufgehängten Oel-Stras- senlaterne den nächtlichen Spaziergängern eine Handlaterne nützlich war.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 18 Der mittlere Hirschengraben mit der Einmündung der Halseisengasse (Künstlergasse), flankiert von den Häusern zur «Krone» und zum «Unteren Berg». Lichtschirm dat. 1828, gemalt von Johann Jakob Sperli d. Ä. (1793-1843). Privatbesitz.
Ein Laternenbesorger («Laternenbenz») mit Ölkanne, Stadt Bern. Howald 1840
Howald, Karl: Die Brunnen Berns in chronistisch-historischer und ästhetischer Beziehung, sog. Stadtbrunnenchronik, Bd 4, S. 128, Bild eines Öllaternenanzünders, ca. 1840 (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.XXlb.364), zitiert in Illi 2011.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Oelkannen der Zürcher Laternenbesorger?
Im Bauteillager der Denkmalpflege der Stadt Zürich52 sind Kannen aufbewart, welche den Kannen der Abbildung von Howald (Illi 2011) sehr ähnlich sehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Oellaternen sind keine im Bauteillager erhalten. Ein Gaskandelaber ist aufbewart, welcher jedoch auf elektrischen Betrieb umgerüstet ist und keine Originalbemalung mehr hat.
Laternenanzünden um 1900
Maurer, Adolf: Die Sonne scheint auch in der Stadt: Jugenderinnerungen eines Zürchers, Basel 1959.
Adolf Maurer schildert in seinen Jugenderinnerungen als Sohn des Laternenchefs die Verhältnisse im “Trompeterhaus”, dem Laternenanzünderlokal, wo sich die Anzünder allabendlich versammelten und die Besorger der ganznächtigen Laternen auch übernachteten:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Trompeterhaus hatte einen untern und einen obem Eingang. Eine lange Steintreppe führte in mehreren Absätzen hinter der St. Peters-Kirche zur Hofstatt hinauf. Von diesem Platz aus trat man durch unsere Haustüre in einen langen Gang, wo das Büro, das Mannschaftslokal der Laternenanzünder und eine Werkstatt placiert waren. Auf einer Holztreppe stieg man von hier zu unserer Wohnung hinauf und befand sich im fünften Stock des von der Gasse aus sehr hohen Hauses. Vater hatte einen Pikettdienst von etwa 18 Stunden und schlief in seinem Büro neben dem Telephon. S. 74: Der Laternenchef schläft in seinem Büro, nicht in der Familienwohnung.
Am Anfang unseres langen Hausganges lag Vaters Büro.
Da ging es tagsüber zu wie in einem Taubenschlag. Wer etwas zu melden hatte, eine Auskunft wünschte, ein Anliegen abladen wollte, klopfte an diese Türe. In dem unfreundlichen Raum stand ein Bett, durch einen Vorhang abgetrennt, daneben ein Kasten, auf der Türseite das große Pult, anschließend ein Tisch, auf dem Brenner, Schrauben. Werkzeuge lagen. Nur ein Teil des In diesem düstem Winkel, in den das ganze Jahr kein Sonnenstrahl hineinfiel, arbeitete, schlief, lebte Vater, wenn er nicht just im obern Stock mit uns am Tische saß oder in der Stadt herum seine Kontrollgänge machte. Hier schrieb er seine Rapporte, hier händigte er seinen Arbeitern das gelbe Lohntäschchen aus, hier gab er dem einen und andern die Kündigung und stellte S. 137: Das Nachtlager der Laternenanzünder: [Die Mutter erzählt]
Sie erzählte ihr, wie sie und ich jedes Frühjahr bei der großen Useputzete dem Vater einen ganzen Tag helfen müßten, damit die dreißig, vierzig Matratzen der Laternenanzünder gehörig geklopft und geputzt würden. So S. 57-62, Auszüge Liditbringer «Sie werfen keine Laternen ein, sie zünden aber auch keine an», schreibt Gottfried Keller. Ich möchte von solchen erzählen, die Laternen angezündet haben. Es waren Schuhmacher, Schneider, Dienstmänner, Berufslose, fünfzig, sechzig Mann, die im Trompeterhaus zwischen dem alten Zeughaus in Gassen und dem St. Peter ihr Versteck hatten, ihre Burg sozusagen und jeden Abend mit ihren langen Spießen ausbrachen, der Stadt Zürich das Licht zu bringen. Diese friedlichen Spießgesellen gehören um die Jahrhundertwende zur Stadt wie das Rößlitram an der Bahnhofstraße, die Geißen von Fluntem und die Droschkiers auf dem Paradeplatz. Wenn die Abenddämmerung sich auf Gassen und Giebel legte, standen die Anzünder wie ein Fähnlein Krieger mit den langen Stecken auf der hintern Peterhof- statt marschbereit, und wenn dann mein Vater kommandierte: Riesbach ab! Enge ab! Wonneberg ab! (ich verstand immer Muniberg), dann kam mir Vater vor wie ein General auf dem Schlachthügel. Du liebe Zeit! Das Bild, das seinen Jüngsten mit Stolz erfüllte, wurde reichlich ergänzt und korrigiert durch andere Szenen, die eher an einen ewiggeplagten Flohhüter erinnerten als an einen General.
Es waren diese Halbtagsarbeiter, die nur fürs Anzünden am Abend und fürs Löschen um 11 Uhr nachts angestellt waren — ein Teil von ihnen mußte die Laternen, die die ganze Nacht hindurch brannten, am Mor gen früh ausdrehen und darum im Trompeterhaus nächtigen —, diese Leute waren ein sehr buntes, gar nicht leicht zu regierendes Völklein. Solider und verläßlicher waren die Putzer, die Ganztagsarbeiter, die die Scheiben der Laternen zu reinigen, die Brenner zu kontrollieren und Reparaturen auszuführen hatten und hiezu den ganzen Tag mit ihren Leitern von Straße zu Straße zogen. Die Arbeit dieser Lichtbringer war zuweilen ein harter Dienst, vor allem wenn es regnete, schlimmer noch, wenn die Temperatur unter Null sank und die Laternen einfroren. Dann mußten die Putzer, mein Vater immer voran, mit Lötlampen ausziehen, an die Laternen hinaufklettern, auftauen und dafür sorgen, daß der hinterste Winkel sein Licht bekam. Nachts hatte der Chef die Rapporte zu schreiben über Störungen, Reparaturen, Neuinstallationen und mußte damit jeden Morgen höchstpersönlich beim Direktor des Gaswerkes antreten und Rede stehen. Ich weiß, wie schwer ihm dieser Gang zuweilen gefallen ist, wenn da und dort etwas nicht geklappt hatte und von der oder jener Seite Reklamationen eingelaufen waren, wenn eine Laterne zu spät angezündet, zu früh gelöscht worden war oder gar nicht brannte. Dabei gab es um 1904 in Zürich 5700 Straßenlaternen.
Vater hatte eine Präsenzzeit von morgens 8 Uhr bis nachts halb 1 Uhr. Er schlief in seinem Büro, hatte das Telephon neben seinem Kopfkissen und mußte jederzeit bereitstehen, wenn von der Polizei, vom Feuerwehrkommando, von Privaten Meldungen und Wünsche einliefen. Dieser strenge Dienst, der erst mit den Jahren sich etwas verringert und gelockert hat, mußte natürlich auch den Rhythmus unseres Familienlebens beeinflussen.
Es ereignete sich nicht selten, daß am Morgen nach dem Zahltag eine Frau schluchzend vor meinem Vater stand, weil der Mann in der vergangenen Nacht den Lohn hinterm Wirtstisch vertrunken hatte und die Familie für zwei Wochen ohne Brot blieb. Ich weiß, wie Vater, wenn er’s irgend konnte, mit seinen eigenen spärlichen Mitteln einsprang und dem Lotter unter vier Augen die Weichen neu zu stellen versuchte.
Brachte Vaters Dienst uns Kindern mancherlei Unannehmlichkeiten, so hatte doch das Leben in diesem uralten, menschenreichen Bau — die Haustüre wurde jahrein, jahraus nie geschlossen — auch seinen Reiz und seine Kurzweil. Wir saßen an der Quelle der Entwicklung der öffentlichen Beleuchtung von der Öllampe, die auf den Dampfschiffstegen immer noch in Betrieb war, über den Schnittbrenner mit der offenen Gasflamme und über das Auerlicht mit den Glühstrümpfen, auf die die Beleuchtung der ganzen Stadt im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts umgestellt wurde, bis zur ersten elektrischen Bogenlampe an der Bahnhofstraße Ende 1892, ja bis zur radikalen Umstellung auf das elektrische Licht im ganzen Straßennetz und der Automatisierung der Bedienung. Ade Laternenanzünder, ihr lieben Spießgesellen! Ihr seid überholt. Es geht jetzt mit Schaltern und Drähten alles rascher, leichter, großartiger.
Wenn ich zurückschaue auf die Jagd der technischen Erfindungen und Neuerungen, ist mir, ich habe einen kleinen, aber interessanten Ausschnitt der Kulturgeschichte in nächster Nähe miterlebt, den Weg vom Petroleumlämpchen, das wir jeden Tag noch füllen, den Docht und das Glas putzen mußten, bis zur indirekten elektrischen Beleuchtung der Wohnräume und der Straßen. Natürlich reizen diese Erinnerungen zu allerlei Überlegungen über das Verhältnis von Mensch und Technik und weltanschaulichen Spielereien. Doch fällt mir da ein — die Zauberkiste in unserer Werkstatt.
Abkürzungen für Geld und Volumenmasse
Herr Benedikt Zäch, Leiter des Münzkabinetts Winterthur (Lindstrasse 8, https://stadt.win- terthur.ch/muenzkabinett/museum ) gab mir wertvolle Informationen zu Währungs- und Masseinheiten: Noch im 19. Jh. funktionierte offenbar das rechnerische Denken der NutzerInnen nicht im Dezimalsystem, Teilungs- bzw. Multiplikationssystem.
Herzlichen Dank an Herrn Zäch! Zü rc tierisches Wochen blatt, Nummer-97, 3. Dezember-18321)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Bezeichnungen zeigen trotz der 1848 erfolgten Einführung des Frankens zu 100 Rappen durch den Bund noch das alte Zürcher Rechensystem mit (Rechnungs)Gulden (fl. = flore- nus), Schilling (fs bzw. ß.) und Haller (hlr.). Dieser Rechnungsgulden existiert seit 1506 und ist ein fossilisierter Kurs des (damals) rheinischen Goldguldens, der um 1480 einen Kurswert von 40 Schilling hatte. 12 Haller sind 1 Schilling.53
Der Rechnungsgulden ist zu unterscheiden vom süddeutschen Währungssystem des Guldens zu 60 Kreuzern bzw. 480 Hellern, das ab etwa 1830 auch für Zürich wichtig war.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In dieser Tabelle bezeichnet lb eine Masseneinheit. Das Pfund wurde ab 1838 mehrheitlich in 16 Quint bzw. 32 Lot(h) (Lth.) geteilt; hier wurde offenbar noch ein altes Pfund-Mass = 34 Lot verwendet.54
[...]
1 Casanova 2007, S. 348-384.
2 Strache 1913.
3 Die Polizei des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich - nicht nur in Zürich - mit vielen Themen, welche heutzutage einer eigenen Verwaltungseinheit gehören, unter anderem eben auch mit dem Beleuchtungswesen.
4 Gab es auch Laternenwärterinnen? Obwohl ich keine Lohnlisten oder dementsprechende Anordnungen gesehen habe, vermute ich, dass unter diesen Angestellten keine Frauen waren. In den Quellen dieser Zeit zeigt sich immer wieder die Haltung, dass Frauen alleine nachts auf der Strasse nur ausnahmsweise etwa zu suchen hatten.
5 «Bekanntmachung der Stadtkanzley», Z. Wochenbl. 13.12.1830; die Einheit 0 steht für Schilling ß. Bereits vor 1830 gab es abends Eintrittsmöglichkeiten gegen Sperrgeld, jedoch nicht die ganze Nacht. Mehr dazu in Casanova 2007, S. 188 ff und besonders S. 427-447.
6 «Zur Geschichte der Zürcher Gaslaterne» NZZ 1.2.1942.
7 Damals war Mineralöl wie z.B Petroleum in Zürich eine seltene und teure Rarität. Verwendet wurde Rüböl, eine frühere, ungeniessbare Sorte Öl der Pflanze Brassica rapa oder B. napus. Synonym: Rapsöl oder Lewatöl; englisch «rape seed oil»; französisch «huile de colza» aus dem niederländischen Begriff «Koolzaat».
8 In Anmerkung 841 in Casanova 2007, S. 362 werden dazu mehrere Quellen des Stadtarchivs Zürich zitiert. Die Laternen und deren Aufhängung wurden jeweils in den Sommermonaten abmontiert; im Jahr 1811 bereits Mitte April in einer Leermondphase, was zu Protesten führte (Ebd. S. 170 und S. 382).
9 StadtAZ V.E.c.10.:3 Tagesrapporte über die Strassenbeleuchtung.
10 Nicht bzw. schlecht entzifferbare Stellen der Handschriften sind mit (...) gekennzeichnet.
11 StadtAZ V.B.c.9/1/7-1, StadtAZ V.B.c.9/1/8-1 Publikation wegen der Strassenbeleuchtung.
12 Casanova 2007, S. 355-363.
13 Viele Details zu technologischen Aspekten beschreibt Strache 1913.
14 StadtAZ V.E.c.11/1-3 Strassen-Beleuchtung (Öl) 1806-1850: Beschluss betreffen Verpachtung Strassenbeleuchtung.
15 StadtAZ V.E.c.10.:3 Tagesrapporte über die Strassenbeleuchtung 1851-1878
16 Leider habe ich kein Tagesrapport-Beispiel gefunden von Markttagen.
17 Der Betrag wurde im vorgedruckten Formular in fl., ß. und hlr. angegeben. Diese Geldeinheiten waren eigentlich seit der Übernahme des Münzregals durch den Bund nicht mehr «aktuell». «ß.» und «hlr.» stehen für Schilling und Haller, diese gehörten zu einem anderen Geldrechensystem wie «fl.» für Florin bzw. Gulden (Furrer 1995 S. 94).
18 Im Buch «Von der Gaslaterne zum Erdgas» (Egger 1993 S. 16-26) werden kostspieligen Pannen in Planung und Ausführung ausführlich beschrieben, welche die Stadt Bern, die Schweizer Vorreiterin in Sachen Gasproduktion erlebte.
19 Casanova spricht von «Befreiung von obrigkeitlicher Gängelei der Frühen Neuzeit» (Casanova 2007 S. 383-384).
20 StadtAZ V.B.c.9/1/17-1, Bedingungsheft für die Einführung der Gasbeleuchtung in der Stadt Zürich, 10. Oktober 1854.
21 StadtAZ V.B.c.9/1/17-3. Die Stadt umfasste damals wenig mehr als die Fläche des heutigen Kreis 1, der Altstadt.
22 StadtAZ V.B.c.9/1/17-2, Vertrag für die Einführung der Gasbeleuchtung in der Stadt Zürich.
23 Ludwig August Riedinger, ursprünglich Schreiner und technischer Direktor einer Spinnerei, hatte in über 60 Städten Gaswerke und Leitungsnetze geplant und aufgebaut; sein Bautrupp sei von Stadt zu Stadt gereist. Daneben gründete er unter anderem auch eine Kandelaber- und Leuchtenfabrik, die spätere MAN (Winkler 2003).
24 Escher 1935 S. 1.
25 StadtAZ V.B.c.9/1/17-4, Regulativ betreffend die Besorgung und die Controllirung der Strassenbeleuchtung.
26 «Controleur» nun wieder mit einem l geschrieben. StadtAZ V.B.c.9/1/17-5, Pflichtordnung für den Controleur der Strassenbeleuchtung.
27 StadtAZ V.B.c.9/2/5-1 Verordnung betreffend schützender Massregeln bei Anwendung der Gasbeleuchtung.
28 Z.B. im «Protocoll der Züricher Actien-Gesellschaft für Gasbeleuchtung» vom 30. November 1857, S. 23, vom März 1858, S. 62 und vom 28. Juni 1859 S. 62-63, StadtAZ VII.25.6.2.
29 StadtAZ V.B.c.9/1/17-5.
30 Am 30.11.1857, S. 23, StadtAZ VII.25.6.2 Protocoll der Züricher Actien-Gesellschaft für Gasbeleuchtung, S. 29-30.
31 StadtAZ V.E.c.10.:1-1 Beschwerdebrief 15.1.1886
32 StadtAZ V.E.c.10.:1-2 Memorial an den löblichen Stadtrath Zürich ab Seite der unterzeichneten hiesigen Gaskonsumenten.
33 StadtAZ V.E.c.10.:1-3 Möglicherweise ist der Autor identisch mit Heinrich Gruner aus Sachsen, Gas- und Wasserfachmann, ab ca. 1860 tätig in Basel (Fuchs 2007).
34 StadtAZ V.G.c.24.:1-1
35 Durch den Produktionsprozess enthält Stadtgas immer auch einen Anteil Wasserdampf, der nicht immer vollständig entfernt werden kann und im Winter zum Einfrieren von Leitungen führen kann. Mit Alkohol wurde die Leitung aufgetaut; daher eventuell die Redensart «sich einen auf die Lampe giessen».
36 Alle Details dieser Abschnitte stammen aus dem Reglement StadtAZ V.G.c.24.:1-1
37 Z.B. NZZ 28.10.1884: «Durch den heftigen Sturm wurden in gestriger Nacht eine Menge Laternen in der Stadt ausgelöscht. Die Laternenanzünder waren die ganze Nacht thätig, um die Flammen wieder anzuzünden».
38 NZZ 31.10.1890-2
39 Vermutlich Rudolf Morf, 1837-1925, Sozialdemokrat (Pfeifer 2009).
40 NZZ 25.7.1893
41 NZZ 1.2.1897-2
42 NZZ 15.2.1906-2
43 NZZ 3.2.1908
44 NZZ 21.3.1916-5 sowie Bürgi 2011.
45 NZN 19.7.1919-2.
46 NZZ 3.9.1934, Interview mit einem Laternenanzünder.
47 Spiritus: 96% Ethanol, umgangssprachlich «Alkohol».
48 Ab den 1890er Jahren wurden offener Flammen durch sogenannte Auer-Glühstrümpfe abgeschirmt, was die Leuchtkraft erheblich verbesserte. Die neuen Gaslaternen am Neumarkt Zürich sind mit je 6 solcher Glühstrümpfe ausgerüstet.
49 StadtAZ V.E.c.6.24, Couvert Gas-Strassenbeleuchtung, Brief der Direktion Licht- & Wasserwerke, 11.12. 1891 (Interpunktion durch G. Feusi ergänzt).
50 StadtAZ V.G.b.503, Gaswerk. Reklamationenbuch (1897-1908).
51 StadtAZ V.G.c.24.:1-1
52 (https://www.zh.ch/de/sport-kultur/kultur/kulturerbe/kulturhistorische- institutionen/bauteillager.html. Stand 6.1.2023, Bilder von G. Feusi, Dez. 2022)
53 Die Umrechnungssätze der Rechenwährungseinheiten (1:40:480) kann man überprüfen durch Addition der Teilbeträge.
Häufig gestellte Fragen: Laternen oder Mondschein? Strassenbeleuchtung in Zürichs 19. Jahrhundert
Worum geht es in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Einführung und Organisation der Strassenbeleuchtung in Zürich im 19. Jahrhundert, insbesondere die späte Einführung von Öllaternen (ab 1806) und Gaslaternen (ab 1856). Sie beleuchtet die Organisation, Reglemente, Kontrollaufsicht und die Situation der Laternenanzünder.
Welche Quellen wurden für die Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter Zeitungsartikel, gedruckte und handschriftliche Akten aus dem Stadtarchiv Zürich, technische Details aus dem Werk von Hugo Strache zur Gas-Technologie und Lebenserinnerungen von Laternenanzündern.
Wie war die Situation der Laternenanzünder?
Die Arbeit als Laternenanzünder war streng, schlecht bezahlt und wurde vom Publikum oft schlecht honorierte. Sie standen im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen an lückenlos erhellte Nächte und den eigenen gesundheitlichen Belastungen.
Welche Rolle spielte die Einführung der Gasbeleuchtung?
Die Einführung der Gasbeleuchtung ab 1856 war ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Strassenbeleuchtung in Zürich. Sie führte aber auch zu neuen Herausforderungen in Bezug auf Technologie, Organisation und Qualität des Lichts.
Gab es Kritik an der Strassenbeleuchtung?
Ja, es gab Klagen über die mangelhafte Ölbeleuchtung sowie über zu spät oder gar nicht angezündete Laternen. Auch die Gasbeleuchtung war nicht unumstritten, es gab Kritik bezüglich Lichtstärke, Gasdruck und der Organisation.
Wie wurde die Arbeit der Laternenanzünder kontrolliert?
Die Stadt organisierte die Kontrolle der Laternenanzünder durch einen «Controleur» und Polizeidiener. Sie kontrollierten die korrekte Anzünd- und Löschzeit und meldeten Mängel und Nachlässigkeiten.
Welche Arbeitsbedingungen hatten die Laternenanzünder?
Die Arbeitsbedingungen waren hart. Die Laternenanzünder bekamen Reviere zugeteilt, mussten die Laternen in jeder Nacht bei jedem Wetter anzünden und löschen und bei Beschädigung oder Auslöschen die Laternen wieder in Stand setzen. Der Lohn war karg und die Übernachtung im Laternenlokal war Pflicht.
Gab es Bemühungen, die Arbeitsbedingungen der Laternenanzünder zu verbessern?
Ja, es gab vereinzelt Forderungen nach einer besseren Löhnung für die Laternenanzünder, insbesondere ab 1887 als die Stadt das Gaswerk als städtischen Betrieb übernommen hatte. Allerdings wurden diese Forderungen nicht immer erfüllt.
Welchen Einfluss hatte die Elektrifizierung auf die Gasbeleuchtung?
Mit der Einführung der Elektrizität und der Verknappung der importierten Steinkohle im 1. Weltkrieg verlor das Leuchtgas seine Monopolstellung. Strassenzüge und Haushalte wurden zunehmend mit elektrischem Licht ausgestattet und viele Laternenanzünder verloren ihre Arbeit.
Welche Aspekte werden in der Arbeit noch untersucht?
Die Arbeit gibt auch einen Ausblick auf die Zeit des Gaswerkes als städtisches Unternehmen und beleuchtet die Situation der Laternenwärter selbst, wie sie erst im Rückblick auf die «gute alte Zeit» durch Lebenserinnerungen und Zeitungsartikel fassbar wurden.
- Arbeit zitieren
- Giovanna Feusi (Autor:in), 2022, Laternen oder Mondschein? Zur Strassenbeleuchtung in Zürichs 19. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1318383