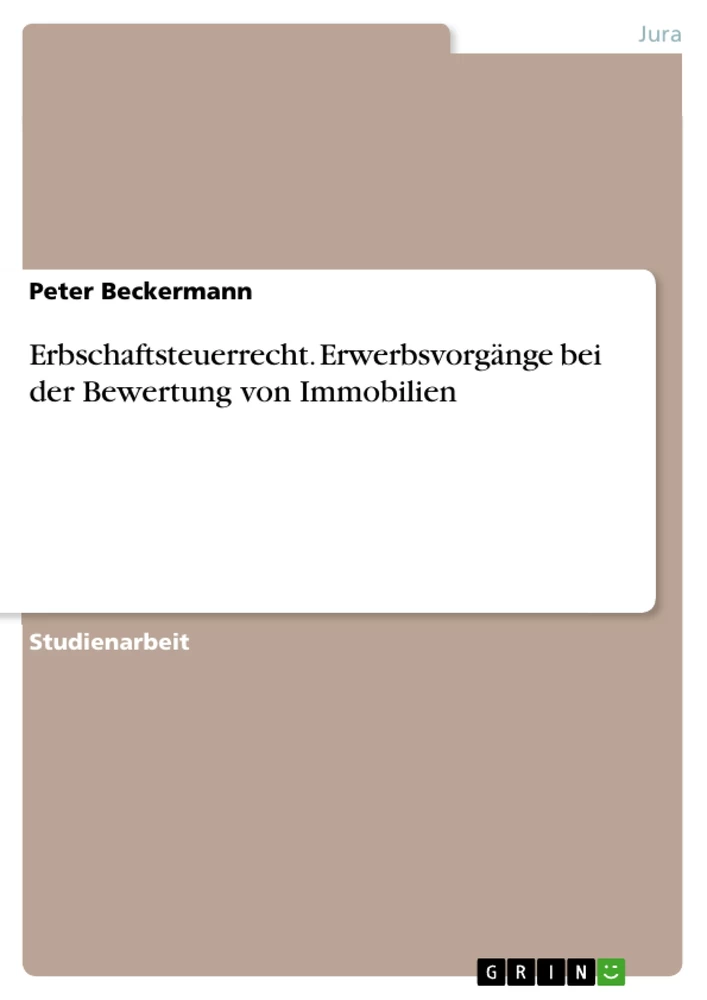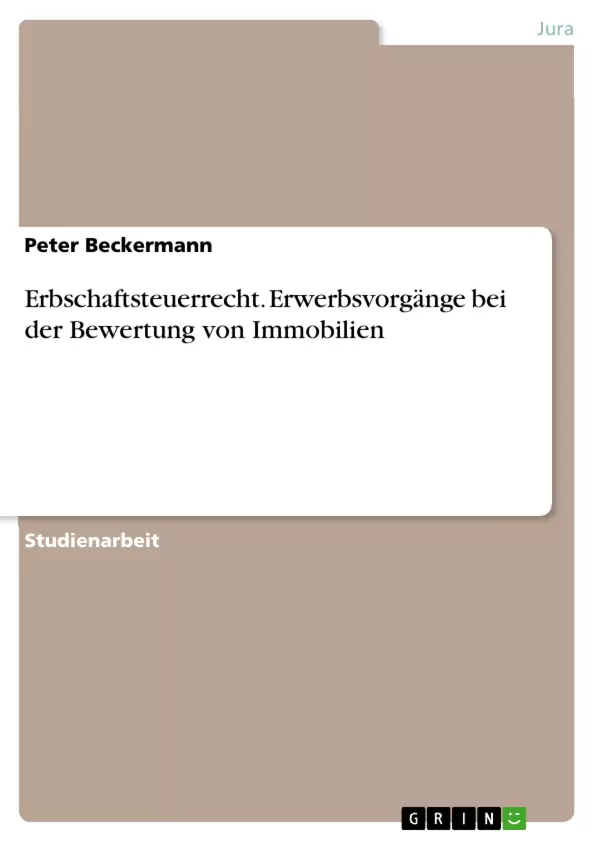Diese Arbeit soll die Bewertung von Grundbesitz im erbschaftsteuerrechtlichen Sinne aufzeigen. Insbesondere soll auf die gängigen Regelbewertungsverfahren eingegangen werden, mit denen Immobilien bei erbschaftsteuerrechtlichen Erwerbsvorgängen standardmäßig bewertet werden. Der Leser soll auf die zu beachtenden Faktoren aufmerksam gemacht werden, die die Bemessungsgrundlage für die Besteuerung von Grundbesitz bilden. Ziel ist es, dem Leser, insbesondere nach der beispielhaften Immobilienbewertung, aufzuzeigen, wie eine Immobilienbewertung nach dem Bewertungsgesetz in der Praxis durchgeführt wird.
Von besonderer Bedeutung für die Ausarbeitung war dementsprechend die Abgrenzung in der Bewertung unbebauter und bebauter Grundstücke. Im Anschluss war es so möglich, verschiedene Grundstücksarten bewertungsrechtlich einzuordnen und so das jeweilige Bewertungsverfahren für die Berechnung einschlägig festzustellen. Dieses Fundament bot die Grundlage für die geordnete Prüfung und Berechnung einer praktischen Immobilienbewertung.
Heutzutage kommt es immer häufiger zu diversen Erwerbsvorgängen, bei denen verschiedenste Arten von Grundvermögen erworben werden. Oft wird unterschätzt, in welcher Höhe die Steuer auf das erworbene Grundvermögen erhoben werden kann. Sei es die Erbschaftsteuer, die z.B. bei Schenkung unter Lebenden oder Erwerb von Todes wegen anfällt, oder die Grunderwerbsteuer. In beiden Fällen ist die Bewertung von Immobilien von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich vor solchen Erwerbsvorgängen darüber im Klaren zu sein, wie hoch das Grundvermögen bewertet werden kann, um hohe und unerwartete Liquiditätsschmälerungen zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bewertung von Grundstücken
- Bewertung unbebauter Grundstücke
- Bewertung bebauter Grundstücke
- Abgrenzung der Grundstücksarten
- Wahl des Bewertungsverfahrens
- Vergleichswertverfahren
- Vergleichspreisverfahren
- Vergleichsfaktorverfahren
- Ertragswertverfahren
- Ermittlung des Bodenwerts
- Ermittlung des Gebäudeertragswerts
- Sachwertverfahren
- Ermittlung des Bodenwerts
- Ermittlung des Gebäudesachwerts
- Immobilienbewertung anhand eines Praxisbeispiels
- Darstellung
- Rechtsfolgen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Bewertung von Immobilien im Erbschaftsteuerrecht. Das Ziel ist es, die verschiedenen Bewertungsverfahren im Detail zu analysieren und anhand eines Praxisbeispiels zu verdeutlichen, wie diese in der Praxis angewendet werden.
- Bewertung unbebauter und bebauter Grundstücke
- Wahl des geeigneten Bewertungsverfahrens
- Anwendung der Verfahren in der Praxis
- Relevanz der Bewertung für die Erbschaftsteuer
- Rechtsfolgen der Bewertung für den Erben
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und erläutert die Relevanz der Bewertung von Immobilien im Erbschaftsteuerrecht.
- Bewertung von Grundstücken: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Bewertungsverfahren für unbebaute und bebaute Grundstücke. Es werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren sowie die Auswahlkriterien für das jeweils geeignete Verfahren erläutert.
- Immobilienbewertung anhand eines Praxisbeispiels: In diesem Kapitel wird die Bewertung einer Immobilie anhand eines konkreten Praxisbeispiels dargestellt. Es werden die einzelnen Schritte des Bewertungsprozesses sowie die relevanten Rechtsfolgen erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind: Immobilienbewertung, Erbschaftsteuerrecht, Grundstücksbewertung, Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, Praxisbeispiel, Rechtsfolgen.
- Quote paper
- Peter Beckermann (Author), 2022, Erbschaftsteuerrecht. Erwerbsvorgänge bei der Bewertung von Immobilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1317806