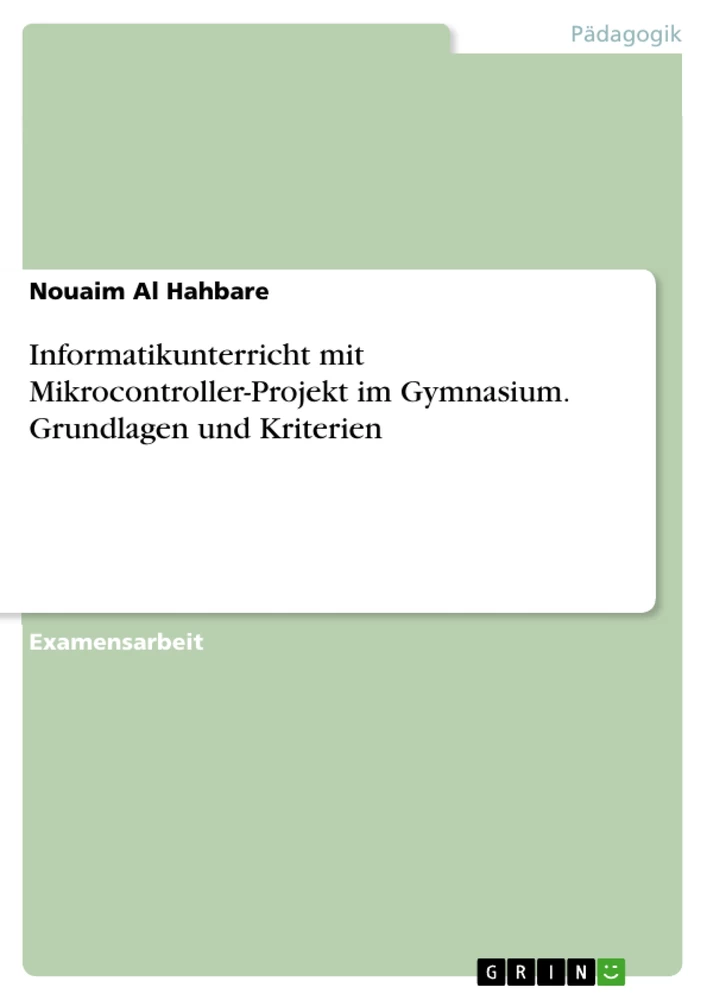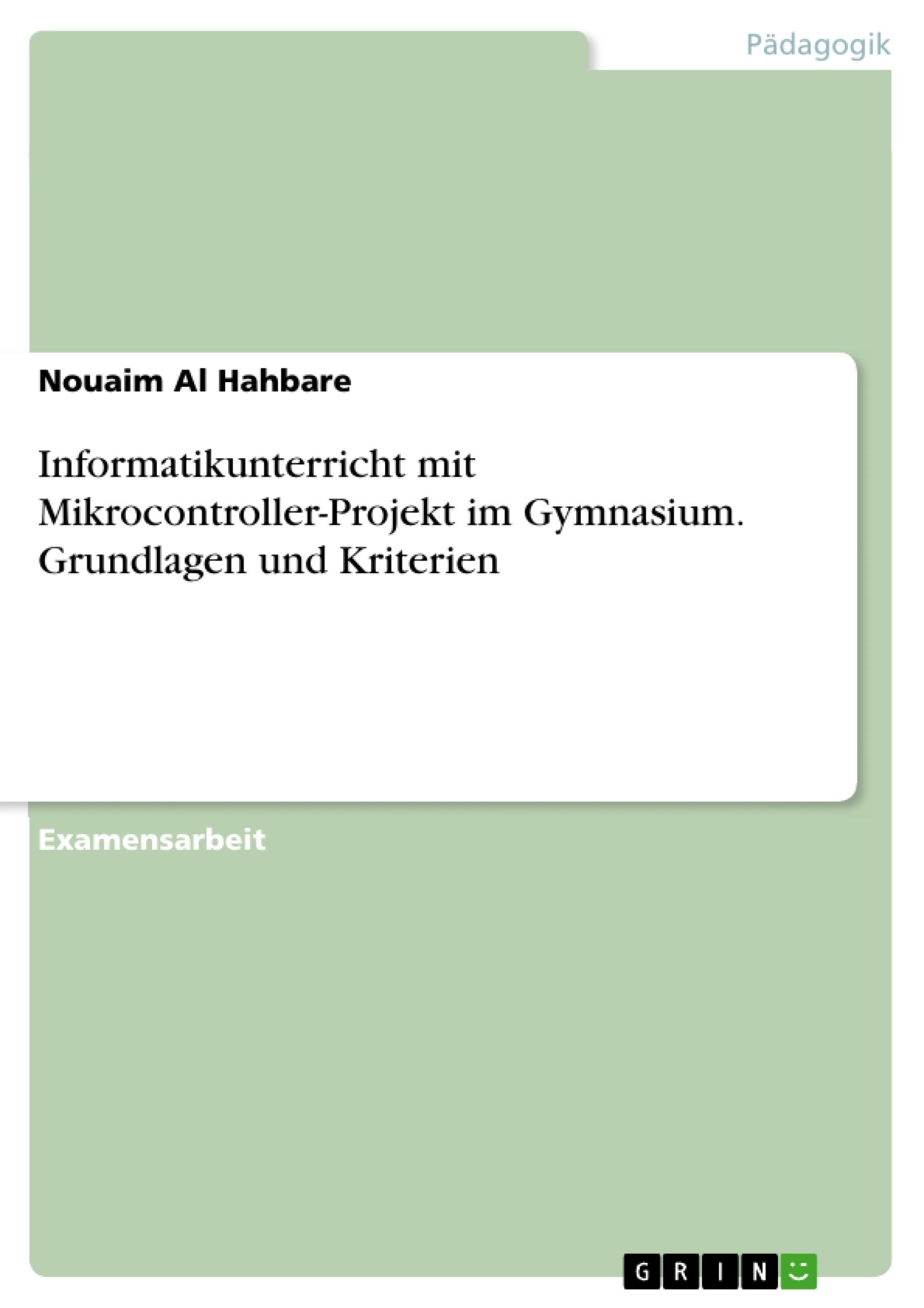Mit halbjahresübergreifendem Informatikunterricht mit Mikrocontroller-Projekt wird in dieser Arbeit ein kontext- und projektorientiertes Modell vorgestellt, das zum einen den zu erwartenden Mangel an grundlegenden Fachkompetenzen bei Schülerinnen und Schülern überbrücken soll. Zum anderen verfolgt es das Ziel, innercurriculare Zusammenhänge zwischen einzelnen Themen an die Lernenden zu vermitteln und damit ein Gesamtverständnis für die Informatik zu ermöglichen.
Trotz der breiten Forderung nach einer Bildungsoffensive im Bereich der Informatik, wird der Stellenwert der informatischen Bildung in der Sekundarstufe I damit immer noch nicht flächendeckend anerkannt. In der Sekundarstufe II sieht es dafür zwar deutlich besser aus. Vor dem Hintergrund der teilweise nichtexistenten informatischen Bildung im Sekundarbereich I stellt sich allerdings die Frage, wie Schülerinnen und Schüler den Einstieg in die anspruchsvollen Kompetenzfelder der Oberstufeninformatik meistern sollen. Wie können sie inhaltlich und kognitiv an ein Fach anknüpfen, zu dem sie aufgrund des fehlenden Bildungsangebots in der Mittelstufe bisher keinerlei Bezüge hatten?
Solange sich die schulische Bildungslage nicht ändert, müssen sich insbesondere Didaktiker und Lehrkräfte dieser Frage stellen. Bis dahin kommt es auf ihre kreativen Ansätze an, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich bei der Überwindung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Vor allem in Bremen und Hessen müssen Wege gefunden werden, die Lerninhalte der Informatik so aufzubereiten, dass sie optimal von den Schülerinnen und Schülern aufgenommen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I – Halbjahresübergreifender Informatikunterricht
- Einleitung
- Ausgangslage
- Die Grundlage - Informatik im Kontext
- Kontextorientierung in naturwissenschaftlichen Fächern
- Kontextorientierung im Informatikunterricht
- Informatik im Kontext
- Chancen von Informatik im Kontext
- Grenzen von Informatik im Kontext
- Die Ergänzung - Themenübergreifender Unterricht
- Definition Halbjahresübergreifender Informatikunterricht
- Vereinbarkeit des Halbjahresübergreifenden Informatikunterrichts mit den Vorgaben des Kerncurriculums
- Teil II - Projektunterricht im Informatikunterricht
- Begriffsbestimmung Projektunterricht
- Projektarbeit im Informatikunterricht
- Teamarbeit
- Themenauswahl
- Zusammenfassung
- Abgrenzung zu Halbjahresübergreifendem Informatikunterricht
- Teil III - Mikrocontroller im Informatikunterricht
- Physical Computing mit Mikrocontroller-Tools
- Mikrocontroller-Tools im Informatikunterricht
- Sensor- und Aktorenboards
- Vorgefertigte Sensoren- und Aktorenbausteine
- Mikrocontrollerboards
- Arduino-Plattform
- Arduino-Hardware
- Arduino-Software
- Sensoren und Aktoren
- Erweiterungen
- Bibliotheken
- Shields
- Entscheidung für Arduino
- Halbjahresübergreifender Informatikunterricht mit Arduino
- Teil IV - Halbjahresübergreifender Informatikunterricht mit Mikrocontroller-Projekt
- Kriterien für Halbjahresübergreifenden Informatikunterricht mit Mikrocontroller-Projekt
- Projektbeispiel – Smart-School-Projekt
- Benutzeroberfläche entwickeln - HTML-Projekt
- Webserver einrichten – Internetprotokolle
- Funktionen programmieren – Programmierprojekt
- Sensordaten verwalten - Webdatenbankprojekt
- Überprüfung der Kriterien
- Abschlussdiskussion
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption und Umsetzung halbjahresübergreifenden Informatikunterrichts mit einem Mikrocontroller-Projekt. Ziel ist es, einen didaktischen Ansatz zu entwickeln, der den Herausforderungen des oft fehlenden Informatikunterrichts in der Sekundarstufe I begegnet und einen erfolgreichen Einstieg in die Oberstufe ermöglicht.
- Halbjahresübergreifender Informatikunterricht als didaktisches Konzept
- Integration von Projektunterricht im Informatikunterricht
- Einsatz von Mikrocontrollern (Arduino) im Unterricht
- Entwicklung eines konkreten Projektbeispiels ("Smart-School-Projekt")
- Analyse der Vereinbarkeit mit dem Kerncurriculum
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I – Halbjahresübergreifender Informatikunterricht: Dieser Teil analysiert die aktuelle Situation des Informatikunterrichts in Deutschland, zeigt die Notwendigkeit halbjahresübergreifenden Unterrichts auf und definiert diesen Begriff im Kontext der bestehenden curricularen Vorgaben. Es wird die Problematik des fehlenden Informatikunterrichts in der Sekundarstufe I in einigen Bundesländern beleuchtet und die Bedeutung von Kontextorientierung im Informatikunterricht hervorgehoben. Der Teil legt die Grundlage für die spätere Projektidee, indem er den Bedarf an innovativen Unterrichtskonzepten zur Verbesserung der informatischen Bildung verdeutlicht.
Teil II - Projektunterricht im Informatikunterricht: Dieser Abschnitt befasst sich mit der didaktischen Methode des Projektunterrichts und seiner Anwendung im Fach Informatik. Er beleuchtet Aspekte wie Teamarbeit, Themenauswahl und die Zusammenfassung von Projektergebnissen. Die Bedeutung von Projektunterricht zur Festigung von Lernergebnissen und Förderung von Schlüsselkompetenzen wird herausgestellt. Schließlich wird der Projektunterricht vom halbjahresübergreifenden Unterricht abgegrenzt um die jeweiligen Stärken und Schwächen zu verdeutlichen.
Teil III - Mikrocontroller im Informatikunterricht: Hier wird die Verwendung von Mikrocontrollern, insbesondere der Arduino-Plattform, im Informatikunterricht vorgestellt. Der Abschnitt beschreibt verschiedene Mikrocontroller-Tools, Hardware- und Softwarekomponenten von Arduino und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden die Vorteile der Arduino-Plattform im Bildungskontext herausgearbeitet und die Entscheidung für Arduino als geeignete Plattform für das Projekt begründet. Der Teil zeigt Möglichkeiten auf, die theoretische Wissensvermittlung mit praktischen Anwendungen zu verknüpfen.
Teil IV - Halbjahresübergreifender Informatikunterricht mit Mikrocontroller-Projekt: Dieser Teil präsentiert ein konkretes Projektbeispiel – das "Smart-School-Projekt" – welches die zuvor beschriebenen Konzepte und Methoden vereint. Es werden die einzelnen Phasen des Projekts, wie die Entwicklung der Benutzeroberfläche, die Einrichtung des Webservers, die Programmierung der Funktionen und die Verwaltung der Sensordaten, detailliert beschrieben. Die Kriterien für den Erfolg des halbjahresübergreifenden Unterrichts mit Mikrocontroller-Projekten werden anhand des Beispiels erläutert und geprüft. Die Zusammenführung der verschiedenen Bereiche des Projekts wird hier detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Halbjahresübergreifender Informatikunterricht, Projektunterricht, Mikrocontroller, Arduino, Kerncurriculum, Kontextorientierung, informatische Bildung, Smart-School-Projekt, Programmierung, Webentwicklung, Sensordatenverwaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Halbjahresübergreifender Informatikunterricht mit Mikrocontroller-Projekt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konzeption und Umsetzung halbjahresübergreifenden Informatikunterrichts mit einem Mikrocontroller-Projekt. Ziel ist die Entwicklung eines didaktischen Ansatzes, der die Herausforderungen des oft fehlenden Informatikunterrichts in der Sekundarstufe I begegnet und einen erfolgreichen Einstieg in die Oberstufe ermöglicht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: halbjahresübergreifender Informatikunterricht als didaktisches Konzept, Integration von Projektunterricht, Einsatz von Mikrocontrollern (Arduino), Entwicklung eines konkreten Projektbeispiels ("Smart-School-Projekt"), und die Analyse der Vereinbarkeit mit dem Kerncurriculum.
Was ist halbjahresübergreifender Informatikunterricht?
Der Begriff wird im Kontext der bestehenden curricularen Vorgaben definiert. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation des Informatikunterrichts in Deutschland und zeigt die Notwendigkeit eines solchen Unterrichts auf, insbesondere angesichts des Problems fehlenden Informatikunterrichts in der Sekundarstufe I in einigen Bundesländern. Die Bedeutung der Kontextorientierung im Informatikunterricht wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Projektunterricht?
Die Arbeit beleuchtet die didaktische Methode des Projektunterrichts und seine Anwendung im Informatikunterricht. Aspekte wie Teamarbeit, Themenauswahl und die Zusammenfassung von Projektergebnissen werden behandelt. Der Projektunterricht wird vom halbjahresübergreifenden Unterricht abgegrenzt, um die jeweiligen Stärken und Schwächen zu verdeutlichen.
Wie werden Mikrocontroller (Arduino) eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt die Verwendung von Mikrocontrollern, insbesondere der Arduino-Plattform, im Informatikunterricht. Verschiedene Mikrocontroller-Tools, Hardware- und Softwarekomponenten von Arduino und deren Einsatzmöglichkeiten werden vorgestellt. Die Vorteile der Arduino-Plattform im Bildungskontext werden herausgearbeitet und die Entscheidung für Arduino als geeignete Plattform für das Projekt begründet.
Was ist das "Smart-School-Projekt"?
Das "Smart-School-Projekt" ist ein konkretes Projektbeispiel, das die zuvor beschriebenen Konzepte und Methoden vereint. Es werden die einzelnen Phasen des Projekts detailliert beschrieben: Entwicklung der Benutzeroberfläche (HTML-Projekt), Einrichtung des Webservers (Internetprotokolle), Programmierung der Funktionen (Programmierprojekt), Verwaltung der Sensordaten (Webdatenbankprojekt), und die Überprüfung der Kriterien für erfolgreichen halbjahresübergreifenden Unterricht mit Mikrocontroller-Projekten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Halbjahresübergreifender Informatikunterricht, Projektunterricht, Mikrocontroller, Arduino, Kerncurriculum, Kontextorientierung, informatische Bildung, Smart-School-Projekt, Programmierung, Webentwicklung, Sensordatenverwaltung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert: Teil I analysiert den halbjahresübergreifenden Informatikunterricht; Teil II befasst sich mit Projektunterricht im Informatikunterricht; Teil III beschreibt den Einsatz von Mikrocontrollern im Unterricht; Teil IV präsentiert das Smart-School-Projekt als Beispiel für halbjahresübergreifenden Unterricht mit einem Mikrocontroller-Projekt.
- Quote paper
- Nouaim Al Hahbare (Author), 2021, Informatikunterricht mit Mikrocontroller-Projekt im Gymnasium. Grundlagen und Kriterien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1317216