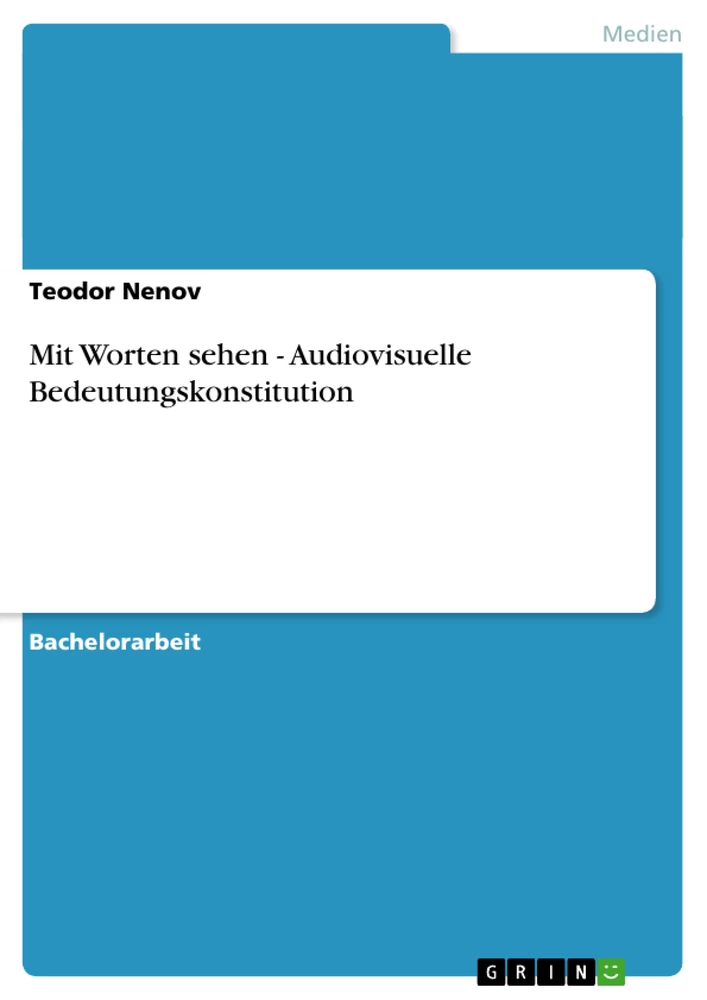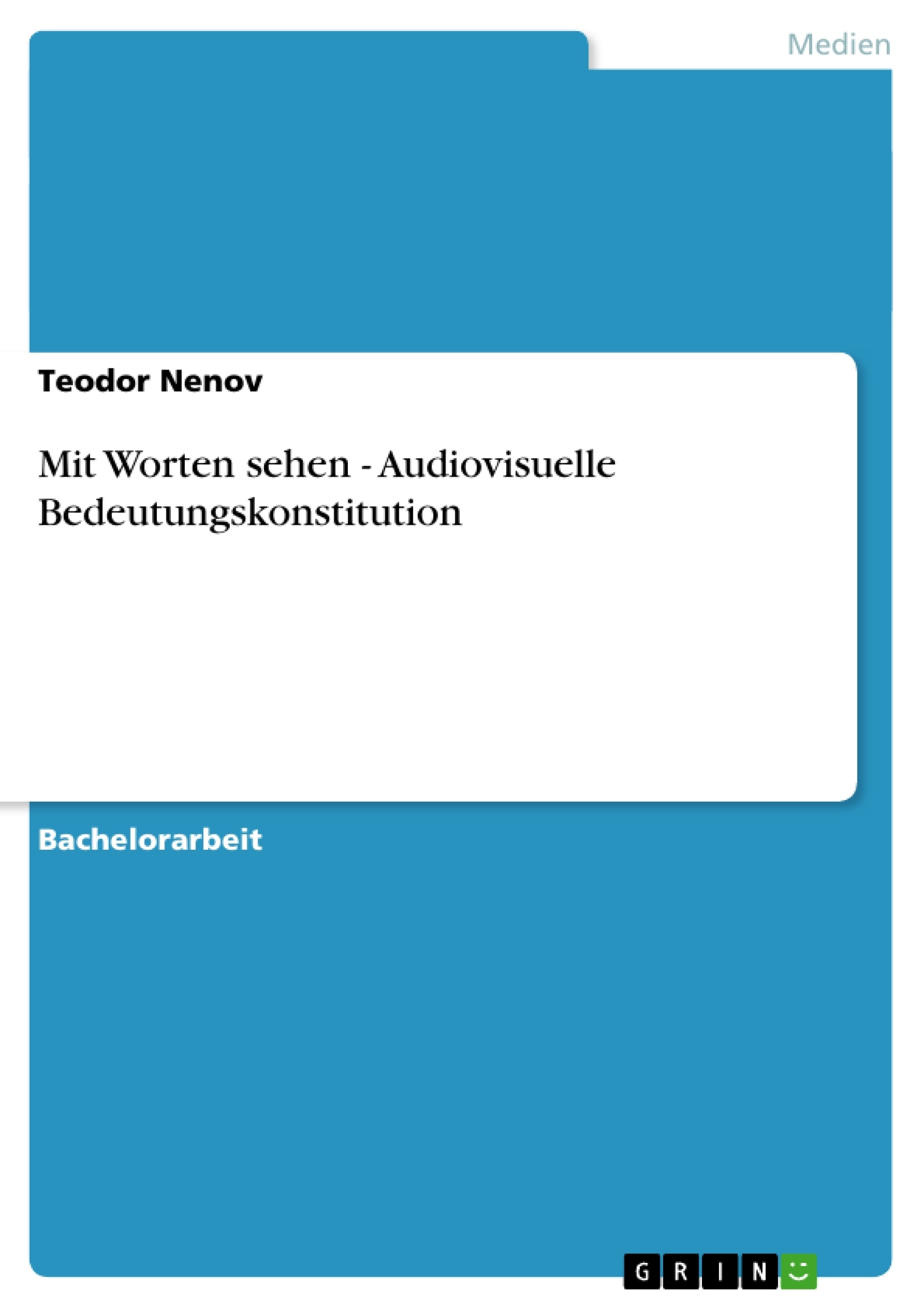Der Schwerpunkt der folgenden Bachelorarbeit liegt darauf, wie das Fernsehmaterial, bestehend aus unterschiedlichen Zeichen – überwiegend aus gesprochener Sprache und bewegten Bildern –, von einer heterogenen Masse rezipiert und wie der sogenannte „Bild-Text-Reißverschluss“ genauer erklärt werden kann. Zunächst wird der aktuelle Stand der Fernsehforschung kurz erläutert, woraufhin einige Forschungsergebnisse vorgestellt werden, auf die sich u.a. die vorliegende Arbeit stützt. Der zweite Teil wird sich damit befassen, welche Zeichen bzw. Codes im Fernsehmaterial enthalten sind, und anschließend wird veranschaulicht, dass audiovisuelle Bedeutung nicht in einer Zeichenart alleine entsteht, sondern nur im Zusammenspiel von bewegten Bildern und Sprache, also
über ihre audiovisuelle Performativität. Dieses Zusammenspiel der Codes wird anhand eines aktuellen Beispiels aus einer Nachrichtensendung untersucht.
Im dritten Teil wird speziell die Rezeption von Fernsehtexten thematisiert. Dabei werden zwei gegensätzliche Positionen zur Rezeptionsleistung der Fernsehzuschauer vorgestellt: Die eine behauptet, die Wirkung von Fernsehen entfalte sich nach dem sogenannten Stimulus-Response-Vorgang bzw. nach dem berühmten ‚Geschossprinzip‘ (‚bullet‘-Theorie). Die andere Position geht davon aus, dass „Rezeption nicht nur passiv ‚erlitten‘, sondern immer auch aktiv verarbeitet wird“.
Der fünfte und letzte Teil wird die audiovisuelle Bedeutungskonstitution anhand der von Jäger entworfenen ‚Transkriptivitätstheorie‘ erklären und verdeutlichen, dass Sinn konstituiert wird, indem verschiedene Symbolsysteme in transkriptive Beziehung gebracht werden. Anhand von Jägers Theorie wird die Bedeutungskonstitution durch Fernsehen und das audiovisuelle Muster ‚Mit Worten sehen‘ näher erläutert. In diesem Teil geht es insbesondere darum, Audiovisualität als eine wechselseitige Transkription von Bildern und Sprache zu erklären, wobei ‚unlesbar‘ gewordene Ausschnitte einer Zeichenart wieder oder anders ‚lesbar‘ gemacht werden. An dieser Stelle wird das Nachrichtenbeispiel dazu verwendet zu veranschaulichen, dass sprachliche und bildliche Zeichenbedeutungen nicht einfach zusammengefügt und addiert werden, sondern bedingt durch ihre transkriptive Beziehung neue Bedeutungen hervorbringen können, die weder dem Bild noch der Sprache alleine zu entnehmen sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Teil: Stand der Forschung
- II. Teil: Die semiotische Fernsehlandschaft
- II.1 Multikodalität am Beispiel einer Nachrichtensendung
- II.1.1 Sprechsprache
- II.1.2 Bewegte Bilder
- II.1.3 Auditive Inserts
- II.1.4 Visuelle Inserts
- II.2 Audiovisuelle Einwegkommunikation
- II.3 Audiovisuelle Performativität
- III. Teil: Rezeption
- III.1 Offene Struktur des Fernsehtextes
- III.2 Passiver vs. aktiver Zuschauer
- IV. Teil: Zusammenspiel der Fernsehzeichen
- IV.1 Zum Begriff der Transkription
- IV.2 Bedeutungskonstitution durch intermediale Transkription
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der audiovisuellen Bedeutungskonstitution im Fernsehen. Sie analysiert, wie Fernsehmaterial, bestehend aus verschiedenen Zeichen wie Sprache und Bildern, von Zuschauern rezipiert wird und wie der „Bild-Text-Reißverschluss“ funktioniert. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Codes und Zeichen im Fernsehmaterial und zeigt auf, wie audiovisuelle Bedeutung durch das Zusammenspiel von Sprache und Bildern entsteht.
- Analyse der multimodalen Struktur von Fernsehsendungen
- Untersuchung der Rolle von Sprache und Bildern in der Bedeutungskonstitution
- Rezeption von Fernsehtexten und die Frage nach passiver vs. aktiver Rezeption
- Erklärung der audiovisuellen Bedeutungskonstitution durch die Transkriptivitätstheorie
- Veranschaulichung der Thesen anhand eines Beispiels aus einer Nachrichtensendung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Fernsehforschung und stellt wichtige Forschungsergebnisse vor. Der zweite Teil analysiert die verschiedenen Codes und Zeichen im Fernsehmaterial, insbesondere Sprache, bewegte Bilder, auditive und visuelle Inserts. Er zeigt auf, wie diese Codes zusammenwirken und audiovisuelle Bedeutung erzeugen. Der dritte Teil befasst sich mit der Rezeption von Fernsehtexten und stellt zwei gegensätzliche Positionen zur Rezeptionsleistung der Fernsehzuschauer vor: die passive und die aktive Rezeption. Der vierte Teil erklärt die audiovisuelle Bedeutungskonstitution anhand der Transkriptivitätstheorie und verdeutlicht, wie Sinn durch die transkriptive Beziehung verschiedener Symbolsysteme konstituiert wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die audiovisuelle Bedeutungskonstitution, die multimodale Struktur von Fernsehsendungen, die Rolle von Sprache und Bildern in der Bedeutungskonstitution, die Rezeption von Fernsehtexten, die Transkriptivitätstheorie und die Analyse von Nachrichtensendungen als Beispiel für die audiovisuelle Bedeutungskonstitution.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „Bild-Text-Reißverschluss“?
Es beschreibt das enge Zusammenspiel von gesprochener Sprache und bewegten Bildern im Fernsehen, durch das erst eine audiovisuelle Bedeutung entsteht.
Was besagt die „Transkriptivitätstheorie“ von Jäger?
Sinn wird konstituiert, indem verschiedene Symbolsysteme (Bild und Sprache) in eine transkriptive Beziehung gebracht werden, wobei sie sich gegenseitig „lesbar“ machen.
Sind Fernsehzuschauer passive Empfänger?
Die Arbeit stellt zwei Positionen gegenüber: Die „Bullet-Theorie“ (passiv) und die Ansicht, dass Rezeption ein aktiver Verarbeitungsprozess des Zuschauers ist.
Wie wird Audiovisualität in der Arbeit untersucht?
Anhand eines Beispiels aus einer Nachrichtensendung wird analysiert, wie Sprechsprache, Bilder sowie auditive und visuelle Inserts zusammenwirken.
Was bedeutet „audiovisuelle Performativität“?
Es bedeutet, dass Bedeutung nicht in einer Zeichenart allein entsteht, sondern erst durch den Vollzug des Zusammenspiels von Bild und Ton generiert wird.
- Quote paper
- Teodor Nenov (Author), 2009, Mit Worten sehen - Audiovisuelle Bedeutungskonstitution, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/131278