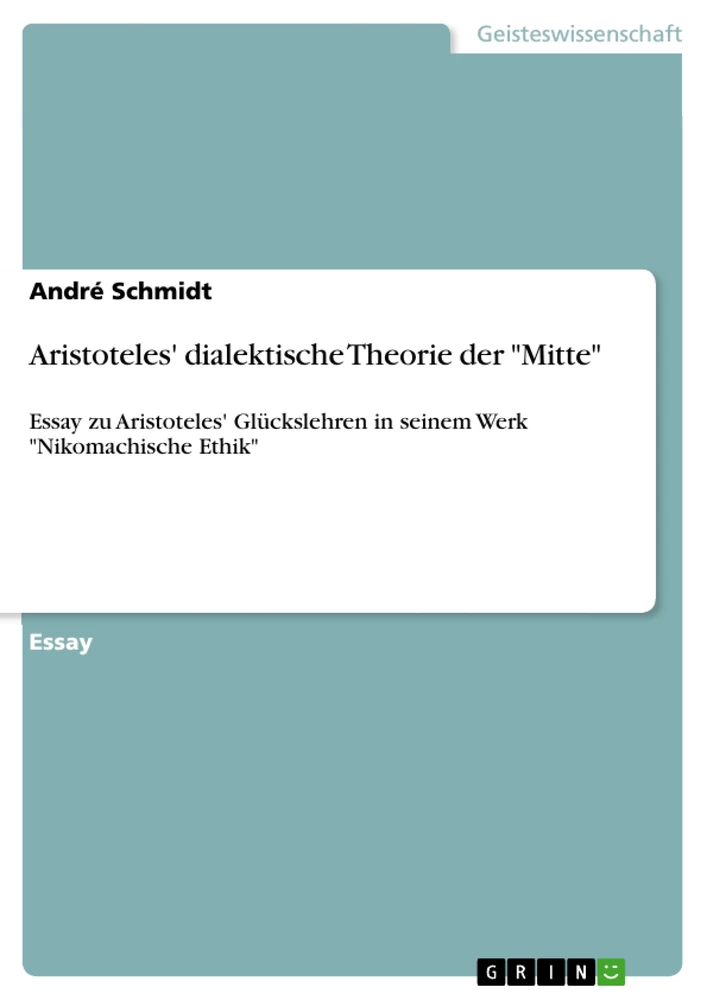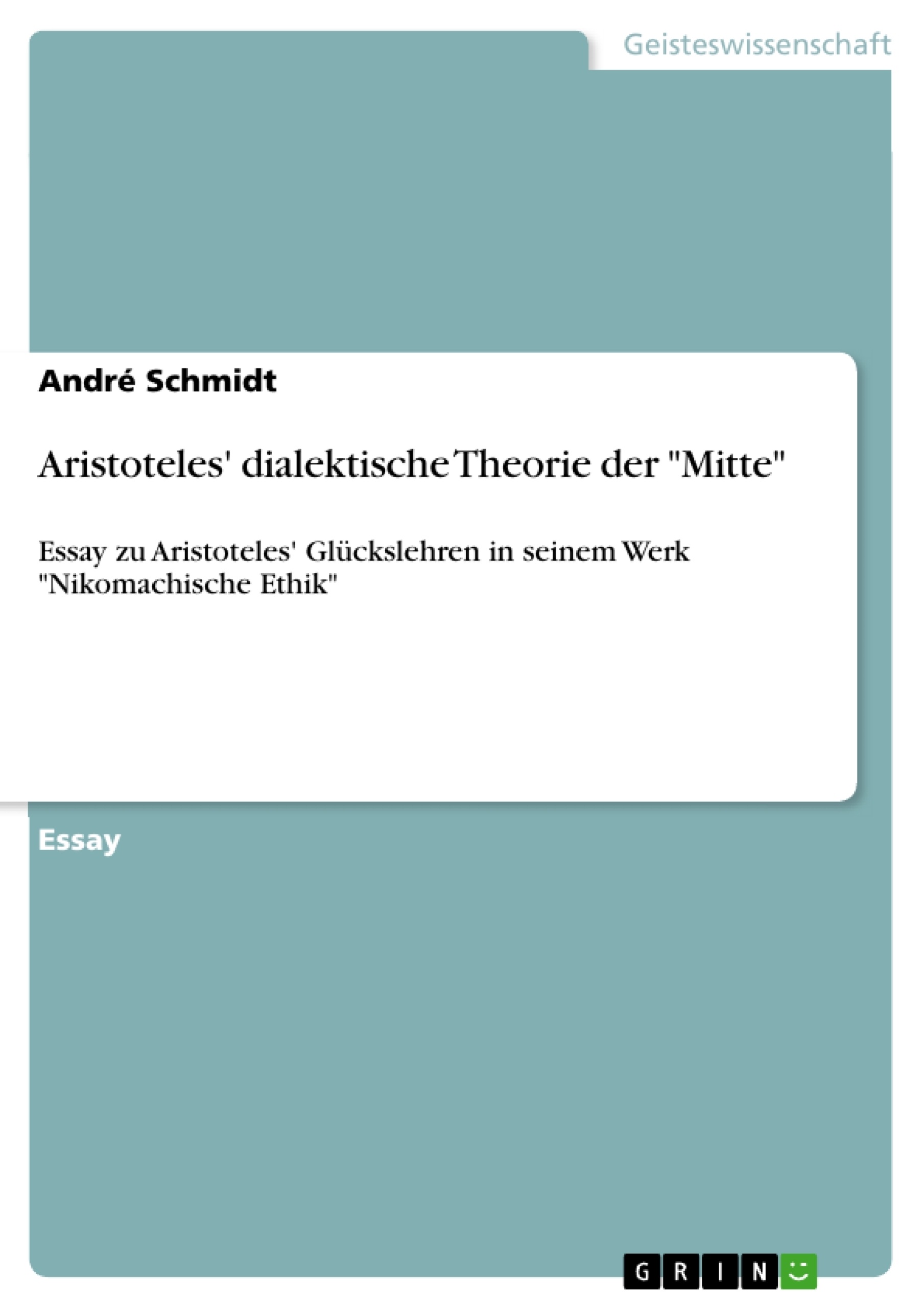Der zu behandelnde Text ARISTOTELES´, Nikomachische Ethik, Buch II, Kapitel 6 bis 9 ist ein Auszug aus ARISTOTELES´ Glückslehre. ARISTOTELES, welcher 384 v. Chr. in Stagira geboren wurde (gest. 322 v. Chr.) ist wahrscheinlich der bedeutendste Philosoph der Antike, dessen Name bis heute mit dem Begriff des Logischen
Denkens verbunden ist. Sein Einfluss auf die Entwicklung des abendländischen Denkens war so entscheidend, dass man sich fragen muss: Wie wäre sie ohne ihn verlaufen? Das Selbe trifft auch für sein Konzept der Eudaimonia zu, welches in die Nikomachische Ethik eingebettet ist. Glückseligkeit ist für ARISTOTELES die Verwirklichung der vernünftigen Natur durch die Tätigkeit der Seele. Nach ARISTOTELES ist derjenige glücklich zu nennen, welcher gemäß vollendeter Tugend wirkt und über die notwendigen äußeren Güter in ausreichendem Maße verfügt.
Inhaltsverzeichnis
- Aristoteles' dialektische Theorie der „Mitte“
- Die „Mitte“ als Tugend
- Tugend und Mitte
- Die Mitte zwischen zwei Extremen
- Die Mitte als Gegensatz zu den Extremen
- Die Mitte als Übermaß und Mangel
- Die Ähnlichkeit zwischen Mitte und Extremen
- Die Schwierigkeit, die richtige Mitte zu finden
- Die richtige Mitte in der Gesellschaft
- Die richtige Mitte im sozialen Umfeld
- Die richtige Mitte im Sinne der Güte und Menschlichkeit
- Die richtige Mitte als Baustein der Weisheitslehre
- Die richtige Mitte und der Ehrgeiz
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Aristoteles' dialektische Theorie der „Mitte“ im Kontext seiner Glückslehre, die in der Nikomachischen Ethik dargelegt wird. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der „Mitte“ als Tugend und deren Rolle in der menschlichen Handlungsweise.
- Die „Mitte“ als Tugend und ihre Bedeutung für ein glückliches Leben
- Die dialektische Methode zur Bestimmung der richtigen Mitte zwischen zwei Extremen
- Die Rolle der Vernunft bei der Wahl der richtigen Mitte
- Die Bedeutung der „Mitte“ für das soziale Zusammenleben und die politische Gemeinschaft
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten, die richtige Mitte im menschlichen Leben zu finden
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in Aristoteles' Glückslehre und seiner Theorie der „Mitte“. Er erläutert, dass die „Mitte“ als Tugend zwischen zwei Extremen liegt, die als Laster betrachtet werden. Die Vernunft spielt dabei eine entscheidende Rolle, um die richtige Mitte zu bestimmen. Der Text beleuchtet verschiedene Beispiele für Tugenden, wie Mut, Mäßigkeit und Freigiebigkeit, und zeigt, wie die „Mitte“ in diesen Bereichen erreicht werden kann.
Im weiteren Verlauf des Textes wird die dialektische Methode Aristoteles' zur Bestimmung der richtigen Mitte näher betrachtet. Es wird gezeigt, dass die Mitte sowohl im Vergleich zum Mangel als auch zum Übermaß als ein Extrem betrachtet werden kann. Der Text analysiert auch die Ähnlichkeiten zwischen der Mitte und den Extremen und die Schwierigkeiten, die richtige Mitte im menschlichen Leben zu finden.
Der Text betont die Bedeutung der „Mitte“ für das soziale Zusammenleben und die politische Gemeinschaft. Aristoteles argumentiert, dass die „Mitte“ notwendig ist, um ein harmonisches und glückliches Leben in der Gesellschaft zu führen. Er zeigt, wie die „Mitte“ in verschiedenen Bereichen des Lebens, wie der Wirtschaft, der Politik und den zwischenmenschlichen Beziehungen, eine wichtige Rolle spielt.
Schließlich werden die Herausforderungen und Möglichkeiten, die richtige Mitte im menschlichen Leben zu finden, diskutiert. Der Text betont, dass es zwar schwierig ist, die richtige Mitte immer zu finden, aber dass es dennoch wichtig ist, sich bemühen, sie zu erreichen. Er zeigt, dass die „Mitte“ nicht nur ein theoretisches Konzept ist, sondern eine praktische Lebenshilfe, die zu einem glücklicheren und erfüllten Leben führen kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Aristoteles, Nikomachische Ethik, dialektische Theorie, „Mitte“, Tugend, Laster, Vernunft, Glückseligkeit, soziale Gemeinschaft, politische Gemeinschaft, menschliche Handlungsweise, Herausforderungen, Möglichkeiten.
- Quote paper
- André Schmidt (Author), 2004, Aristoteles' dialektische Theorie der "Mitte", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/131211