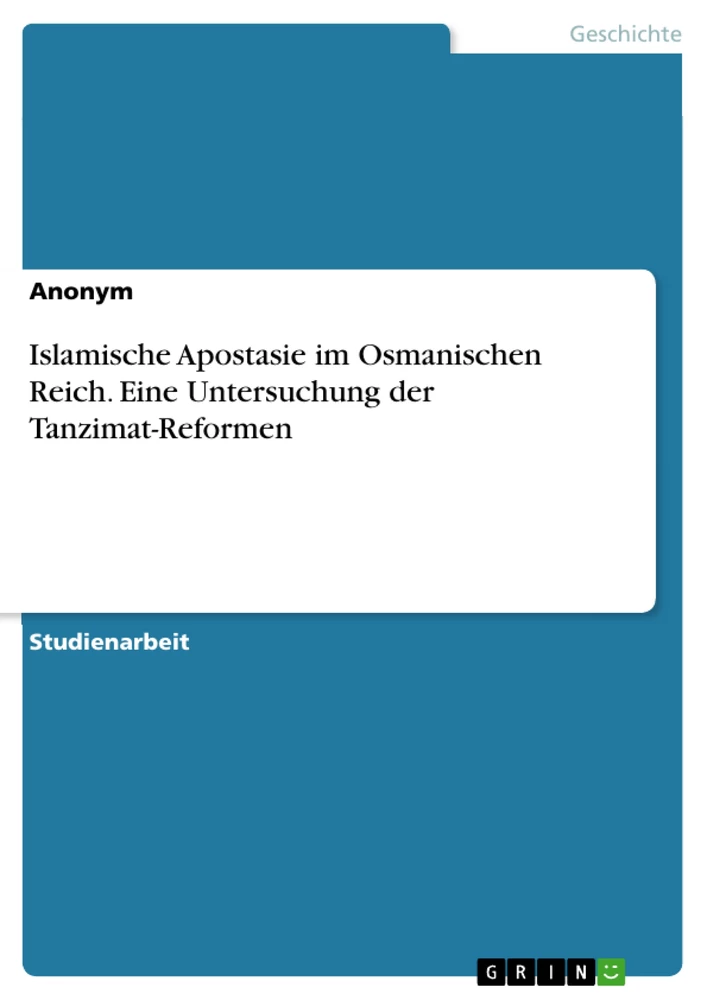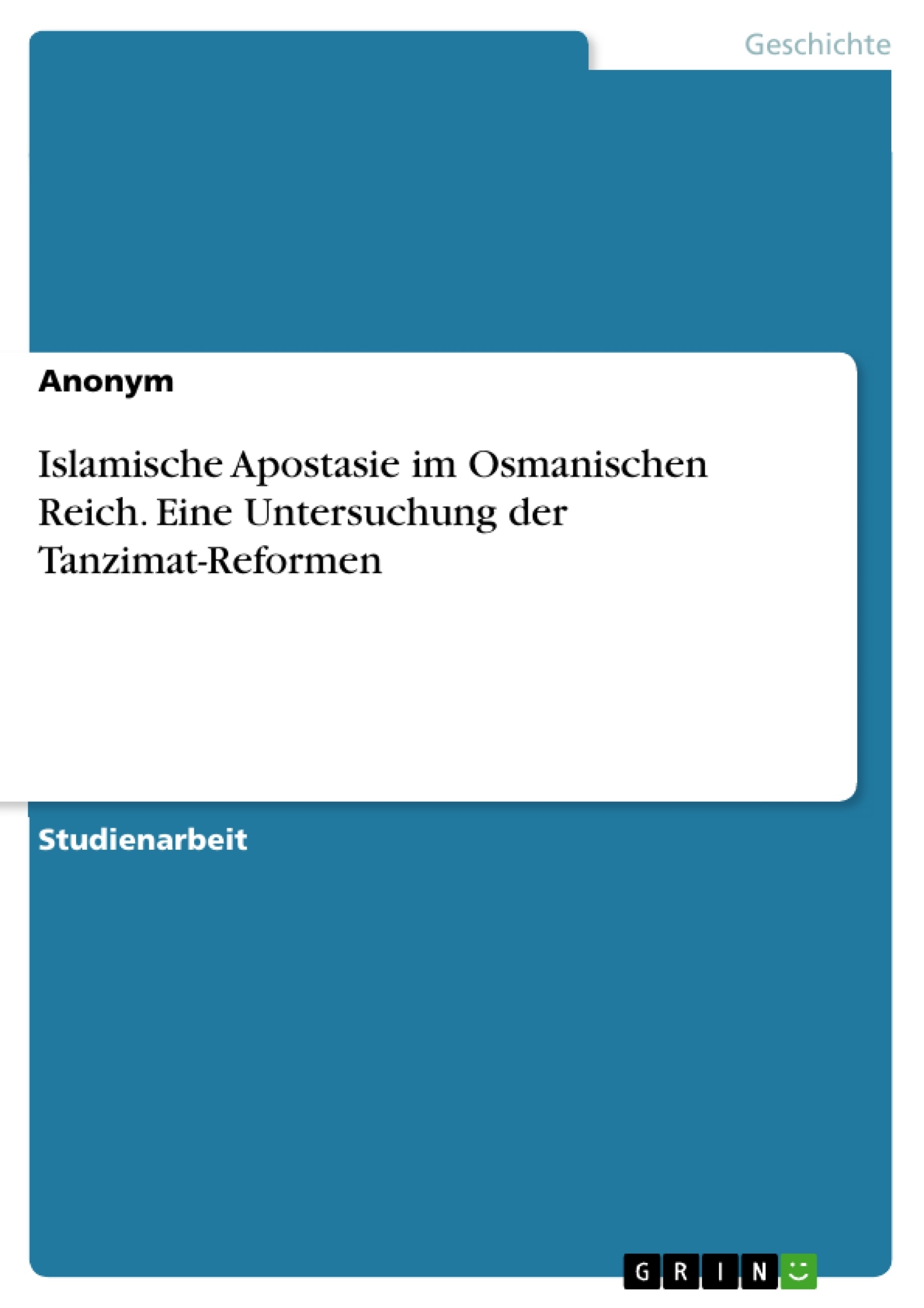Das Osmanische Reich gilt als eine der größten und erfolgreichsten Dynastien der Geschichte, das sich vor allem dadurch auszeichnete, eine tolerante Haltung gegenüber anderen abrahamitischen Religionen als die des Islams einzunehmen. Die Befolgung des Millet-Systems erlaubte es nichtmuslimischen Bürgern ihre Religion zu einem gewissen Grade und unter bestimmten Voraussetzungen auszuüben, jedoch war der Alltag der sogenannten Dhimmis (Schutzbefohlenen) auch von starken Einschränkungen geprägt. Unter anderem führte dies bei der nichtmuslimischen Gesellschaft gemeinsam mit dem Aufstieg der christlichen Weltmacht mit der Zeit zu einer spürbaren Verringerung der ethnisch-nationalen Verbundenheit zum Osmanischen Reich. Die Thematik der Religionsfreiheit und der Apostasie, sowie das Einmischen der europäischen Großmächte und das zwanghafte Festhalten an Tradition waren weitere Aspekte, die zu einer schwerwiegenden Problematik für die osmanische Herrschaft im 19. Jahrhundert wurden. Um eine konfessionell-übergreifende Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich zu konstituieren und dem Zerfall des Reiches entgegenzuwirken, wurden deshalb verschiedene Reformen ins Leben gerufen. Die Tanzimat-Ära sollte in der Theorie durch die Gleichstellung aller Religionen und die Nichtigkeit vorheriger Einschränkungen – aber auch Privilegien, eine positive Auswirkung auf die Sicht aller Bürger bezüglich ihrer Identität zum Osmanischen Reich und ihrem Gefühl von nationaler Einheit erzielen und ein Schritt in Richtung Modernisierung sein. Vielmehr jedoch führten die Verordnungen eher zu weiteren politischen sowie sozialen Brüchen innerhalb der Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von islamischen Apostaten
- Apostasie und Bestrafungspraxis im Islam
- Der Koran
- Der Hadith
- Die vier sunnitischen Rechtsschulen
- Die Behandlung von Apostaten im Osmanischen Reich
- Hatt-i Şerif von Gülhane (1839)
- Hatt-ı Hümâyûn Edikt (1856)
- Das Grundgesetz von 1876
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Behandlung von islamischen Apostaten im Osmanischen Reich während der Tanzimat-Ära. Sie untersucht, wie sich die osmanischen Reformen mit den islamischen Rechtsgrundlagen vereinbaren ließen, insbesondere im Hinblick auf die Scharia-Bestimmung zur Bestrafung von Apostasie. Dabei stehen die Frage im Vordergrund, ob die Reformen in der Praxis nur für nichtmuslimische Bürger galten oder auch eine Anpassung des islamischen Glaubens stattfand und ob muslimische Apostaten trotz der Reformen weiterhin nach Scharia bestraft wurden.
- Die Definition von islamischer Apostasie und deren Problematik
- Die Bestrafungspraxis für Apostasie im Islam und die Rolle des Korans, des Hadith und der vier sunnitischen Rechtsschulen
- Die Reformen der Tanzimat-Ära und deren Auswirkungen auf die Behandlung von Apostaten im Osmanischen Reich
- Die Frage der Religionsfreiheit im Osmanischen Reich und die Spannungen zwischen islamischem Recht und europäischen Einflüssen
- Die Kontroverse über die Todesstrafe für islamische Apostasie und ihre Auswirkungen auf das Bild des Islams in der westlichen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Kernfragen der Arbeit dar. Sie beleuchtet die historische Situation des Osmanischen Reiches im 19. Jahrhundert und die Herausforderungen der Tanzimat-Ära, die durch die Konflikte zwischen traditionellem islamischem Recht und dem europäischen Einfluss geprägt waren. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition von islamischer Apostasie und den Schwierigkeiten einer objektiven und universalen Begriffserklärung. Es werden verschiedene Merkmale und Problematiken der Apostasie hervorgehoben, wobei die Subjektivität bei der Beurteilung von Apostasie und die unterschiedlichen Ansichten islamischer Gelehrter und Rechtsschulen im Fokus stehen. Kapitel 3 untersucht die Bestrafungspraxis für Apostasie im Islam, wobei die Hauptquellen des islamischen Rechts, der Koran, der Hadith und die vier sunnitischen Rechtsschulen, in Bezug auf die Legitimierung der Todesstrafe beim Abfall vom Islam analysiert werden. Dieses Kapitel bildet die Grundlage für die Untersuchung der Tanzimat-Reformen und deren Auswirkungen auf die Behandlung von Apostaten im Osmanischen Reich.
Schlüsselwörter
Islamischer Apostat, Apostasie, Scharia, Tanzimat-Ära, Osmanisches Reich, Religionsfreiheit, Todesstrafe, Koran, Hadith, Sunna, Rechtsschulen, Millet-System, Dhimmis, Europäische Großmächte, Islamisches Recht, Geschichte, Kultur, Politik, Toleranz.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Islamische Apostasie im Osmanischen Reich. Eine Untersuchung der Tanzimat-Reformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1311580