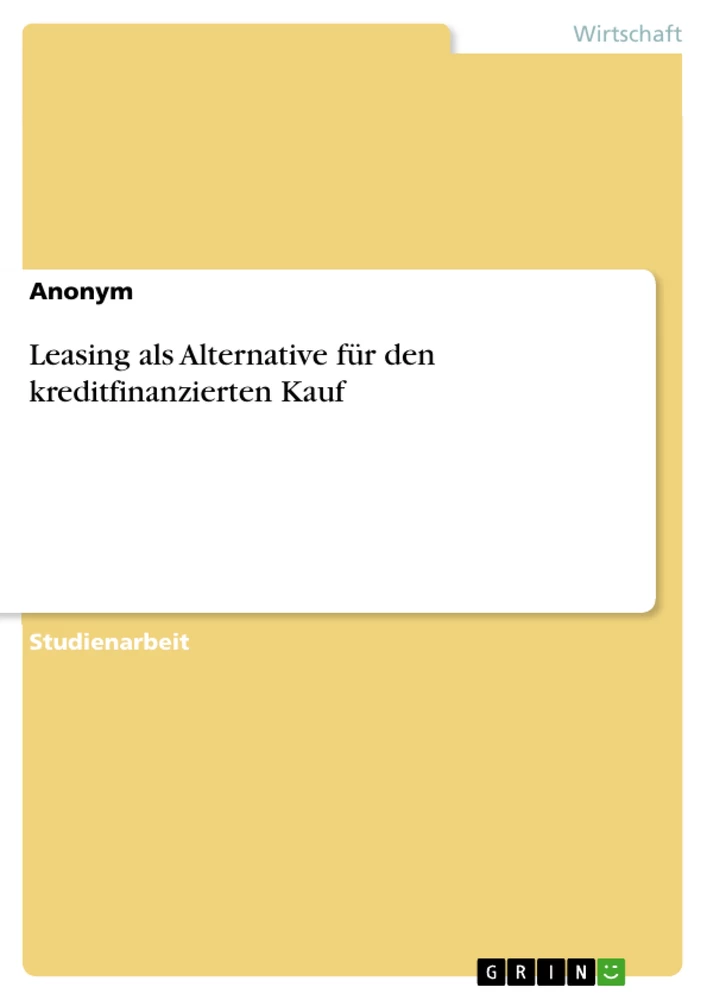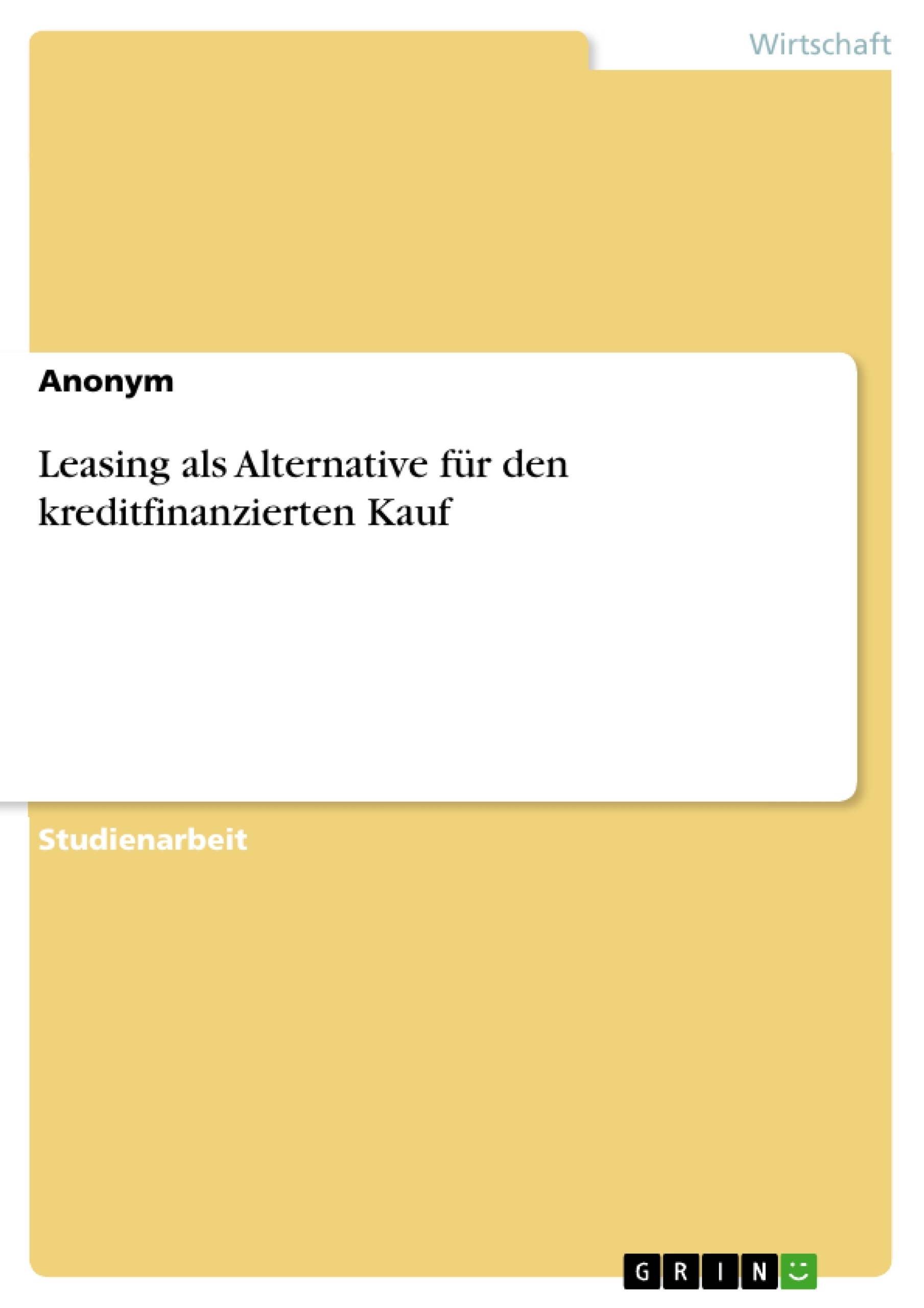Obwohl das Leasing schon seit Jahren eine etablierte Form der Finanzierung ist, gibt es immer noch sehr viele Menschen, die sich nicht ausreichend mit dieser alternativen Form der Finanzierung auskennen. Besonders im unternehmerischen Investieren ist Leasing eine Möglichkeit, die genauer betrachtet werden sollte. Durch die Digitalisierung und einen sich immer rasanter beschleunigenden technischen Fortschritt ist der Bedarf an technischen Produkten sehr hoch, sodass ein entsprechendes Budget für den Kauf vorhanden sein muss. Ist nicht genug Budget verfügbar, muss das Produkt finanziert werden. Neben dem klassischen kreditfinanzierten Kauf stellt Leasing eine gute Alternative dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Relevanz
- Zielsetzung der Arbeit
- Methodische Vorgehensweise
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsdefinition Leasing
- Begriffsdefinition Kreditfinanzierung
- Unterschied zwischen Leasing und Miete
- Formen des Leasings
- Operate Leasing
- Finance Leasing
- Mobilienleasing
- Immobilienleasing
- Vollamortisationsleasing
- Teilamortisationsleasing
- Sales-and-Lease-Back Leasing
- Direktes Leasing
- Indirektes Leasing
- Full-Service Leasing
- Vergleich von Leasing und Kreditvertrag
- Steuerliche Aspekte
- Bilanzielle Aspekte
- Betriebswirtschaftliche Aspekte
- Praxisbeispiel
- Praxisbeispiel Leasing Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé
- Praxisbeispiel Mietkauf Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit soll einen umfassenden Vergleich zwischen dem kreditfinanzierten Kauf und dem Leasing vornehmen und die Vor- und Nachteile beider Finanzierungsformen beleuchten. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, ob Leasing als Alternative zur Kreditfinanzierung bei Investitionsgütern in Betracht gezogen werden sollte.
- Definition und Abgrenzung von Leasing und Kreditfinanzierung
- Analyse verschiedener Leasingformen
- Vergleich von Leasing und Kreditfinanzierung hinsichtlich steuerlicher, bilanzieller und betriebswirtschaftlicher Aspekte
- Praxisbeispiel zur Illustration der Anwendung von Leasing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Relevanz von Leasing als Finanzierungsinstrument dar und beschreibt die Zielsetzung sowie die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Leasing und Kreditfinanzierung definiert und voneinander abgegrenzt. Der dritte Abschnitt beleuchtet verschiedene Formen des Leasings, um die Vielfalt dieser Finanzierungsform zu verdeutlichen. Kapitel 4 führt einen Vergleich zwischen Leasing und Kreditvertrag hinsichtlich steuerlicher, bilanzieller und betriebswirtschaftlicher Aspekte durch. Im fünften Kapitel wird anhand eines Praxisbeispiels die Anwendung von Leasing in der Praxis illustriert.
Schlüsselwörter
Leasing, Kreditfinanzierung, Investitionsgüter, Finanzierungsformen, Betriebswirtschaft, Steuern, Bilanz, Praxisbeispiel, Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Leasing und Kreditkauf?
Beim Kreditkauf erwirbt man das Eigentum am Objekt sofort, während man beim Leasing lediglich die Nutzung für einen bestimmten Zeitraum bezahlt und das Objekt Eigentum des Leasinggebers bleibt.
Welche steuerlichen Vorteile bietet Leasing für Unternehmen?
Leasingraten können in der Regel als Betriebsausgaben voll steuerlich abgesetzt werden, was die Steuerlast mindert und die Liquidität schont.
Was ist „Finance Leasing“?
Finance Leasing ist eine langfristige Form des Leasings, bei der die Raten meist die gesamten Anschaffungskosten decken (Vollamortisation) und das Investitionsrisiko beim Leasingnehmer liegt.
Was bedeutet „Sales-and-Lease-Back“?
Ein Unternehmen verkauft ein eigenes Anlagegut (z.B. eine Immobilie) an eine Leasinggesellschaft und least es sofort zurück, um kurzfristig Liquidität zu gewinnen.
Ist Leasing immer günstiger als ein Kredit?
Nicht zwingend. Leasing bietet zwar Liquiditätsvorteile und „Pay-as-you-earn“-Strukturen, kann aber über die gesamte Laufzeit durch Gebühren und Zinsen teurer sein als ein klassischer Bankkredit.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Leasing als Alternative für den kreditfinanzierten Kauf, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1308654