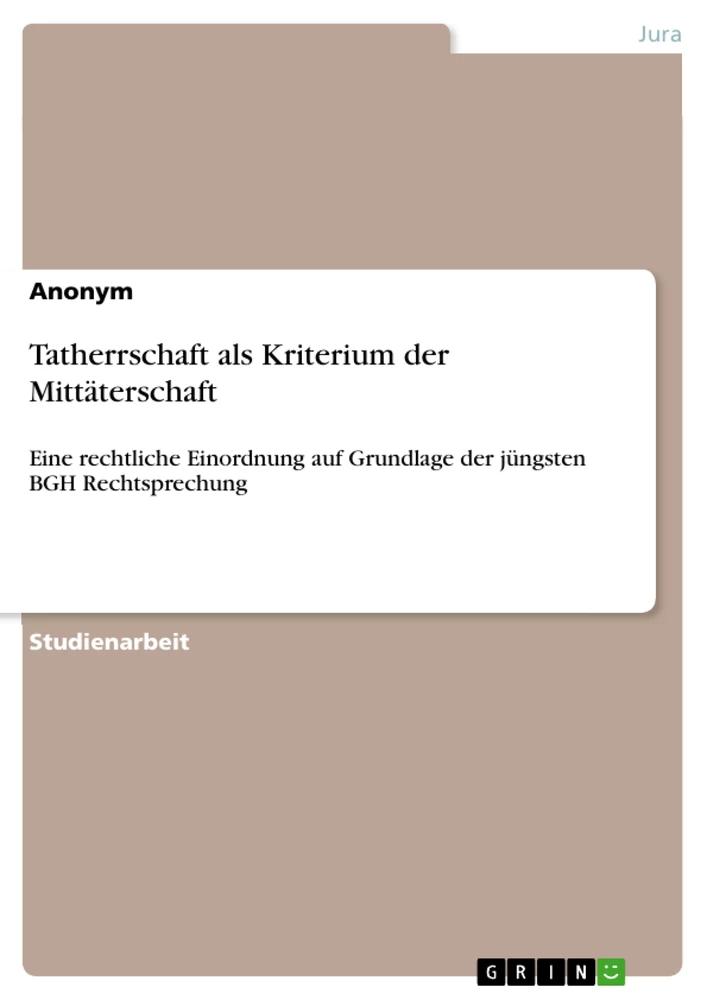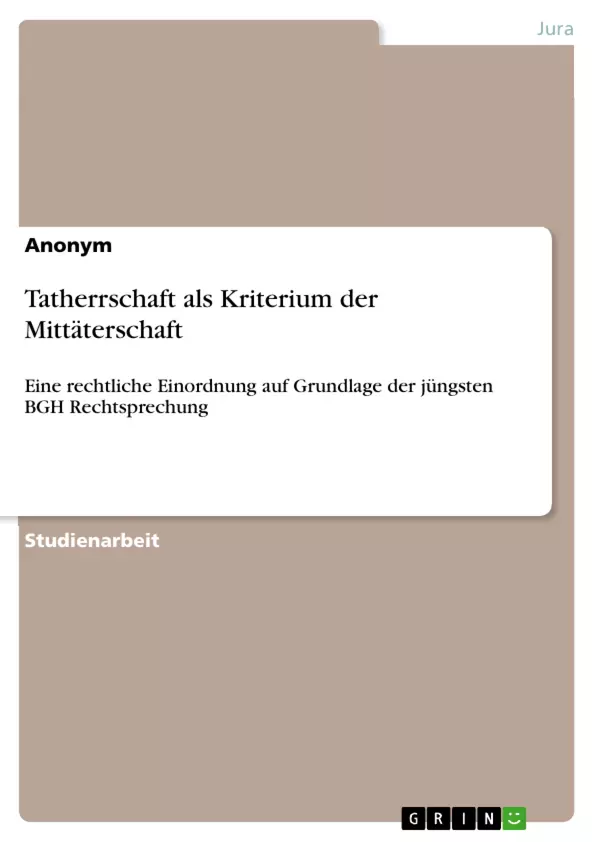Im Rahmen dieser Arbeit wird an einem zuvor skizziertem Beispiel herausgearbeitet, ob ein als Mittäter verurteilter Täter sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen in derselben Qualität verwirklicht haben muss, wie der Täter selbst, oder wie hoch der (qualitative) Anteil am Tatgeschehen tatsächlich sein muss, um ihn rechtssicher als Mittäter und nicht nur als Beteiligten, beispielsweise als Anstifter oder Gehilfen, verurteilen zu können.
Schwerpunkt dieser Rechtsproblematik und damit der vorzulegenden Arbeit ist das Element der Tatherrschaft als Kriterium für die Annahme der Mittäterschaft. Die Fragestellung der Arbeit widmet sich damit auch aus aktuellem Anlass einem rechtsdogmatischen "Klassiker", dem der BGH durch den Beschluss
aus dem Jahre 2017 neue Dynamik verliehen hat und der, wie diese Arbeit ebenfalls aufzeigen wird, damit gewiss noch nicht nachhaltig erledigt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Stand der Wissenschaft
- Methodik
- Theoretischer Hintergrund
- Begriffsdefinition
- Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme
- Der Tatbestand der Beihilfe
- Begriffsdefinition
- BGH Beschluss vom 11.07.2017, 2 StR 220/17
- Beschluss
- Beschlussbegründung
- Mittäterschaft vs. Beihilfe
- Diskussion
- Kritik am Beschluss des BGH
- Befürworter des normativen Kombinationsansatzes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die umstrittene Frage der Tatherrschaft als Kriterium für Mittäterschaft im deutschen Strafrecht, insbesondere im Kontext des BGH-Beschlusses vom 11.07.2017 (2 StR 220/17). Ziel ist es, die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe zu klären und die Anforderungen an die Tatherrschaft für eine Mittäterverurteilung zu definieren.
- Abgrenzung von Mittäterschaft und Beihilfe
- Das Kriterium der Tatherrschaft für die Mittäterschaft
- Auslegung des BGH-Beschlusses vom 11.07.2017
- Kritik an verschiedenen Rechtsauffassungen
- Aktuelle Rechtsprechung und Literatur zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Tatherrschaft als Kriterium der Mittäterschaft ein und stellt den BGH-Beschluss vom 11.07.2017 (2 StR 220/17) als zentralen Untersuchungsgegenstand vor. Der Fall, der diesem Beschluss zugrunde liegt, wird kurz skizziert, um den Kontext der folgenden Analyse zu schaffen. Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage der Arbeit.
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert die notwendigen begrifflichen Grundlagen. Es definiert die Begriffe Täterschaft und Teilnahme und grenzt diese voneinander ab. Besonders detailliert wird der Tatbestand der Beihilfe erläutert, um ihn von der Mittäterschaft abzugrenzen. Die Bedeutung der Tatherrschaft als zentrales Unterscheidungskriterium wird hier ausführlich dargelegt und verschiedene juristische Ansätze werden beleuchtet.
BGH Beschluss vom 11.07.2017, 2 StR 220/17: Dieses Kapitel analysiert den BGH-Beschluss vom 11.07.2017 detailliert. Es wird der Beschluss selbst wiedergegeben und seine Begründung eingehend untersucht. Die Entscheidung des BGH bezüglich der Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe im konkreten Fall wird kritisch beleuchtet und in den Kontext der bestehenden Rechtsprechung eingeordnet. Die Argumentation des Gerichts wird analysiert und auf ihre Schlüssigkeit geprüft.
Diskussion: In diesem Kapitel werden verschiedene Meinungen und kritische Auseinandersetzungen mit dem BGH-Beschluss präsentiert. Die Kritikpunkte werden detailliert dargestellt und mit argumentativen Gegenpositionen konfrontiert. Der normative Kombinationsansatz wird vorgestellt und diskutiert, um die unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem der Tatherrschaft zu verdeutlichen. Das Kapitel zeigt die anhaltende Debatte um dieses juristische Problem auf.
Schlüsselwörter
Tatherrschaft, Mittäterschaft, Beihilfe, Strafrecht, BGH, Beschluss 11.07.2017, 2 StR 220/17, Tatbeitrag, Rechtsprechung, Rechtsdogmatik, normativer Kombinationsansatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Tatherrschaft als Kriterium für Mittäterschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die umstrittene Frage der Tatherrschaft als Kriterium für Mittäterschaft im deutschen Strafrecht. Der Fokus liegt dabei auf dem BGH-Beschluss vom 11.07.2017 (2 StR 220/17) und der Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe zu klären und die Anforderungen an die Tatherrschaft für eine Mittäterverurteilung zu definieren. Die Arbeit analysiert den BGH-Beschluss kritisch und setzt sich mit verschiedenen Rechtsauffassungen auseinander.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Abgrenzung von Mittäterschaft und Beihilfe, das Kriterium der Tatherrschaft, Auslegung des BGH-Beschlusses vom 11.07.2017, Kritik an verschiedenen Rechtsauffassungen und die aktuelle Rechtsprechung und Literatur zum Thema.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund (mit Begriffsdefinitionen), eine detaillierte Analyse des BGH-Beschlusses vom 11.07.2017 (2 StR 220/17), eine Diskussion verschiedener Rechtsauffassungen und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was ist der zentrale Untersuchungsgegenstand?
Der zentrale Untersuchungsgegenstand ist der BGH-Beschluss vom 11.07.2017 (2 StR 220/17), der die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe im konkreten Fall behandelt. Die Arbeit analysiert den Beschluss, seine Begründung und die Argumentation des Gerichts kritisch.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Tatherrschaft, Mittäterschaft, Beihilfe, Strafrecht, BGH, Beschluss 11.07.2017, 2 StR 220/17, Tatbeitrag, Rechtsprechung, Rechtsdogmatik, normativer Kombinationsansatz.
Wie wird der Begriff der Tatherrschaft behandelt?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Tatherrschaft als zentrales Unterscheidungskriterium zwischen Mittäterschaft und Beihilfe. Verschiedene juristische Ansätze und die Kritik an diesen werden beleuchtet.
Welche Rechtsauffassungen werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene Meinungen und kritische Auseinandersetzungen mit dem BGH-Beschluss. Der normative Kombinationsansatz wird als Beispiel für unterschiedliche Perspektiven auf das Problem der Tatherrschaft vorgestellt und diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Tatherrschaft als Kriterium der Mittäterschaft, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1307734