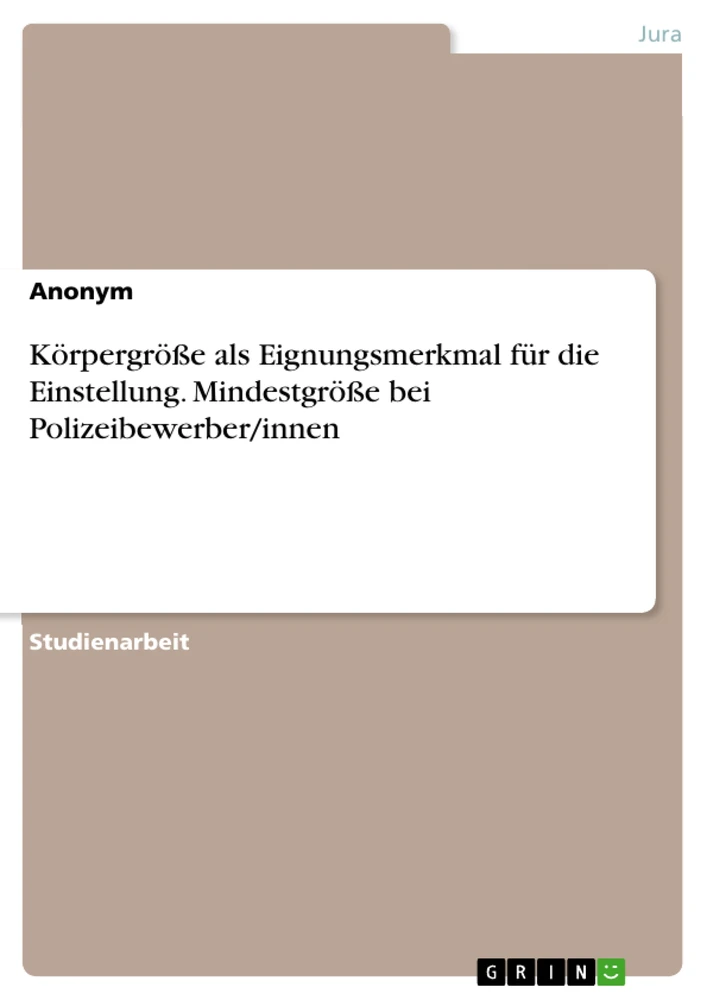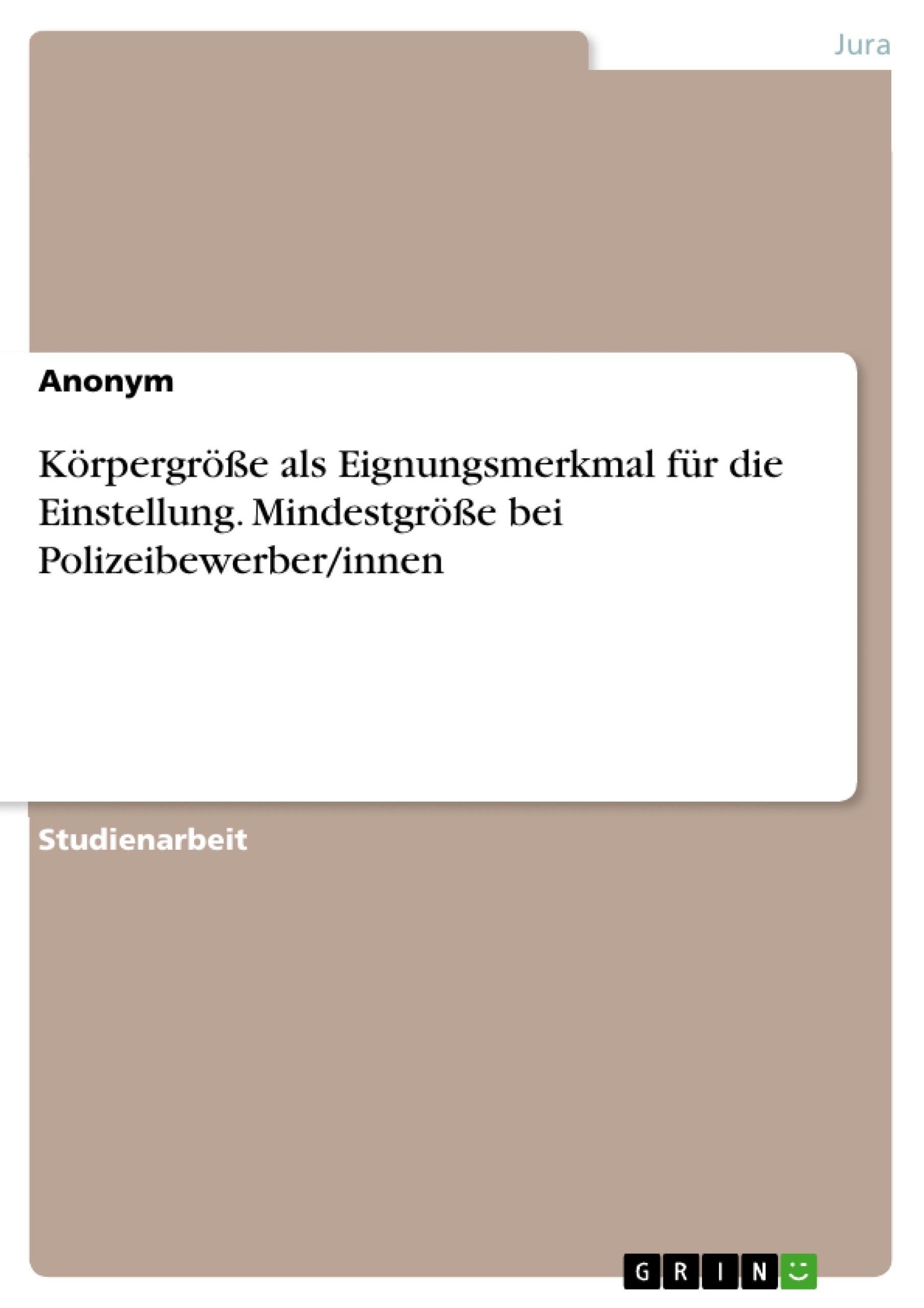Diese Arbeit untersucht zum einen, inwieweit ein juristischer Konflikt zwischen dem Eignungsprinzip nach Art. 33 II GG und dem Gleichheitsgrundsatz zwischen Frau und Mann nach Art. 3 II GG besteht und welche Auswirkungen dies auf etwaige Veränderungen der Einstellungsvoraussetzungen hat. Zum anderen beleuchtet sie, inwieweit die Körpergröße als objektives, sachlich vertretbares Eignungskriterium aus Art. 33 II GG herangezogen werden kann. So stellte beispielsweise das LAFP NRW in einem 2018 gefertigten Bericht deutlich dar, warum es eine Mindestkörpergröße von 163 cm für sachlich geboten hält.
Seit Jahren erfreut sich der Polizeiberuf unter Schulabgängern größter Beliebtheit und lässt die Bewerberzahlen kontinuierlich ansteigen. Bewerberinnen und Bewerber, die sich in Deutschland für den Polizeivollzugsdienst entscheiden, haben sich vor Abgabe ihrer Bewerbung je nach Bundesland mit unterschiedlichen Einstellungskriterien auseinander zu setzen. Dies gilt nicht zuletzt für das Einstellungskriterium der körperlichen Mindestgröße. Während einige Bundesländer eine erforderliche Mindestkörpergröße gänzlich abgeschafft haben, fordern andere eine einheitliche Mindestgröße unabhängig vom Geschlecht. Dass es in der Vergangenheit bei der unterschiedlichen Mindestkörpergröße für Frauen und Männer rechtliche Probleme gab, zeigt sich vor allem an den zahlreichen kürzlich ergangenen Veränderungen in Nordrhein-Westfalen. Hier setzten sich Verwaltungsgerichte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit der Zulässigkeit der Körpergröße als Zugangsbeschränkung, auch in Hinblick auf eine unterschiedliche Behandlung nach Geschlecht, für den Polizeivollzugsdienst auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Relevante Grundrechte
- 2.1 Grundrecht auf Berufsfreiheit gem. Art 12 I GG
- 2.2 Grundrecht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern gem. Art. 33 II GG
- 2.3 Grundrecht auf geschlechtlich Gleichbehandlung gem. § 3 II S. 1 u. III S. 1 GG
- 3 Mindestkörpergrößen bei Einstellung von Polizeibewerber/innen
- 3.1 Aktuelle Einstellungspraxen bei den Polizeien der Länder und des Bundes
- 3.2 Unterschiedliche Mindestkörpergrößen nach Geschlecht in NRW
- 3.3 Unterschiedslose Mindestkörpergrößen als Eignungskriterium
- 3.4 Kritiken am Urteil des OVG Münster zur Mindestkörpergröße
- 3.5 Rechtsprechungen aus anderen Bundesländern
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den juristischen Konflikt zwischen dem Eignungsprinzip nach Art. 33 II GG und dem Gleichheitsgrundsatz zwischen Frau und Mann nach Art. 3 II GG im Kontext der Mindestkörpergrößen für Polizeibewerber/innen. Sie beleuchtet die Auswirkungen auf die Einstellungsvoraussetzungen und prüft die Zulässigkeit der Körpergröße als objektives Eignungskriterium.
- Juristischer Konflikt zwischen Eignungsprinzip (Art. 33 II GG) und Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 II GG)
- Auswirkungen unterschiedlicher Mindestkörpergrößen auf die Einstellungsvoraussetzungen
- Zulässigkeit der Körpergröße als objektives Eignungskriterium
- Analyse aktueller Rechtsprechung und Einstellungspraxen in verschiedenen Bundesländern
- Bewertung der Argumente für und gegen Mindestkörpergrößen bei der Polizei
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die steigende Beliebtheit des Polizeiberufes und die unterschiedlichen Einstellungskriterien der Bundesländer, insbesondere die Mindestkörpergröße. Sie hebt die rechtlichen Probleme hervor, die durch unterschiedliche Mindestkörpergrößen für Frauen und Männer entstanden sind, und fokussiert auf die jüngsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeit soll den juristischen Konflikt zwischen Eignungsprinzip und Gleichheitsgrundsatz untersuchen und die Zulässigkeit der Körpergröße als Eignungskriterium beleuchten, unter Bezugnahme auf einen Bericht des LAFP NRW aus dem Jahr 2018, der eine Mindestkörpergröße von 163 cm befürwortet.
2 Relevante Grundrechte: Dieses Kapitel behandelt zunächst das Grundrecht auf Berufsfreiheit nach Art. 12 I GG, welches durch Art. 33 GG, das Grundrecht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern, überlagert wird. Es wird darauf eingegangen, dass Art. 33 GG ein grundrechtsgleiches Recht ist, das die Interessen der Bewerber um ein öffentliches Amt schützt. Der Begriff des „öffentlichen Amtes“ wird definiert und der spezifische Gleichheitsgrundsatz für den Ämterzugang, der „Eignung“, „Befähigung“ und „fachliche Leistung“ umfasst, wird erläutert. Das Kapitel legt die Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit den konkreten Fallbeispielen der Mindestkörpergrößen.
Schlüsselwörter
Mindestkörpergröße, Polizeibewerber/innen, Eignungsprinzip, Art. 33 II GG, Gleichheitsgrundsatz, Art. 3 II GG, Berufsfreiheit, Art. 12 I GG, Rechtsprechung, OVG Münster, LAFP NRW, Diskriminierung, objektives Kriterium, Einstellungspraxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Mindestkörpergrößen bei der Polizei"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den juristischen Konflikt zwischen dem Eignungsprinzip (Art. 33 II GG) und dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 II GG) im Kontext von Mindestkörpergrößen für Polizeibewerber/innen. Sie analysiert die Zulässigkeit der Körpergröße als objektives Eignungskriterium und betrachtet aktuelle Rechtsprechung und Einstellungspraxen in verschiedenen Bundesländern.
Welche Grundrechte sind relevant?
Die Arbeit behandelt das Grundrecht auf Berufsfreiheit (Art. 12 I GG), das Grundrecht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern (Art. 33 II GG) und das Grundrecht auf geschlechtliche Gleichbehandlung (Art. 3 II GG). Besonders wird der Konflikt zwischen dem Eignungsprinzip (Art. 33 II GG) und dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 II GG) im Hinblick auf die Mindestkörpergröße untersucht.
Welche aktuellen Praktiken werden untersucht?
Die Arbeit analysiert aktuelle Einstellungspraxen der Polizeien in den Bundesländern und auf Bundesebene, mit besonderem Fokus auf unterschiedliche Mindestkörpergrößen nach Geschlecht, insbesondere in Nordrhein-Westfalen (NRW). Sie bezieht sich auch auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster zur Mindestkörpergröße und Rechtsprechungen aus anderen Bundesländern.
Welche Rolle spielt das Urteil des OVG Münster?
Das Urteil des OVG Münster zur Mindestkörpergröße wird kritisch beleuchtet und im Kontext der Rechtsprechung anderer Bundesländer eingeordnet. Die Arbeit untersucht die Argumente für und gegen die Verwendung der Körpergröße als Eignungskriterium.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themen sind der juristische Konflikt zwischen Eignungsprinzip und Gleichheitsgrundsatz, die Auswirkungen unterschiedlicher Mindestkörpergrößen auf die Einstellungsvoraussetzungen, die Zulässigkeit der Körpergröße als objektives Eignungskriterium, die Analyse aktueller Rechtsprechung und Einstellungspraxen sowie die Bewertung der Argumente für und gegen Mindestkörpergrößen.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung beschreibt die Einleitung, die die Problematik der unterschiedlichen Mindestkörpergrößen und den rechtlichen Konflikt beschreibt. Kapitel 2 behandelt die relevanten Grundrechte. Die Arbeit analysiert dann die Mindestkörpergrößen und die damit verbundenen Rechtsprechungen, um schließlich ein Fazit zu ziehen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Mindestkörpergröße, Polizeibewerber/innen, Eignungsprinzip (Art. 33 II GG), Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 II GG), Berufsfreiheit (Art. 12 I GG), Rechtsprechung, OVG Münster, LAFP NRW, Diskriminierung, objektives Kriterium und Einstellungspraxis.
Wie wird der Bericht des LAFP NRW (2018) berücksichtigt?
Der Bericht des LAFP NRW aus dem Jahr 2018, der eine Mindestkörpergröße von 163 cm befürwortet, wird in der Einleitung erwähnt und dient als Kontext für die Diskussion der Mindestkörpergrößen und deren rechtliche Implikationen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Körpergröße als Eignungsmerkmal für die Einstellung. Mindestgröße bei Polizeibewerber/innen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1307719