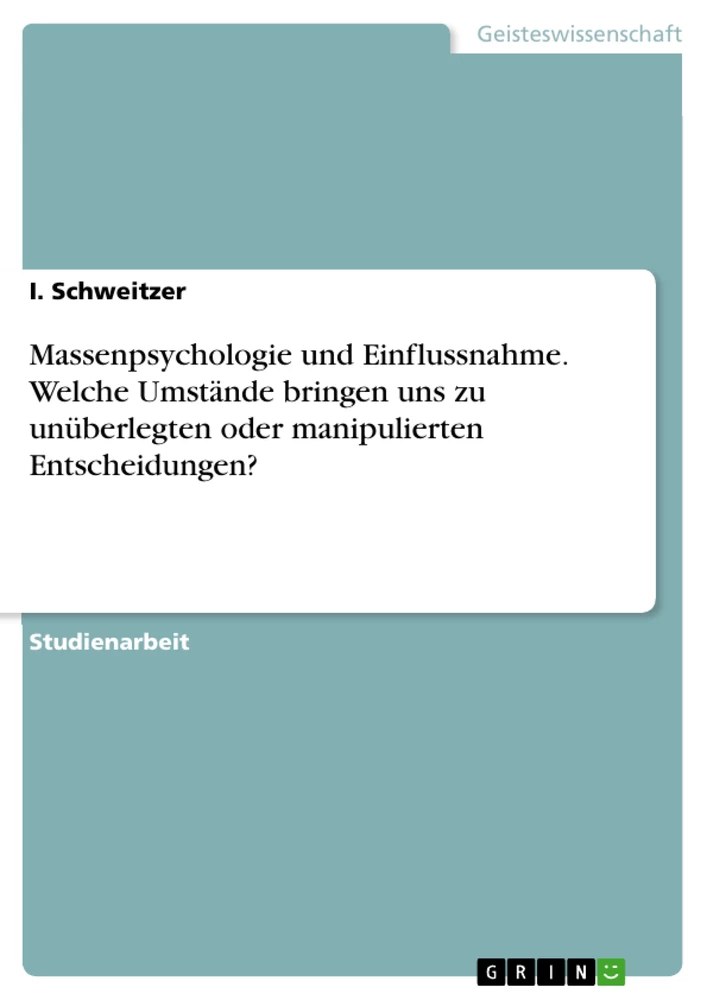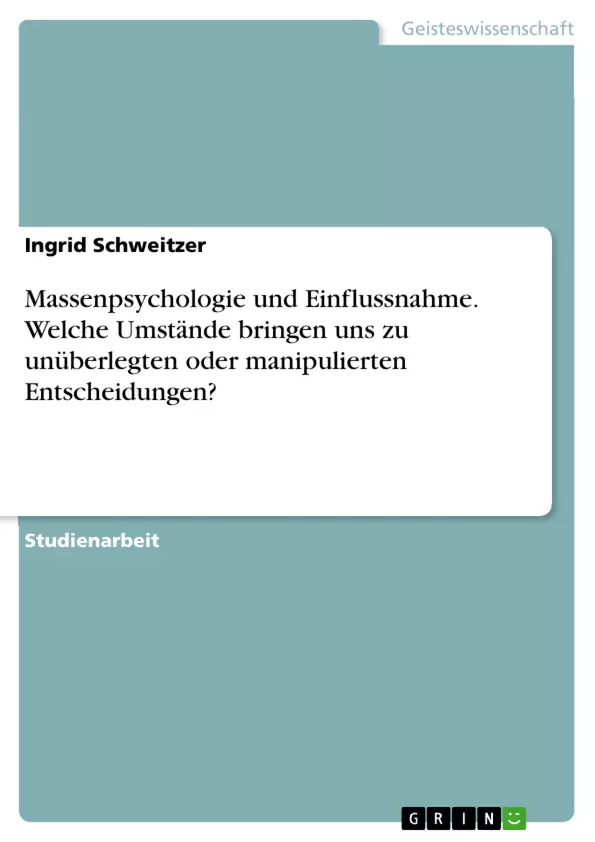Ziel dieser Arbeit ist es zu veranschaulichen, wie es zu bestimmten Entscheidungen und Meinungsbildungen von Einzelnen oder der Masse kommen kann. Welche Umstände sind es, die uns zu unüberlegten oder manipulierten Entscheidungen bringen? Diesem Gegenstand nähern sich zu Beginn zwei Pioniere der Massenpsychologie, Le Bon und Freud, sowie ein moderner Ansatz von Tajfel und Turner. Danach kommen die Prinzipien des Überzeugens von Cialdini zur Ausarbeitung. In weiterer Folge werden Heuristiken und weitere Überzeugungsstrategien angeschnitten. Ferner widmet sich die vorliegende Arbeit einigen Ansichten von Bernays und der Propaganda. Nach weiterführender Literatur schließt das Fazit mit der Beantwortung der eingehenden Forschungsfrage unter Einbezug weiterführender Forschungsfragen.
In der Sozialpsychologie untersucht man das menschliche Erleben und Verhalten anhand der Interaktion mit der sozialen Umwelt. Dabei befasst sich die europäische Sozialpsychologie eher mit den Gruppenphänomenen. Im Gegensatz dazu die amerikanische Sozialpsychologie mit Schwerpunkt auf das individuelle Erleben und Verhalten. Unruhige Zeiten, hervorgerufen zum Beispiel durch die Pandemie, den Ukraine-Krieg oder die fortschreitende Inflation, lenken den Blick auf die Macht der Einflussnahme. Die Entscheidung, wie beispielsweise sich nicht impfen zu lassen, hat in privaten und öffentlichen Bereichen zur Stigmatisierung geführt. Oder ein Jean Ziegler bezeichnet Putin einseitig und radikal als Massenmörder.
INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung
2 Massenpsychologie
2.1 Gustav Le Bon
2.2 Sigmund Freud
2.3 Henri Tajfel und John C. Turner
3 Beeinflussung der Person
3.1 Prinzipien des Überzeugens
3.1.1 Reziprozität/Wechselseitigkeit
3.1.2 Verpflichtung und Konsistenz
3.1.3 Soziale Bewährtheit
3.1.4 Sympathie
3.1.5 Autorität
3.1.6 Knappheit
3.2 Heuristiken und weitere Überzeugungsstrategien
4 Propaganda
5 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
In der Sozialpsychologie untersucht man das menschliche Erleben und Verhalten anhand der Interaktion mit der sozialen Umwelt. Dabei befasst sich die europäische Sozialpsychologie eher mit den Gruppenphänomenen. Im Gegensatz dazu die amerikanische Sozialpsychologie mit Schwerpunkt auf das individuelle Erleben und Verhalten (Fischer, Jander & Krueger, 2018, S. 29). Unruhige Zeiten, hervorgerufen zum Beispiel durch die Pandemie, den Ukraine Krieg oder der fortschreitenden Inflation lenken den Blick auf die Macht der Einflussnahme. Die Entscheidung, wie beispielsweise sich nicht impfen zu lassen, hat in privaten und öffentlichen Bereichen zur Stigmatisierung geführt (Anm. d. Verf.). Oder ein Jean Ziegler bezeichnet Putin einseitig und radikal als Massenmörder (Ziegler, 2022).
Ziel dieser Arbeit ist es zu veranschaulichen, wie es zu bestimmten Entscheidungen und Meinungsbildungen von Einzelnen oder der Masse kommen kann. Welche Umstände sind es, die uns zu unüberlegten oder manipulierten Entscheidungen bringen? Diesem Gegenstand nähern sich zu Beginn zwei Pioniere der Massenpsychologie, Le Bon und Freud, sowie ein moderner Ansatz von Tajfel und Turner. Danach kommen die Prinzipien des Überzeugens von Cialdini zur Ausarbeitung. In weiterer Folge werden Heuristiken und weitere Überzeugungsstrategien angeschnitten. Ferner widmet sich die vorliegende Arbeit einigen Ansichten von Bernays und der Propaganda. Nach weiterführender Literatur schließt das Fazit mit der Beantwortung der eingehenden Forschungsfrage unter Einbezug weiterführender Forschungsfragen.
2 Massenpsychologie
2.1 Gustav Le Bon
Gustav Le Bon gilt mit seiner Abhandlung „Psychologie der Massen“ aus dem Jahr 1895 als Pionier der Massenpsychologie. Le Bon (2017) zeichnet in der Hauptsache ein unbewusstes, triebgesteuertes und eher negatives Bild des Menschen in der Masse. Dies begründet er dadurch, dass der menschliche Intellekt noch zu neu, zu unvollkommen sei. Dementsprechend agiere die Masse nicht mit Verstand, sondern aus Gefühlen heraus, was zu einer entsprechenden Enthemmung führt. Le Bon (2017) postuliert, dass Menschen unterschiedlichster Intelligenz ausgesprochen ähnliche Triebe, Leidenschaften und Gefühle haben. Zwischen einer gelehrten Person und einer aus dem Arbeitervolk könne sich intellektuell ein Abgrund auftun, in Bezug auf den Charakter gäbe es kaum bis gar keinen Unterschied (Le Bon, 2017, S. 30).
Über die Politik zitiert er Jules Simon (1848) »Die politischen Versammlungen sind jene Stätte, wo der Glanz am wenigsten zur «Geltung kommt. Man schätzt hier nur eine der Zeit und dem Orte angemessene Beredsamkeit und die nicht dem Vaterlande, sondern der Partei erwiesenen Dienste…« (Simon, 1848, zit. n. Le Bon, 2017, S. 175). Bereits 38 Jahre vor dem Nationalsozialismus ist Le Bon (2017) der Meinung, dass sich Massen instinktiv einer Autorität unterordnen. Er beschreibt weiter den Anführer als Mann der Tat, nicht als Denker. Im Folgenden rekrutiert das Oberhaupt Nervöse und Reizbare, um die abstrusesten Ideen oder Ziele entgegen aller Logik zu verfolgen. Persönliche Interessen werden geopfert für das Martyrium. Der eigene Glaube stärkt die Macht, die Masse ist bereit dem starken, imponierenden Willen zuzuhören (Le Bon, 2017, S. 110 ff,)
2.2 Sigmund Freud
1921, 26 Jahre nach Le Bon und zwölf Jahre vor dem Nationalsozialismus, behandelt Sigmund Freud die bis dahin hauptsächlich auf Ansteckung basierende Theorie der Massen. Freud ergänzt und betrachtet die Thematik vorwiegend mit der Psychoanalyse. In seinem Werk „Massenpsychologie und Ich-Analyse“ legt er die Schwerpunkte auf die Macht des Unbewussten und der Libido. Anders als seine Vorgänger, sieht Freud (2011) den Zusammenhalt in der Masse nicht durch den instinkthaften Herdentrieb, sondern durch Liebe und erlernte Sozialisierung. In der Entwicklung des Kindes mit Geschwistern stehen anfangs Neid und Eifersucht. Infolge der Gleichstellung durch die Eltern lernt das Kind den Gemeingeist, soziale Gerechtigkeit und Verzicht (Freud, 2011, S. 58).
Zur Veranschaulichung auf „künstliche“ und auf einem Führer basierende Massen, beleuchtet Freud (2011) Kirche und Heer. Seiner Meinung nach werden beide Massen von „unsichtbaren“ Oberhäuptern gelenkt. In solchen Organisationen schützt man sich außerdem vor Veränderung durch feste Strukturen. Einer eventuellen Auflösung wird mit erschwerter Austrittsmöglichkeit gegengesteuert. Freud (2011) zufolge entsteht die libidinöse Bindung in der künstlichen Masse einerseits durch die väterliche, alle in gleichem Maße liebende Vaterfigur, Christus oder der Feldherr, und andererseits durch die geschwisterliche Liebe unter Geistlichen, beziehungsweise der verbündeten Soldaten. Aufgrund dieser Gefühlsbindung in zwei Richtungen finden freiwillige Einschränkungen in der Persönlichkeit zugunsten der Masse statt (Freud, 2011, S. 27 ff.).
2.3 Henri Tajfel und John C. Turner
Tajfel und Turner befassten sich anfangs ihrer Studien mit verschiedenen Gruppenprozessen um die psychologischen Abläufe der Diskriminierung besser zu verstehen. Mit dem Ergebnis ihrer Forschungsarbeiten erarbeiteten sie 1986 die Theorie der sozialen Identität (Fischer, Jander & Krueger, 2018, S. 278). Weil Gruppen danach streben, sich positiv von anderen abzuheben, genannt positive Distinktheit, tritt eine Intergruppendiskriminierung auf. Dabei wertet man die eigene Gruppe auf und die andere ab. Gleichzeitig wird durch die Höherstellung der eigenen Gruppe auch der eigene Selbstwert verbessert. Park & Rothbart (1982) ergänzen, dass der Eindruck der Gleichheit in der eigenen Gruppe ein wichtiger Faktor für die Stereotypenbildung und folglich der Diskriminierung ist (Park & Rothbart, 1982, zit. n. Fischer, Jander & Krueger, 2018, S. 284).
3 Beeinflussung der Person
3.1 Prinzipien des Überzeugens
Mit sechs grundlegenden Prinzipien des Überzeugens finalisiert Cialdini (2021) seine langjährigen Studien und beschreibt, wie man Menschen dazu bringt „Ja“ zu sagen. Anfangs geht er dabei auf feste Handlungsmuster ein, womit er „automatisches“ Verhalten ohne Nachdenken meint. Gemäß Cialdinis (2021) Studien vollzieht sich dieses „abgekürzte“ Reagieren, wenn entweder die Motivation fehlt oder nicht genügend Zeit vorhanden ist um eingehend darüber nachzudenken. Ein Vorteil dieser Abkürzungsverfahren betont er in der Effizienz. Cialdini (2021) äußert jedoch seine Verwunderung darüber, dass trotz dem ständigen Ablauf dieser meist willfährigen Muster nur sehr wenige über deren Bedeutung wissen. In Anbetracht der schnelllebigen Zeit und der vielen Ablenkungen gibt er zu bedenken, dass wenn die Gründe für Entscheidungen unter anderem Zeitmangel und Gedankenlosigkeit sind, wir den Menschen, welche diese Schwäche zu nutzen wissen, zukünftig noch mehr ausgeliefert sind. (Cialdini, 2021, S. 29 ff.).
3.1.1 Reziprozität/Wechselseitigkeit
Noch bevor wir ganze Sätze formulieren, werden wir reziprok konditioniert. Wir sagen „danke“ für ein Bonbon der älteren Dame oder ein Kompliment. Laut Cialdini (2021) ist es das Gefühl, Einladungen, Gefälligkeiten und Geschenke ausgleichen zu müssen, dem wir gemäß dem Reziprozitätsgesetz im Alltag unterliegen. Im politischen Zusammenhang erwähnt er Gefälligkeiten versus Spendengelder. Ausgeweitet wird Reziprozität unter dem Deckmantel von Zugeständnissen, wenn beispielsweise Cialdini (2021) einem Jungen den Kauf von Eintrittskarten für fünf Dollar abschlägt. Dafür kauft er ihm dann „ersatzweise“ einen Riegel um zwei Dollar ab. Cialdini wurde wieder nett, dennoch reingelegt (Cialdini, 2021, S. 19 ff.).
3.1.2 Verpflichtung und Konsistenz
Laut den Studien von Cialdini (2021) neigt der Mensch dazu, bei einer einmal getroffenen Entscheidung zu bleiben. Damit geht er auch sich selbst gegenüber eine Verpflichtung ein. Er beschreibt Menschen, welche konsequent einen Standpunkt beziehen als zielsicher, kompetent und selbstsicher. Hingegen wirken solche, die ständig ihre Meinung ändern eher unsicher und unzuverlässig. Um über das Gefühl der Verpflichtung andere für die eigenen Zwecke zu gewinnen, benötigt es laut Cialdini (2021) unter Umständen nur subtile Zugeständnisse. Diese sind bekannt als „Fuß-in-der-Tür-Taktik“. Ausufernde und grenzüberschreitende Beispiele führt er an mit südafrikanischer Initiationsriten oder Aufnahmeprüfungen amerikanischer Studentenverbindungen (Cialdini, 2021, S. 94 ff.).
3.1.3 Soziale Bewährtheit
Zum Prinzip sozialer Bewährtheit schlägt Cialdini (2021) ein einfaches Experiment vor. Man stellt sich an einem Tag an einen Platz in der Öffentlichkeit und fixiert starr einen Punkt am Himmel. Am nächsten Tag mit drei, vier weiteren Personen noch einmal am selben Platz, wieder in den Himmel starren. Es dauert nicht lange, dann schauen immer mehr Menschen nach oben. Laut Cialdini (2021) orientieren sich Menschen noch stärker am Verhalten anderer, wenn eine Situation neu ist. Als Beispiel bringt er den Erfinder des Supermarkt-Einkaufswagens an. Der Erfinder musste zu Beginn Personen dafür engagieren, welche die neuen Einkaufswagen schoben, damit seine Erfindung nach und nach von der Masse angenommen wurde. Im Weiteren führt Cialdini (2021) den Effekt der Ähnlichkeit an und erzählt die Geschichte von seinem Sohn, der das Schwimmen weder durch ihn, noch durch einen Schwimmlehrer lernte. Erst durch einen gleichaltrigen Jungen war er genügend motiviert schwimmen zu lernen. Im Zuge dessen erläutert Cialdini (2021) auch negative Auswirkungen durch unterlassene Hilfeleistung, den sogenannten Bystander-Effekt. Oder den Werther-Effekt, welcher durch Suizid-Veröffentlichung die Suizidrate in die Höhe treibt (Cialdini, 2021, S. 164 ff.).
3.1.4 Sympathie
Cialdini (2021) weist neben dem Vorteil der Ähnlichkeit auch auf den der Attraktivität. Schöne Menschen hätten es leichter. Wer diesen Vorteil nicht genießt, kann sich Komplimente zunutze machen meint er. Ebenfalls zielführend gemäß Sympathie ist die Argumentation, dass beispielsweise Freundin X oder Bekannter Y sich bereits positiv geäußert hätten, wodurch ein Gefühl von Kooperation erzeugt wird. Das Prinzip der Sympathie nutzt dabei die unbewusste Verbindung von Zuneigung und Vertrauen. Cialdini (2021) ergänzt den Faktor Zuneigung durch Studien anhand derer Männer Autos schneller, ansprechender und teurer einschätzen, wenn eine verführerische Frau diese präsentiert. Ferner tritt Assoziation auf, wenn wir beispielsweise unseren Idolen nacheifern. Eine andere Form von Zuneigung bewirkt gutes Essen. Diese Imbiss-Taktik nutzen Firmen bei sogenannten Werbefahrten und Vorträgen mit „Gratisverköstigung“ (Cialdini, 2021, S. 228 ff.).
3.1.5 Autorität
Laut Cialdini (2021) meint das Autoritätsprinzip das blinde Vertrauen in prestigeträchtige Personen. Eine bekannte Studie mit erschütterndem Ergebnis ist das „Milgram-Experiment“. Dabei waren Versuchspersonen über ihren eigenen Widerspruch hinaus bereit, anderen (Versuchs)Personen psychischen und physischen Schaden zuzufügen. Dies allein aufgrund der Anweisungen einer scheinbaren Autoritätsperson. Laut Cialdini (2021) wollte Milgram ursprünglich das Experiment in Deutschland durchführen, um zu verstehen wie sich die Deutschen an der Ermordung vieler Millionen Unschuldiger im zweiten Weltkrieg beteiligen konnten. Im Anschluss an die unerwarteten Ergebnisse war klar, dass er für die weiterführende Forschung nicht mehr extra nach Deutschland musste (Cialdini, 2021, S. 284). Anders eindrücklich wie Menschen auf Autorität reagieren, schildern Filme wie „Catch me, if you can“ oder „Die Welle“ (Anm. d. Verf.). Diese Filme veranschaulichen, wie hoch der Stellenwert von Symbolen sein kann. Dabei ist es egal, ob es sich um Titel, Kleider, Uniformen, Luxus oder Prestige handelt (Cialdini, 2021, S. 291 ff.).
3.1.6 Knappheit
Wie schnell Menschen auf Knappheit reagieren sah man bei Politikern, welche sich Berichten zufolge bei der Corona-Impfung vorgedrängelten (Allgäuer Z., 2021). Da wir laut Cialdini (2021) den knappen Dingen einen so hohen Wert zuerkennen, arbeiten Verkaufsprofis mit dem Begriff „begrenzte Anzahl“ oder „nur noch 5 Stück auf Lager“. Ein ähnliches Gefühl wie bei Mangel vermitteln Ausdrücke wie Fristen oder Zeitlimits. Ein wiederum anderes Element, welches dem Prinzip der Knappheit zuzuordnen ist, ist der drohende Verlust von Freiheit und bildet den Kern der Reaktanztheorie. Gemeint ist damit, dass eine automatische Gegenreaktion erfolgt, um die Behinderung der Freiheitseinschränkung aus dem Weg zu räumen. (Cialdini, 2021, S. 322 ff).
3.2 Heuristiken und weitere Überzeugungsstrategien
Ob aus Erfahrung, begrenztem Wissen oder unterbewusst, um schnell eine Entscheidung zu fällen bedient sich der Mensch sogenannter Heuristiken. Es handelt sich dabei um einfache Daumenregeln, welche das bewusste Nachdenken bei aufwändigen Entscheidungsproblemen in Bezug auf Urteile reduziert (Fischer, Jander & Krueger, 2018, S. 83). Mayr (2014) nennt Heuristik eine einfache, schnelle und fehlerhafte Denkstrategie um effizient Probleme zu lösen oder Urteile zu fällen (Mayr, 2014, S. 369). Einige der Urteils Heuristiken wurden bereits durch Cialdinis Überzeugungsprinzipien dargestellt. Beispielsweise meint die Expertenheuristik das Urteil durch das Auftreten einer Autorität. Die Heuristik für Mehrheitsurteile sowie die Nachahmungsheuristik lässt sich dem Prinzip der sozialen Bewährtheit zuordnen. Weiters lehnt sich die Ankerheuristik am Prinzip der Konsistenz an. Die Repräsentativitätsheuristik und der Halo-Effekt sind vergleichbar mit der Urteilsbildung durch das Prinzip der Sympathie (Fischer, Jander & Krueger, 2018, S. 84 ff.).
Laut Fischer, Jander & Krueger (2018) bezieht sich die Verfügbarkeitsheuristik allgemein auf die rasche kognitive Verfügbarkeit. Je öfters und ausführlicher Ereignisse oder Erlerntes abspeichert wird, desto unmittelbarer steht es zur Verfügung. Ein anderer Gesichtspunkt, unter dem wir fehlerhafte Entscheidungen treffen erwähnt Mayr (2014) als systematische Selbstüberschätzung. Studien zeigen, dass wir unser Wissen häufig überschätzen und aufgrund dieser Basis Fehlentscheidungen fassen. Angst spielt laut Mayr (2014) ebenso eine Rolle. Ängstliche Personen würden empfänglicher und empfindlicher reagieren auf zielgerichtete, konsequente Maßnahmen. Folglich seien sie leichter zu manipulieren und zu kontrollieren (Gerbner, 1981, zit. n. Mayr, 2014, S. 374). Nicht unerheblich sieht Mayr (2014) auch die entsprechende Präsentation. Es handelt sich dabei um den Framing-Effekt, wobei Informationen gezielt über andere Sinne miteinbettet werden (Mayr, 2014, S. 376). Ein Beispiel sind Fotos auf den Zigarettenpackungen.
4 Propaganda
Die Masse ist vergesslich, beschränkt und wenig aufnahmefähig insistiert Hitler (2016) in seiner Kriegspropaganda. Daher hat sich eine wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken. Sie muss sich ständig und so lange wiederholen, bis auch die letzte Person die Absicht verstanden hat. (Hitler, 2016, Pos. 371).
Bernays (2021) meint ziemlich scharf, dass man durch die Fähigkeit des Lesens und Schreibens die Entwicklung des Menschen erwartet hätte. Mit der Alphabetisierung habe sich stattdessen die selbstständige Denkweise eher gegen Null reduziert. Dies, so schreibt er, infolge Werbung, Nachrichten, Wissenschaft und den Banalitäten der Klatschpresse in Kombination mit starren Denkmustern (Bernays, 2021, S. 27). Was die Bildung der Volksmeinung durch den Staat angeht, so sieht er den Grund in der Zusammensetzung aus griffigen Sprüchen, Symbolen, Klischees und überlieferten Vorurteilen seitens der Politiker (Bernays, 2021, S. 83).
Die moderne Propaganda beschreibt Bernays (2021) als breit gewalztes, ständiges Bemühen Ereignisse zu erschaffen oder umzuformen mit dem Ziel die Öffentlichkeit im Auftrag von Unternehmen, einzelner Ideen oder einer Gruppe zu beeinflussen. Dabei müssen die technischen Hilfsmittel zur Steuerung der Beeinflussung immer konsequenter entwickelt, eingesetzt und modernisiert werden. Dieses infolge der weltweiten, unmittelbaren Vernetzung sowie der steigenden Anzahl diverser Gruppierungen. Er räumt jedoch ein, dass heute ohne Zustimmung der Öffentlichkeit kein größeres Vorhaben mehr umgesetzt werden kann (Bernays, 2021, S. 31 ff.).
Bernays (2021) postuliert, dass der ausgesprochen große Erfolg der früheren Kriegspropaganda, den Weitsichtigen Tür und Tor für Manipulationen aller Art und in allen Bereichen des Lebens geöffnet hat. Es wurden dabei völlig neue Strategien zur Meinungsbildung und Akzeptanz angewandt, parallel zu den bekannten Verhaltensmustern und Klischeevorstellungen der Masse (Bernays, 2021, S. 33).
Die Aufgabe der für eigene Interessen und Kalkulationen neu herausgebildeten Berufsgruppe, der Kommunikationsberater kurz PR-Berater oder Communications Officer, beschreibt Bernays (2021) als Mittler. Mittler, welche mithilfe geeigneter Kommunikationsmittel gezielt Ideen ins Bewusstsein rücken oder Marktlücken aufspüren. Darüber hinaus kümmert sich der PR-Berater um gesellschaftliche Unterstützer, Abläufe und Richtlinien, ist genau informiert über Produkte und deren Abläufe. Bernays (2021) meint ein Jurist berät seine Kunden und findet Gesetzeslücken, der Mittler die entsprechenden Berührungspunkte zwischen der konsumierenden und der anbietenden Person oder Gruppe (Bernays, 2021, S. 41). Er nimmt als Beispiel das längst ausgediente Damenkorsett. Würde man heute einen Hype daraus machen wollen, würden gewiefte Modeberater vielleicht einen „vorteilhaften Hüftgürtel“ vorschlagen. Im Anschluss kümmert sich der Mittler um die Zielgruppen und Untergruppen um alle Interessen zu eruieren. Darauffolgend formuliert man übergreifende Strategien und Verfahren unter Berücksichtigung des Kundenverhaltens in sämtlichen Bereichen (Bernays, 2021, S. 43). Ein Beispiel wie man die Gesellschaft geschickt miteinbezieht, zeigt er durch den landesweiten Wettbewerb für das Modellieren von Seife der Marke „Ivory“ auf. Dabei nahmen altersgerechte Schulkinder und Bildhauer teil, welche die ausgezeichnete Schnitzfähigkeit der Seife erwähnten und damit die „Qualität“ erhöhten (Bernays, 2021, S. 65).
Neben Bernays sind weiterführend Jacques Ellul (2021) mit „Propaganda: Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird“ und Walter Lippmann (2018) „Die öffentliche Meinung und wie sie manipuliert wird“ zu empfehlen. Erfrischend bunt zum Thema: Alexandra Bleyer (2018) mit „Propaganda als Machtinstrument: Fakten, Fakes und Strategien. Eine Gebrauchsanleitung“.
5 Fazit
Mit der vorliegenden Arbeit wurde aufgezeigt, dass diverse Faktoren dazu beitragen, wie Entscheidungen getroffen werden. Nach den Anfängen der eher rudimentären dennoch visionären Ansichten Le Bons und Freuds, zeichnet die Theorie der sozialen Identität einen konstruktiveren Lösungsansatz. Vielleicht erklärt positive Distinktheit manch überhitzte Gemüter der Impfbefürworter und Gegner? Andererseits gab es auch Demonstrationen gegen die Volksspaltung. Da der Ukraine Krieg allem Anschein nach eine Inflation antreibt, könnte man erforschen inwieweit die Masse dem Prinzip der Knappheit unterliegt oder dieses sogar forciert? Hängt die Inflation mit dem Gesetz der Reziprozität auf politischer Ebene zusammen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zensur und dem Darknet infolge Reaktanz? Auch interessant wäre die Erforschung von Fehlerquoten infolge Zeitdruck bei bargeldlosem Zahlen und Online-Banking. Im Anschluss an die Prinzipien des Überzeugens wurden Heuristiken wie Nachahmung, soziale Bewährtheit, Sympathie und dergleichen angerissen. Inwieweit beeinflussen solche Muster krude Selbstdarstellungen auf sozialen Plattformen? Wie stark verändert sich die systematische Selbstüberschätzung durch selbst angeeignetes Wissen aus und mit dem Internet? Abschließend weist Bernays mit seiner frühen Theorie der Propaganda auf die Gefahren der globalen Manipulation. Im digitalen Zeitalter ist die intensive Forschung zur Prävention von Manipulation obere Priorität. In jedem Fall ist es ratsam, sich zu überlegen, woher der Entscheidungsimpuls kommt und sich Zeit zu nehmen bevor man unüberlegte, irreversible oder eigennützig und vielleicht schädliche Entscheidungen trifft.
Literaturverzeichnis
Allgäuer Zeitung, A. (2021, 18. Juni). „Impf-Vordrängler“ in Österreich - Behörden kontrollieren. Allgäuer Zeitung. Abgerufen am 4. August 2022, von https://www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich/impf-vordraengler-in-oesterreich-behoerden-kontrollieren_arid-263620
Bernays, E. (2021). Propaganda: Die Kunst der Public Relations (P. Schnur, Übers.; 13. Aufl.). orange-press.
Cialdini, R. B. (2021). Die Psychologie des Überzeugens: Wie Sie sich selbst und Ihren Mitmenschen auf die Schliche kommen (M. Wengenroth, Übers.; 8., unveränd., 2. Nachdruck Aufl.). Hogrefe AG.
Fischer, P., Jander, K. & Krueger, J. (2018). Sozialpsychologie für Bachelor (2. Aufl.) [E-Book]. Springer Publishing.
Freud, S. (2011). Massenpsychologie und Ich-Analyse [E-Book]. Pretorian Books.
Hitler, A. (2016). Mein Kampf (851.–855 Aufl., 1943, Bde. 1 und 2) [E- Book]. Franz Eher Nachf., G.m.b.H., München.
Le Bon, G. (2017). Psychologie der Massen (Grundlagenwerk der Sozialpsychologie) (R. Eisler, Übers.) [E-Book]. e-artnow.
Myers, D. G. (2014). Psychologie (L. Dörrenbächer et al., Übers.; 3. Aufl.). Springer Publishing.
Ziegler, J. (2022, 17. März). Massenmörder Putin. workzeitung.ch. Abgerufen am 16. Juli 2022, von https://www.workzeitung.ch/2022/03/massenmoerder-putin/
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Entscheidungen und Meinungsbildungen von Einzelpersonen oder der Masse zustande kommen. Sie analysiert, welche Umstände zu unüberlegten oder manipulierten Entscheidungen führen können.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Massenpsychologie (mit Bezug auf Le Bon, Freud, Tajfel und Turner), Prinzipien der Überzeugung (nach Cialdini), Heuristiken, Überzeugungsstrategien und Propaganda (insbesondere Ansichten von Bernays).
Wer sind die zentralen Figuren, die in der Arbeit diskutiert werden?
Zentrale Figuren sind Gustav Le Bon, Sigmund Freud, Henri Tajfel, John C. Turner, Robert Cialdini, und Edward Bernays.
Was sind die sechs Prinzipien der Überzeugung nach Cialdini?
Die sechs Prinzipien sind Reziprozität/Wechselseitigkeit, Verpflichtung und Konsistenz, soziale Bewährtheit, Sympathie, Autorität und Knappheit.
Was ist die Theorie der sozialen Identität von Tajfel und Turner?
Die Theorie besagt, dass Gruppen danach streben, sich positiv von anderen abzuheben (positive Distinktheit), was zu Intergruppendiskriminierung führt, um den eigenen Selbstwert zu verbessern.
Was sind Heuristiken und wie werden sie in der Arbeit diskutiert?
Heuristiken sind einfache Daumenregeln, die Menschen verwenden, um schnell Entscheidungen zu treffen. Die Arbeit diskutiert verschiedene Heuristiken wie Expertenheuristik, Mehrheitsurteile, Ankerheuristik, Repräsentativitätsheuristik, Verfügbarkeitsheuristik und Framing-Effekt.
Was ist die Rolle der Propaganda laut Bernays?
Bernays beschreibt moderne Propaganda als ein breites Bemühen, Ereignisse zu erschaffen oder umzuformen, um die Öffentlichkeit im Auftrag von Unternehmen, Ideen oder Gruppen zu beeinflussen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit betont, dass verschiedene Faktoren Entscheidungen beeinflussen und dass es ratsam ist, zu überlegen, woher der Entscheidungsimpuls kommt und sich Zeit zu nehmen, bevor man unüberlegte Entscheidungen trifft. Die Arbeit plädiert für eine intensive Forschung zur Prävention von Manipulation im digitalen Zeitalter.
Welche weiterführende Literatur wird empfohlen?
Weiterführend werden Jacques Ellul (Propaganda: Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird), Walter Lippmann (Die öffentliche Meinung und wie sie manipuliert wird) und Alexandra Bleyer (Propaganda als Machtinstrument: Fakten, Fakes und Strategien. Eine Gebrauchsanleitung) empfohlen.
- Quote paper
- Ingrid Schweitzer (Author), 2022, Massenpsychologie und Einflussnahme. Welche Umstände bringen uns zu unüberlegten oder manipulierten Entscheidungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1304165