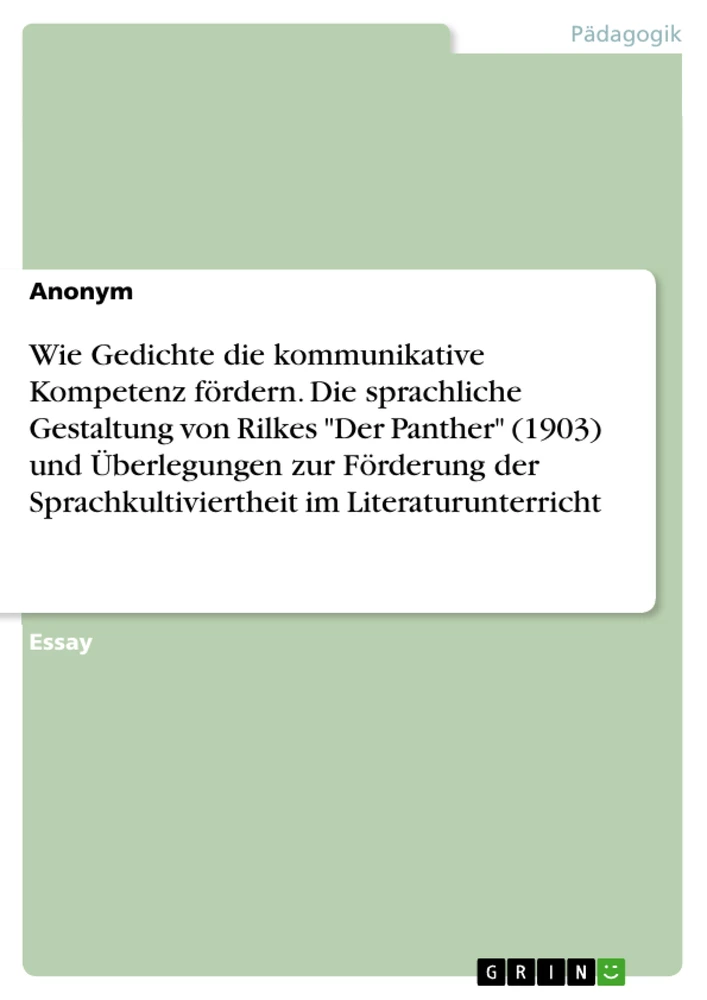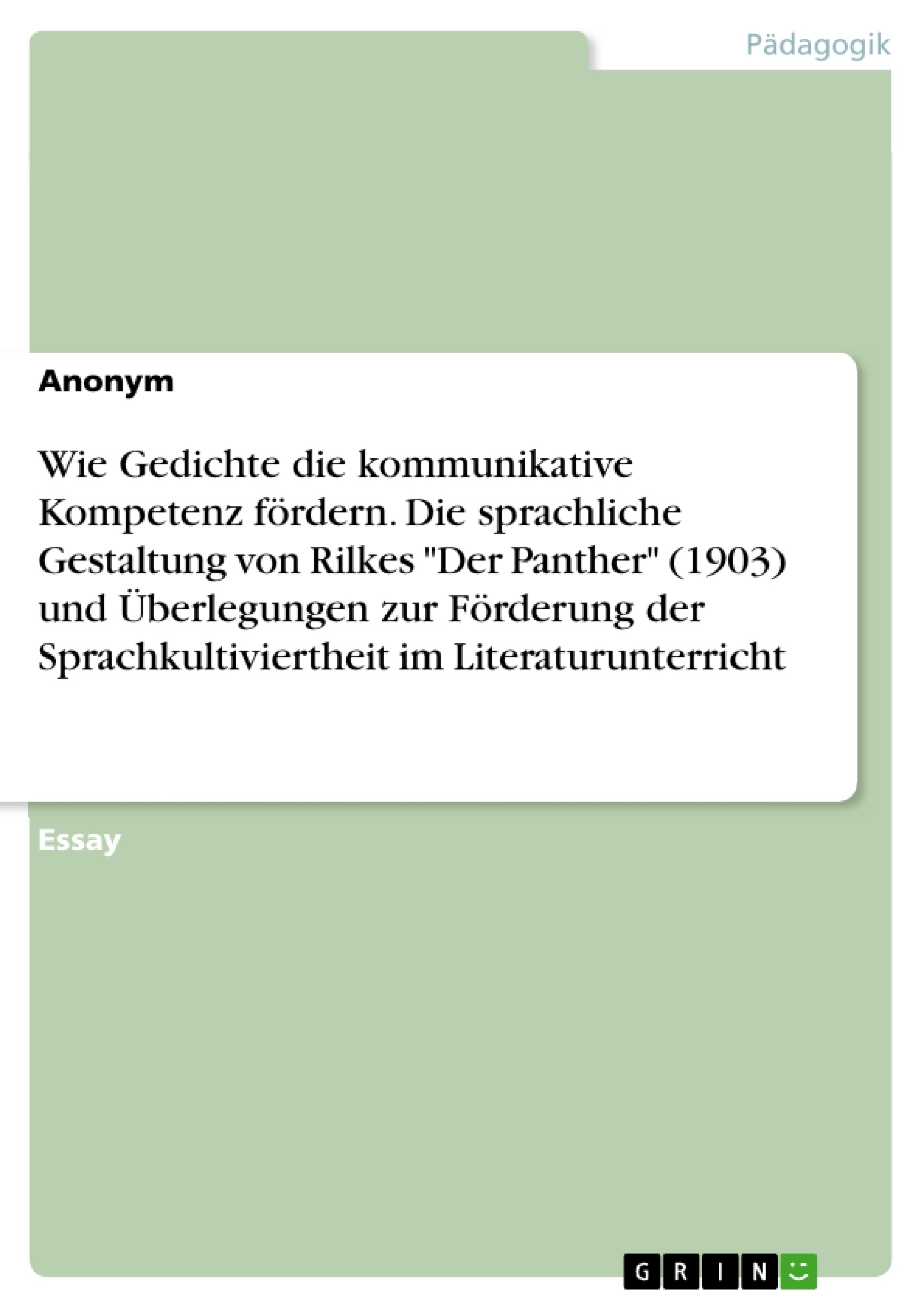Dieser Essay hat seinen Schwerpunkt in der Sprachdidaktik. Um die Differenz zwischen Alltagssprache und verdichteter Sprache zu verdeutlichen, werde ich mich zunächst analytisch der formalen und sprachlichen Gestaltung meines Patengedichts, Rainer Maria Rilkes "Der Panther" (1903), widmen. Dabei orientiere ich mich an der Vorgehensweise des Seminars, in welchem Analyseaspekte aus dem Cornelsen-Schulbuch herangezogen wurden. Daran anschließend werde ich zunächst in das Konzept der Sprachkultiviertheit einführen und anschließend das Modell der kommunikativen Kompetenz, mit spezifischen Fokus auf die kreative Kompetenz, skizzieren. Auf dieser Grundlage möchte ich abschließend einige operativ-kreative Herangehensweisen an mein Patengedicht erörtern, die zur Förderung besagter sprachlicher Kompetenzen in der unterrichtlichen Praxis beitragen können.
Für die meisten Kinder bilden lyrische Texte die frühste sprachästhetische Erfahrung. Indem sie etwa von ihren Eltern als Säuglinge Schlaflieder vorgesungen oder gesprochen bekommen, entwickeln sie ein Gespür für Melodik und Rhythmus, schon lange bevor sie Sprache verstehen können. Lyrik ist dabei, folgt man K. Spinner, „die ästhetische Manifestation von Sprache“.
Neben den sprachlichen und formalen Verschiedenheit der lyrischen Sprache im Vergleich zur Alltagssprache (dazu später mehr) betreibt die Lyrik ein „artistisches Spiel“ mit sprachlichen Möglichkeiten (in Metrik, Reim, Klang sowie Wortwahl, Stilmittel und deren optischen Anordnung). Die Erkundung dieser Möglichkeiten ist Teil der Verstehensarbeit im Unterricht - allerdings birgt sie auch einen enormen Eigenwert: Sie kann maßgeblich zur Förderung des Sprachbewusstseins, der ästhetischen Wahrnehmung sowie des ästhetischen Vergnügens der Lernenden beitragen. Um nicht zuletzt das Potenzial lyrischer Texte für die Identitätsentwicklung verfügbar machen zu können, soll der Unterricht nicht nur auf gelungene Textinterpretationen abzielen, sondern das spielerische, aktivierende Moment in Gedichten entdeckend und kreativ erfahrbar machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Panther - Rainer Maria Rilke
- Gedichtform Dinggedicht – Definition
- Der Panther als typisches Dinggedicht
- Form und Sprache des Gedichts
- Reimschema und Metrik
- Syntax, Zeichensetzung und Enjambements
- Sprachliche Perspektivierung und Wortwahl
- Sprachliche Bildung
- Von Sprachkultur und Sprachkultiviertheit
- Das Modell der kommunikativen Kompetenz
- Transfer in die unterrichtliche Praxis
- Chancen und Herausforderungen des Gedichts
- Exkurs: Charakteristika lyrischer Sprache (Spinner 2000)
- Förderung der Sprachkompetenz
- Hinführung und Zugang zum Gedicht
- Verfahren zur Förderung der kreativen Kompetenz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die sprachliche Gestaltung von Rainer Maria Rilkes Gedicht "Der Panther" und deren didaktische Anwendung im Unterricht. Ziel ist es, die spezifischen sprachlichen Mittel des Gedichts zu analysieren und daraus methodische Ansätze zur Förderung der sprachlichen Kompetenz von Schüler*innen abzuleiten. Die Analyse konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Form und Inhalt, um das didaktische Potenzial des Gedichts aufzuzeigen.
- Analyse der formalen und sprachlichen Mittel in Rilkes "Der Panther"
- Verbindung zwischen sprachlicher Form und inhaltlicher Bedeutung im Gedicht
- Didaktische Implikationen für den Sprachunterricht
- Konzept der Sprachkultiviertheit und kommunikativen Kompetenz
- Methodische Ansätze zur Förderung kreativer Sprachkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Wahl von Rilkes "Der Panther" als Analyseobjekt. Der Autor beschreibt die Bedeutung lyrischer Texte für die frühkindliche Sprachentwicklung und hebt das spielerische und aktivierende Potential von Gedichten für die Identitätsentwicklung hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Sprachdidaktik und die Differenz zwischen Alltagssprache und der verdichteten Sprache lyrischer Texte. Die Analyse des Gedichts soll dazu dienen, methodische Ansätze zur Förderung der sprachlichen Kompetenzen zu entwickeln.
Der Panther – Rainer Maria Rilke: Dieses Kapitel widmet sich einer umfassenden Analyse von Rilkes "Der Panther". Es beginnt mit einer Definition des "Dinggedichts" und positioniert Rilkes Gedicht innerhalb dieses Genres. Die Analyse betrachtet verschiedene Aspekte wie Reimschema, Metrik, Syntax, Zeichensetzung und Wortwahl und verdeutlicht, wie diese formalen Elemente die inhaltliche Bedeutung und die Wirkung des Gedichts verstärken. Der Fokus liegt auf der Darstellung der inneren Welt des Panthers durch die sprachlichen Mittel und die Stimmung des Gedichts.
Sprachliche Bildung: Dieses Kapitel beleuchtet theoretische Grundlagen der Sprachdidaktik. Es wird das Konzept der Sprachkultiviertheit erörtert und das Modell der kommunikativen Kompetenz vorgestellt, mit besonderem Fokus auf die kreative Kompetenz. Dieser Abschnitt legt die theoretische Basis für die didaktischen Überlegungen im folgenden Kapitel.
Transfer in die unterrichtliche Praxis: In diesem Kapitel werden didaktische Ansätze zur Arbeit mit Rilkes "Der Panther" im Unterricht vorgestellt. Es werden Chancen und Herausforderungen der Verwendung dieses Gedichts im Unterricht diskutiert und konkrete Methoden zur Förderung der Sprachkompetenz und der kreativen Kompetenz der Schüler*innen vorgeschlagen. Der Schwerpunkt liegt auf operativ-kreativen Herangehensweisen.
Schlüsselwörter
Rainer Maria Rilke, Der Panther, Dinggedicht, Lyrik, Sprachdidaktik, Sprachkultiviertheit, Kommunikative Kompetenz, Kreative Kompetenz, Gedichtanalyse, Formalanalyse, Sprachliche Mittel, Didaktische Methoden, Unterricht.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Panther" von Rainer Maria Rilke: Eine sprachdidaktische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Rainer Maria Rilkes Gedicht "Der Panther" unter sprachdidaktischen Gesichtspunkten. Sie untersucht die sprachlichen Mittel des Gedichts und entwickelt daraus methodische Ansätze zur Förderung der sprachlichen Kompetenz von Schüler*innen. Der Fokus liegt auf der Interaktion von Form und Inhalt sowie dem didaktischen Potenzial des Gedichts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die formale und sprachliche Analyse von Rilkes "Der Panther", die Verbindung zwischen sprachlicher Form und inhaltlicher Bedeutung, didaktische Implikationen für den Sprachunterricht, das Konzept der Sprachkultiviertheit und kommunikativen Kompetenz sowie methodische Ansätze zur Förderung kreativer Sprachkompetenz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von Rilkes "Der Panther" (inkl. Definition des Dinggedichts), ein Kapitel zu sprachlicher Bildung (Sprachkultiviertheit und kommunikative Kompetenz), ein Kapitel zum Transfer in die unterrichtliche Praxis (mit konkreten methodischen Vorschlägen) und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Aspekte von Rilkes "Der Panther" werden analysiert?
Die Analyse von Rilkes "Der Panther" umfasst Reimschema, Metrik, Syntax, Zeichensetzung, Wortwahl und die Interaktion dieser Elemente mit der inhaltlichen Bedeutung und der Wirkung des Gedichts. Der Fokus liegt auf der Darstellung der inneren Welt des Panthers und der Stimmung des Gedichts.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Konzept der Sprachkultiviertheit und das Modell der kommunikativen Kompetenz, insbesondere im Hinblick auf die kreative Kompetenz. Diese theoretischen Grundlagen bilden die Basis für die didaktischen Überlegungen.
Welche didaktischen Ansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt konkrete methodische Ansätze zur Arbeit mit Rilkes "Der Panther" im Unterricht vor. Es werden Chancen und Herausforderungen der Verwendung dieses Gedichts diskutiert und operativ-kreative Herangehensweisen zur Förderung der Sprach- und Kreativkompetenz der Schüler*innen vorgeschlagen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende im Deutschunterricht, Sprachdidaktiker*innen und alle, die sich für die sprachliche Analyse lyrischer Texte und deren didaktische Anwendung interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rainer Maria Rilke, Der Panther, Dinggedicht, Lyrik, Sprachdidaktik, Sprachkultiviertheit, Kommunikative Kompetenz, Kreative Kompetenz, Gedichtanalyse, Formalanalyse, Sprachliche Mittel, Didaktische Methoden, Unterricht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Wie Gedichte die kommunikative Kompetenz fördern. Die sprachliche Gestaltung von Rilkes "Der Panther" (1903) und Überlegungen zur Förderung der Sprachkultiviertheit im Literaturunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1304069