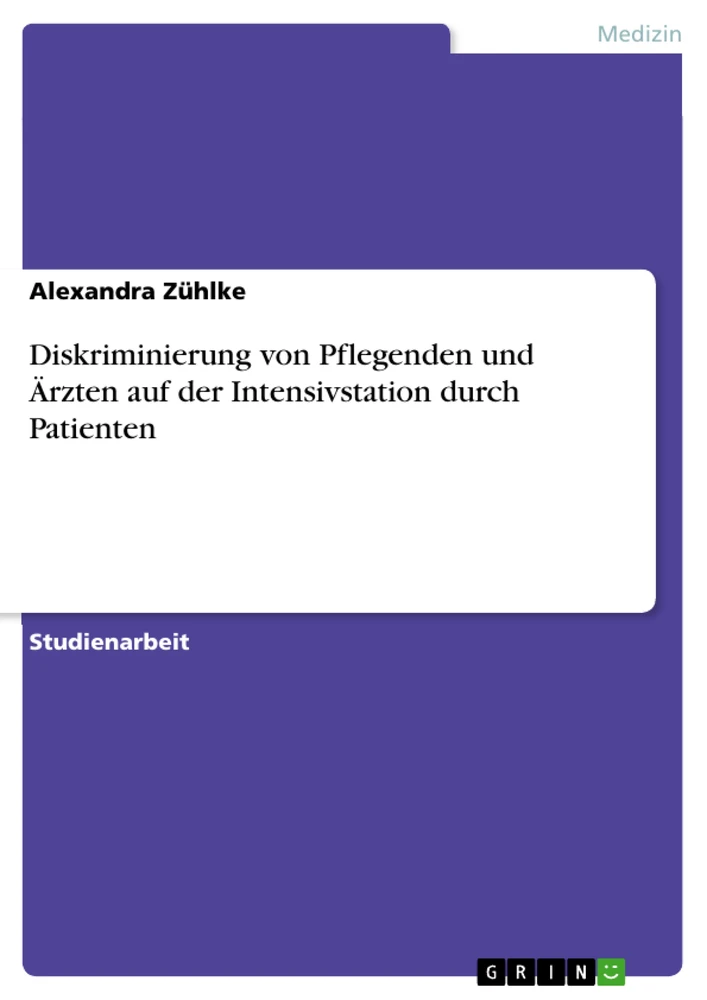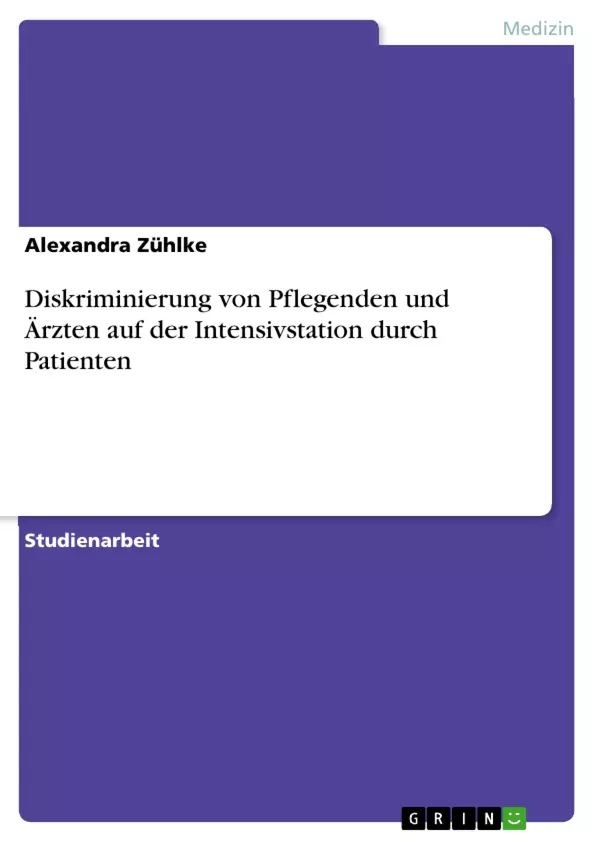Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, einen Einblick in die Erfahrungswelt von Pflegenden und Ärzt*innen, welche auf der Intensivstation arbeiten, zum Thema Diskriminierung durch Patient*innen zu erlangen. Die Forschungsfrage lautet: Welche Diskriminierungserfahrungen ausgehend von Patient*innen haben Pflegende und Ärzt*innen erlebt? Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde als Methodik ein halb-strukturiertes Interview mit n=22 Teilnehmenden durchgeführt.
Patient*innen im deutschen Gesundheitswesen müssen durch das Verbot der Diskriminierung vor Diskriminierung geschützt werden, der diskriminierungsfreie Zugang zur Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Es existieren verschiedene Studien und laufende Forschungsprojekte zu Diskriminierungsrisiken von Patient*innen im Gesundheitswesen. Die Literatur gibt beispielsweise Hinweise darauf, dass Menschen mit Migrationshintergrund bezüglich der Qualität der medizinischen Behandlung benachteiligt werden, oder, dass Frauen mit Herzinfarkten häufiger als Männer sterben, wenn sie von einem männlichen Arzt behandelt werden.
Ein bislang vernachlässigtes Phänomen ist, inwiefern Beschäftige im Gesundheitswesen einem Diskriminierungsrisiko ausgesetzt sind und von welcher Form der Diskriminierung sie betroffen sind. „Als besondere Diskriminierungsrisiken des Gesundheitssystems können das kirchliche Diskriminierungsprivileg, sowie der enge Kontakt mit Patient*innen und damit einhergehend das Risiko, auch von dieser Seite Diskriminierung zu erleben, insbesondere in Form von sexueller Belästigung betrachtet werden. Weitere Forschung wäre insbesondere in Bezug auf mögliche weitere für den Gesundheitsbereich relativ spezifische Diskriminierungsrisiken sinnvoll.“ Die Autorin ist in der Pflege tätig und wurde im Laufe ihrer Berufstätigkeit von Patient*innen mehrfach diskriminiert. Die aktuelle Studienlage lässt keine Rückschlüsse zum Thema Diskriminierung von Pflegenden im Berufsalltag zu. An dieser Stelle möchte die Verfasserin mit ihrer Hausarbeit ansetzen. Um Erkenntnisse zur Diskriminierung von Beschäftigten im Gesundheitswesen durch Patient*innen zu erlangen, hat sie Interviews mit Pflegenden und Ärzt*innen, welche auf der Intensivstation tätig sind, durchgeführt und ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ziel und Fragestellung
- 3. Literaturrecherche und Methodik
- 4. Hintergrund
- 4.1 Diskriminierung
- 4. 2 Formen der Diskriminierung
- 4.3 Diskriminierungsfreie Kommunikation
- 5. Qualitative Interviews
- 5.1 Design
- 5.2 Ergebnisse der Interviews
- 5.3 Auswertung der Interviews
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Diskriminierung von Beschäftigten im Gesundheitswesen durch Patient*innen. Das Ziel ist es, anhand von Interviews mit Pflegenden und Ärzt*innen, die auf der Intensivstation arbeiten, Einblicke in deren Diskriminierungserfahrungen zu gewinnen und die Relevanz dieser Thematik aufzuzeigen.
- Diskriminierung von Beschäftigten im Gesundheitswesen durch Patient*innen
- Formate und Arten der Diskriminierung
- Erfahrungen von Pflegenden und Ärzt*innen auf der Intensivstation
- Mögliche Ursachen für Diskriminierung im Gesundheitswesen
- Relevanz des Themas für die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung stellt das Problem der Diskriminierung von Patient*innen im Gesundheitswesen dar und beleuchtet die Bedeutung der Thematik im Kontext des Rechts auf diskriminierungsfreien Zugang zur Gesundheitsversorgung. Es wird auf den Mangel an Forschung zu Diskriminierungserfahrungen von Beschäftigten im Gesundheitswesen hingewiesen und die Notwendigkeit einer Untersuchung dieses Phänomens betont.
- Kapitel 2: Ziel und Fragestellung In diesem Kapitel wird das Ziel der Hausarbeit definiert, das darin besteht, einen Einblick in die Erfahrungen von Pflegenden und Ärzt*innen auf der Intensivstation zu erhalten. Die Forschungsfrage wird präzise formuliert und es wird erläutert, wie die gewonnenen Erkenntnisse dazu beitragen können, die Relevanz der Thematik Diskriminierung im Gesundheitswesen aufzuzeigen.
- Kapitel 3: Literaturrecherche und Methodik Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Datenerhebung und -auswertung. Es wird erläutert, welche Datenbanken zur Literaturrecherche herangezogen wurden und welche Sampling-Strategie für die Auswahl der Interviewteilnehmer*innen verwendet wurde. Die qualitative Forschungsmethode der halbstrukturierten Interviews wird vorgestellt und es wird auf die Auswertungsmethode der deskriptiven Statistik eingegangen.
- Kapitel 4: Hintergrund Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Diskriminierung und geht auf die verschiedenen Formen und Ursachen der Diskriminierung ein. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wird vorgestellt und die wichtigsten Bestimmungen zur Verhinderung und Beseitigung von Benachteiligung aufgrund von geschützten Merkmalen werden erläutert.
- Kapitel 5: Qualitative Interviews In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Interviews mit Pflegenden und Ärzt*innen vorgestellt. Das Design der Interviews, die Ergebnisse und die Auswertungsmethode werden detailliert erläutert.
Schlüsselwörter
Diskriminierung, Gesundheitswesen, Intensivstation, Pflegende, Ärzt*innen, Patient*innen, Erfahrungswelt, qualitative Interviews, deskriptive Statistik, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
- Quote paper
- Alexandra Zühlke (Author), 2022, Diskriminierung von Pflegenden und Ärzten auf der Intensivstation durch Patienten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1303947