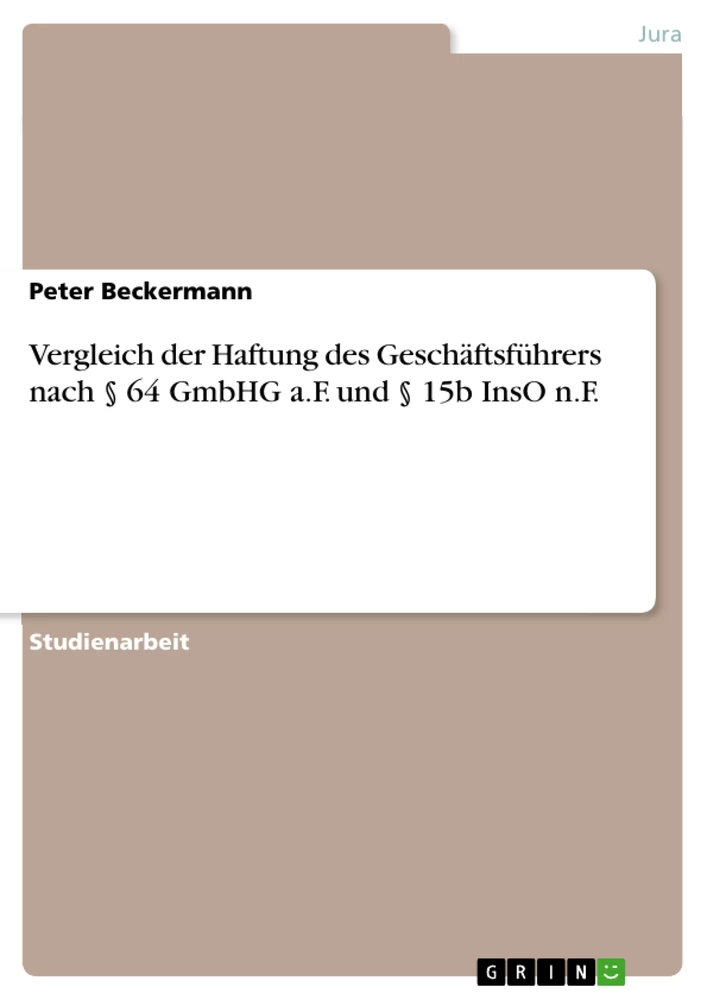Diese Arbeit soll die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Rechtsnormen § 64 GmbHG a.F. bzw. § 15b InsO n.F. herausstellen und aufzeigen, ob der Gesetzgeber im Wesentlichen für Haftungserleichterungen oder eher für zunehmende Haftungsrisiken für die Geschäftsleiter gesorgt hat. Von besonderer Bedeutung für die Ausarbeitung war dementsprechend die isolierte Betrachtung beider Normen, um die einzelnen Tatbestandsmerkmale vollumfänglich aus-zuführen. Dieses Fundament bot die Grundlage für einen qualitativen Vergleich, der in vier Unterkapiteln beschrieben wird und dem Leser so prägnant die Unterschiede akzentuiert.
Die Corona-Pandemie zwingt bis heute viele Unternehmen in die Knie und führte sie teils so intensiv in eine Krise, dass sie hätten Insolvenz anmelden müssen, durch den Staat davor jedoch in Form von Staatshilfen grundsätzlich bewahrt wurden. Hierzulande, in Westeuropa, konnten die staatlichen Hilfen dafür sorgen, dass jede zweite Insolvenz verhindert werden konnte. Dies gelang nicht zuletzt durch die finanziellen Unterstützungen des Staates, sondern auch durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht.
Indes rechnet der weltgrößte Kreditversicherer Euler Hermes aber mit einer im Jahr 2022 wieder steigenden Zahl von Unternehmensinsolvenzen. Es konnten sich zwar viele Unternehmen durch die staatliche Unterstützung aus dem Stadium einer Insolvenz befreien, es entstehen allerdings auch eine Menge verdeckt überschuldeter Unternehmen, sogenannte Zombiunternehmen, die für die Wirtschaft eine Gefahr darstellen. Somit kommt gerade auf Geschäftsführer in der Phase der Insolvenz eine bedeutende Verantwortung zu. Denn in der Phase einer durch Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung entstehende Insolvenz sind die Geschäftsleiter verpflichtet, die Interessen des Unternehmens hinter die Interessen der Gesamtgläubiger zu stellen. Dies gelingt ihnen jedoch nicht immer, weshalb sie schnell in die persönliche Haftung durch masseschmälernde Zahlungen gelangen, die nach § 64 GmbHG a.F. bzw. § 15b InsO n.F. grundsätzlich verbotswidrig sind. Darüber sind sich viele Führungskräfte nicht im Klaren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. § 64 GmbHG a.F.
- III. § 15b InsO n.F.
- IV. Vergleich beider Rechtsnormen
- A. Zahlungen im Zeitraum zwischen Eintritt der Insolvenzreife und Stellung des Insolvenzantrags bzw. Antragsentscheidung
- B. Zahlungen im Zeitraum zwischen Stellung des Insolvenzantrags und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- C. Zahlungen nach Ablauf der Insolvenzantragspflicht
- D. Haftung verbotswidriger Zahlungen
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, die Haftung des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F. zu vergleichen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Rechtsnormen herauszustellen. Die Arbeit analysiert, ob der Gesetzgeber durch die Novellierung des Rechts eher Haftungserleichterungen oder zunehmende Haftungsrisiken für Geschäftsführer geschaffen hat.
- Haftung des Geschäftsführers bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
- Vergleich der Tatbestandsmerkmale von § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F.
- Analyse der Rechtsfolgen bei verbotswidrigen Zahlungen
- Bewertung der gesetzlichen Änderungen hinsichtlich der Haftungsrisiken
- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Insolvenzlage von Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Insolvenzlage von Unternehmen und die damit verbundene gestiegene Bedeutung der Geschäftsführerhaftung. Sie führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich den Vergleich der Haftung nach § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F. Die Zunahme von "Zombiunternehmen" und die damit verbundenen Risiken werden hervorgehoben. Die Arbeit konzentriert sich auf die isolierte Betrachtung beider Normen, um einen detaillierten und prägnanten Vergleich zu ermöglichen.
II. § 64 GmbHG a.F.: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die Haftung des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG a.F. Es definiert die zentralen Tatbestandsmerkmale, insbesondere Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, im Detail. Die Definition von Zahlungsunfähigkeit wird anhand von Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erläutert, wobei die Bedeutung der Fälligkeit von Forderungen und die Unterscheidung zu bloßer Zahlungsstockung hervorgehoben werden. Die Feststellung der Überschuldung wird ebenfalls umfassend dargestellt, einschließlich der Ausnahme der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens. Schließlich wird die Haftung des Geschäftsführers für Zahlungen an Gesellschafter im Kontext von Zahlungsunfähigkeit behandelt.
Schlüsselwörter
Geschäftsführerhaftung, § 64 GmbHG a.F., § 15b InsO n.F., Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenz, Insolvenzantrag, verbotswidrige Zahlungen, Corona-Pandemie, Zombiunternehmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Vergleich der Geschäftsführerhaftung nach § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F.
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht die Haftung des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG a.F. (alte Fassung) und § 15b InsO n.F. (neue Fassung). Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Rechtsnormen und untersucht, ob die Gesetzesänderung zu Haftungserleichterungen oder -verschärfungen geführt hat. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Insolvenzlage von Unternehmen und die damit verbundenen Haftungsrisiken.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Haftung des Geschäftsführers bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, vergleicht die Tatbestandsmerkmale von § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F., analysiert die Rechtsfolgen verbotswidriger Zahlungen, bewertet die gesetzlichen Änderungen hinsichtlich der Haftungsrisiken und betrachtet die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Insolvenzlage von Unternehmen. Der Einfluss von "Zombiunternehmen" wird ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, § 64 GmbHG a.F., § 15b InsO n.F., Vergleich beider Rechtsnormen (inkl. Unterkapitel zu Zahlungen in verschiedenen Zeiträumen und der Haftung verbotswidriger Zahlungen) und Fazit.
Wie wird § 64 GmbHG a.F. in der Arbeit behandelt?
Kapitel II beschreibt detailliert die Haftung des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG a.F. Es erklärt die Tatbestandsmerkmale Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung anhand von Rechtsprechung, unterscheidet zwischen Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsstockung und beleuchtet die Haftung für Zahlungen an Gesellschafter.
Wie wird § 15b InsO n.F. in der Arbeit behandelt?
Kapitel III behandelt die Haftung des Geschäftsführers nach § 15b InsO n.F. Im Vergleich zu Kapitel II wird hier die neue Rechtslage detailliert dargestellt, um einen umfassenden Vergleich zu ermöglichen. Die Kapitel sind so strukturiert, dass die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Normen deutlich werden.
Wie werden die beiden Rechtsnormen verglichen?
Kapitel IV vergleicht die Haftung nach § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F. Es analysiert Zahlungen in verschiedenen Zeiträumen (vor, während und nach der Insolvenzantragspflicht) und untersucht die Haftung für verbotswidrige Zahlungen. Der Vergleich soll die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die Haftungsrisiken von Geschäftsführern aufzeigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Geschäftsführerhaftung, § 64 GmbHG a.F., § 15b InsO n.F., Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenz, Insolvenzantrag, verbotswidrige Zahlungen, Corona-Pandemie, Zombiunternehmen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit (Kapitel V) fasst die Ergebnisse des Vergleichs von § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F. zusammen und bewertet die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die Haftung von Geschäftsführern. Es wird eine abschließende Einschätzung der Haftungsrisiken gegeben.
- Arbeit zitieren
- Peter Beckermann (Autor:in), Vergleich der Haftung des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG a.F. und § 15b InsO n.F., München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1303706