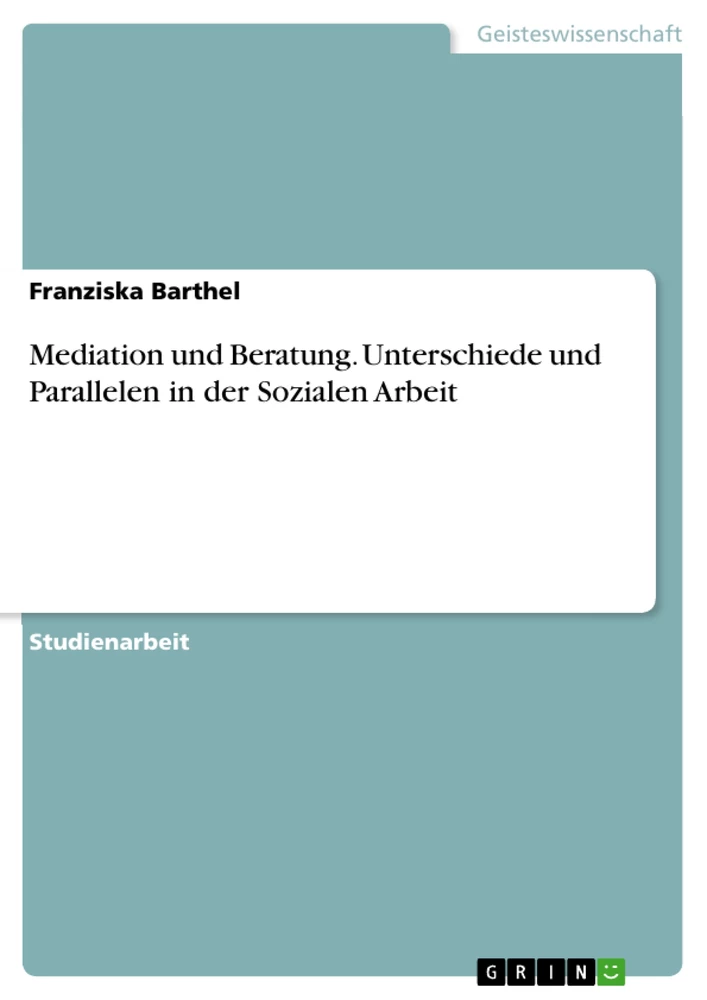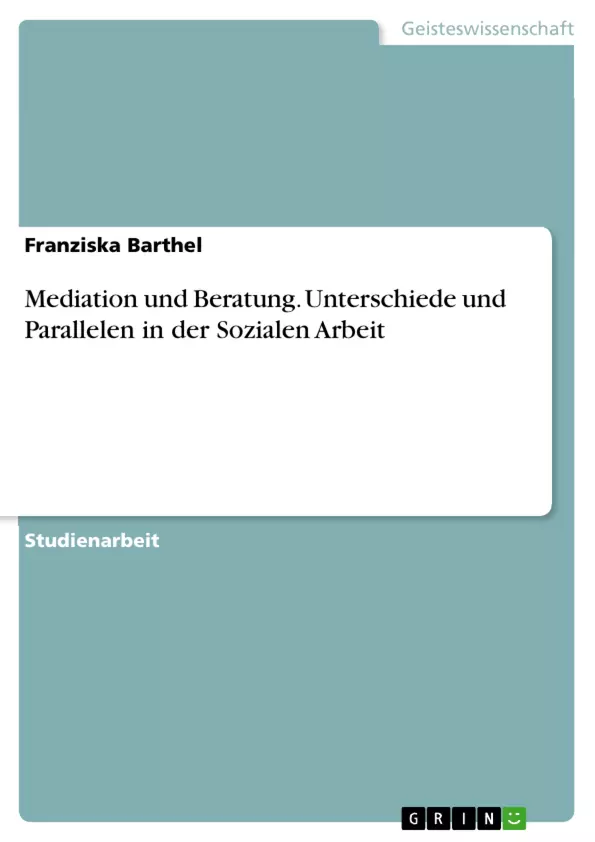Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen zwischen den beiden Handlungskonzepten Beratung und Mediation? Welche Rolle spielen diese beiden Handlungskonzepte für die Soziale Arbeit?
Zunächst werden die Begriffe jeweils getrennt voneinander definitorisch umrissen. Im Anschluss werden beide Konzepte miteinander verglichen und auf Unterschiede sowie Schnittmengen beleuchtet. Dies geschieht unter Betrachtung bestimmter Elemente, wie der Ausgangssituation, dem Ablauf oder dem Menschenbild. Weiterführend werden die Handlungskonzepte daraufhin untersucht, ob sie sich für den Einsatz in der Sozialen Arbeit eignen. Wenn ja, wird anschließend anhand eines ausgewählten Anwendungsbereichs aus Beratung sowie Mediation erläutert, weshalb der Einsatz des jeweiligen Konzepts für den Bereich sinnvoll erscheint. Hierbei wird es um Familienberatung sowie Familienmediation gehen. Meines Erachtens lassen sich hierbei nachvollziehend die Sinnhaftigkeit und die konzeptionelle Umsetzung darstellen. Dabei soll es vor allem um die Relevanz der Handlungskonzepte gehen, ebenso um praktische und methodische Ansätze. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und unter Berücksichtigung der Bedeutung für die Soziale Arbeit reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführende Worte
- Zielsetzung
- Kritische Überlegungen
- Beratung und Mediation im Vergleich
- Begriffserklärung Beratung
- Begriffserklärung Mediation
- Unterschiede
- Gemeinsamkeiten
- Beratung und Mediation in der Sozialen Arbeit
- Familienberatung
- Familien-Mediation
- Fazit
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen den Handlungskonzepten Beratung und Mediation. Sie analysiert die beiden Konzepte unter Betrachtung spezifischer Elemente wie Ausgangssituation, Ablauf und Menschenbild, und untersucht ihre Eignung für die Soziale Arbeit.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Beratung und Mediation
- Vergleich der beiden Konzepte hinsichtlich ihrer Ziele, Methoden und Einsatzgebiete
- Analyse der Relevanz von Beratung und Mediation für die Soziale Arbeit
- Beurteilung der Einsatzmöglichkeiten von Beratung und Mediation in der Familienarbeit
- Zusammenfassende Reflexion der Erkenntnisse im Hinblick auf die Bedeutung für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Grundlage für die Analyse der beiden Handlungskonzepte. Sie stellt das Zitat von Marshall B. Rosenberg vor, welches die Selbstbestimmung und Handlungsmacht jedes Individuums betont, und führt die Forschungsfrage ein, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Beratung und Mediation bestehen.
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Beratung und Mediation definiert. Die Beratung wird als sozialwissenschaftlich fundiertes Instrument zur Erarbeitung und Stabilisierung von prekären Lebenslagen beschrieben, während die Mediation als ein strukturiertes Verfahren zur außergerichtlichen Konfliktberatung dargestellt wird.
Das dritte Kapitel vergleicht die beiden Konzepte anhand ihrer Ausgangssituation, ihres Ablaufs und ihres Menschenbildes. Dabei werden sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten aufgezeigt. Die Mediation wird als eine spezifische Form der Konfliktberatung definiert, während die Beratung einen breiteren Hilfeprozess umfasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Beratung, Mediation, Soziale Arbeit, Familienberatung, Familien-Mediation, Konfliktlösung, Kommunikation, Selbstbestimmung, Handlungskonzepte, Interventionen.
- Arbeit zitieren
- Franziska Barthel (Autor:in), 2021, Mediation und Beratung. Unterschiede und Parallelen in der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1303525