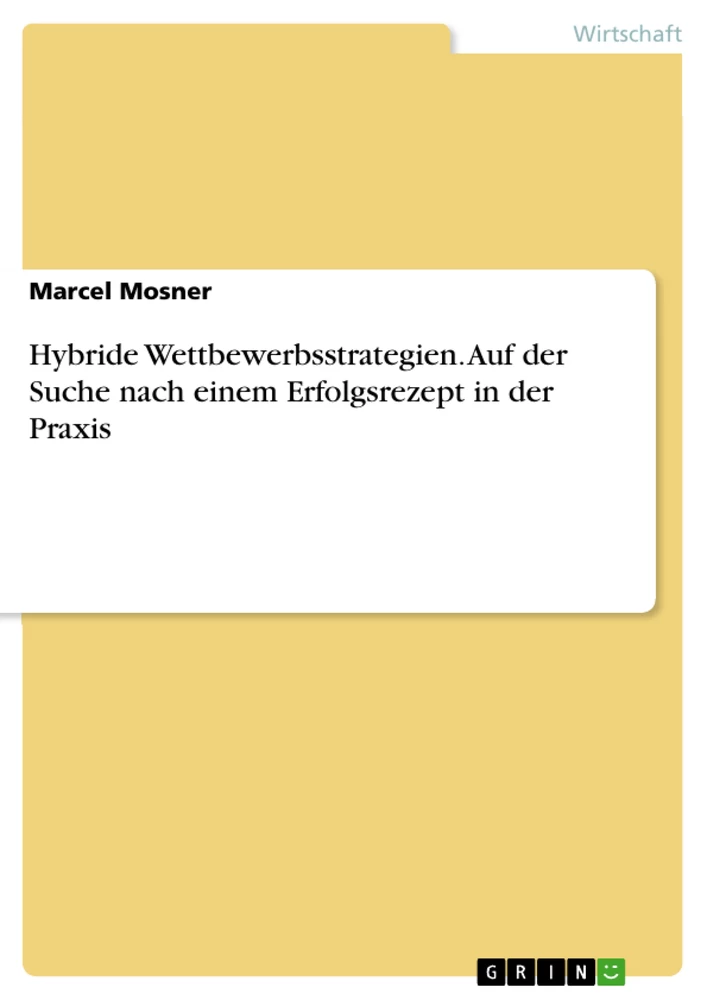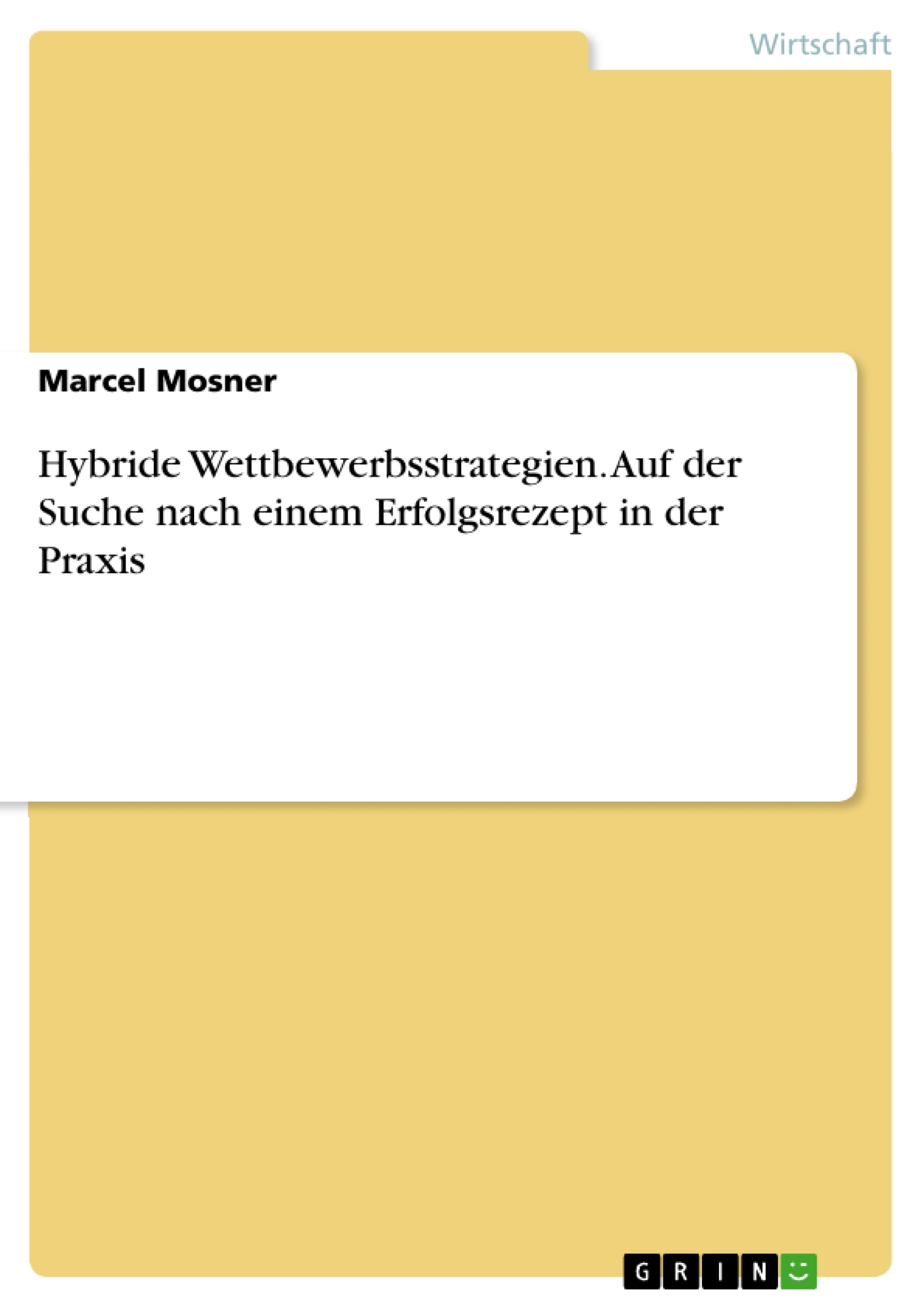Gibt es ein „Erfolgsrezept“, das sich bei der Anwendung der hybriden Wettbewerbsstrategien erkennen lässt? Ist das Erreichen eines hohen Marktanteils durch eine anfängliche Strategie der Kostenführerschaft, der dann mit einer Differenzierungsstrategie ausgeweitet wird, eventuell ein solches „Erfolgsrezept“?
In der Wirtschaft stehen Unternehmen vor der Herausforderung ihre Produkte und Dienstleistungen am jeweiligen Markt erfolgreich und nachhaltig gegenüber Wettbewerbern zu positionieren. Aus diesem Grund spielt die Entwicklung von sollten Geschäfts- bzw. Wettbewerbsstrategien eine Rolle. Dabei kommt es auf die beabsichtigten Wettbewerbsvorteile, das anvisierte Wettbewerbsfeld und das Innovationsverhalten an.
Der amerikanische Ökonom Michael Porter hat mit seinen Überlegungen zu den Wettbewerbsstrategien das strategische Management nachhaltig beeinflusst und viele Jahre geprägt. Gemäß Porter unterscheidet man beim Aufbau eines nachhaltigen und erfolgreichen Wettbewerbsvorteils lediglich zwischen Kostenführerschaftsvorteile und Differenzierungsvorteile. Allerdings ist in der Praxis zunehmend eine Kombination dieser beiden generischen Wettbewerbsstrategien zu beobachten. Obwohl Studien, wie die von Thornhill/White (2007) oder Ebben/Johnson (2005), Porters Theorie der klaren Wettbewerbsstrategien belegen und zeigen, dass Dualstrategien oder hybride Strategien weniger erfolgreich sind, zeigen bekannte Beispiele wie Swatch, Toyota/Lexus oder Singapore Airlines, dass hybride Wettbewerbsstrategien durchaus erfolgreich sein können. Eine weitere Beobachtung im wirtschaftlichen Unternehmensumfeld ist, dass Unternehmen ihre klare Wettbewerbsstrategie im Laufe der Zeit an geänderte Rahmenbedingungen anpassen und die Strategie wechseln. So können des Öfteren Fälle beobachtet werden, bei denen ein Unternehmen zunächst eine Kostenführerschaftsstrategie verfolgt, dann aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich anfängt Differenzierungsvorteile zu nutzen.
Damit stellt sich die Frage, wovon diese unterschiedlichen Herangehensweisen abhängen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gang der Untersuchung
- Grundlagen
- Kostenführerschaft
- Differenzierung
- Hybride Wettbewerbsstrategie
- Arten von hybriden Wettbewerbsstrategien
- Vor- und Nachteile von hybriden Wettbewerbsstrategien
- Konzept der hybriden Wettbewerbsstrategien
- Auf der Suche nach dem Erfolgsrezept in der Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es ein „Erfolgsrezept“ für hybride Wettbewerbsstrategien gibt. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze und Aspekte hybrider Strategien zu beleuchten und zu untersuchen, ob diese in der Praxis zu nachhaltigem Erfolg führen können.
- Definition und Arten hybrider Wettbewerbsstrategien
- Vor- und Nachteile hybrider Strategien
- Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Implementierung hybrider Strategien
- Praxisbeispiele aus der Smartphone-Branche
- Bewertung der Erfolgsaussichten hybrider Wettbewerbsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wettbewerbsstrategien ein und beleuchtet die Bedeutung des Aufbaus von Wettbewerbsvorteilen für Unternehmen im Markt. Sie stellt die beiden klassischen Strategien nach Porter, Kostenführerschaft und Differenzierung, sowie die wachsende Bedeutung hybrider Strategien vor.
- Gang der Untersuchung: Das Kapitel beschreibt den Aufbau der wissenschaftlichen Arbeit und stellt die wichtigsten Themenbereiche der Untersuchung vor. Dabei wird deutlich, dass die Arbeit die Suche nach einem „Erfolgsrezept“ für hybride Wettbewerbsstrategien im Fokus hat.
- Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die Analyse von hybriden Wettbewerbsstrategien. Es umfasst Definitionen und Erklärungen zu den generischen Wettbewerbsstrategien nach Porter, der Kostenführerschaft und der Differenzierung. Darüber hinaus werden die verschiedenen Arten von hybriden Wettbewerbsstrategien, ihre Vor- und Nachteile sowie das Konzept der hybriden Strategie näher beleuchtet.
- Auf der Suche nach dem Erfolgsrezept in der Praxis: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der konkreten Anwendung hybrider Wettbewerbsstrategien in der Praxis. Es werden verschiedene wissenschaftliche Meinungen zum Thema dargestellt und anhand eines Beispiels aus der Smartphone-Branche untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Wettbewerbsstrategien, insbesondere mit hybriden Wettbewerbsstrategien. Kernbegriffe sind Kostenführerschaft, Differenzierung, hybride Wettbewerbsstrategie, Erfolgsrezept, Marktanteil, strategische Entscheidungsfindung, Unternehmensumfeld, und Smartphone-Branche.
- Quote paper
- Marcel Mosner (Author), 2021, Hybride Wettbewerbsstrategien. Auf der Suche nach einem Erfolgsrezept in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1303219