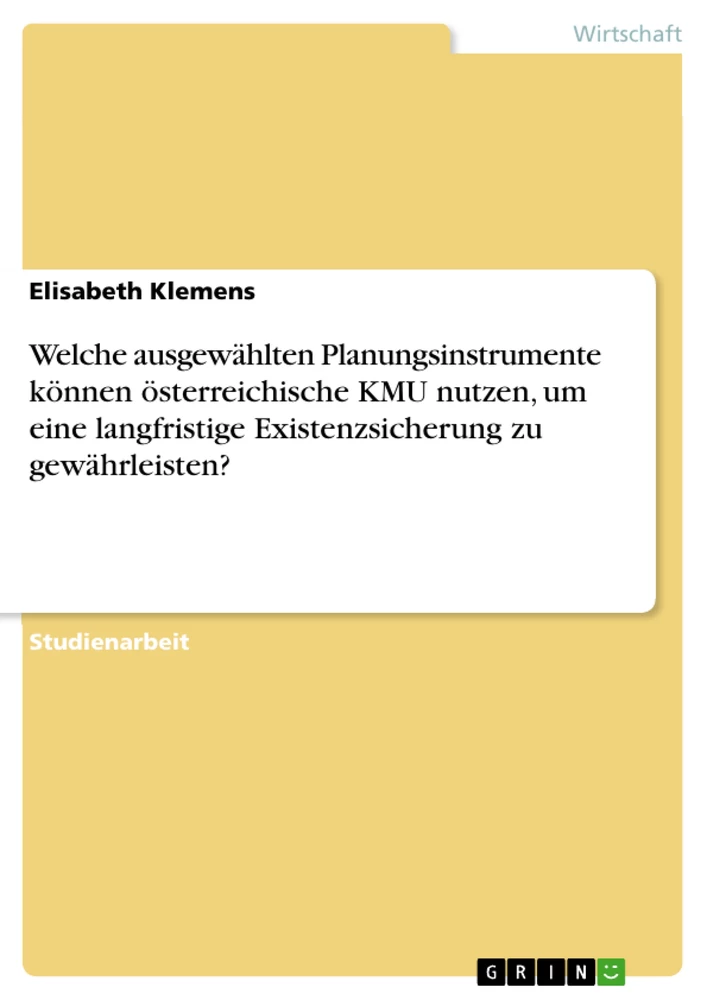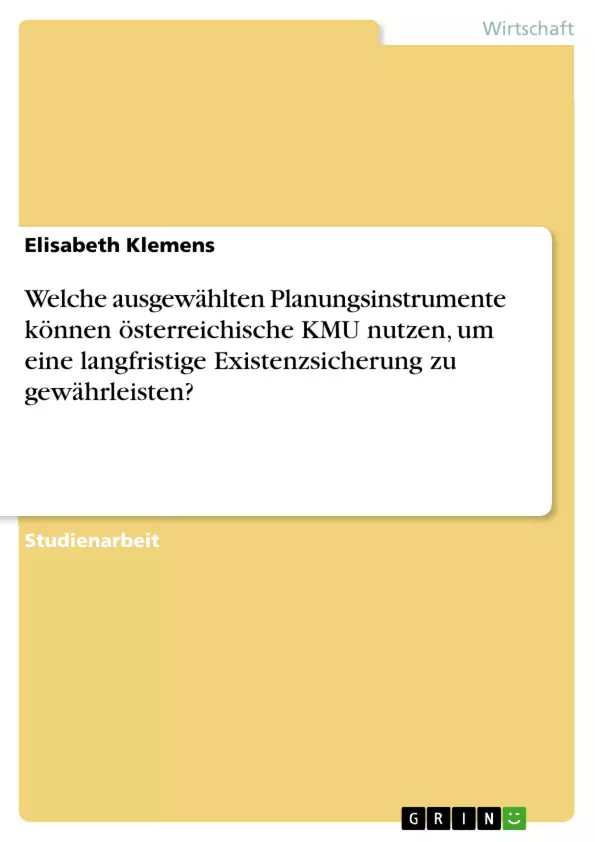Ziel dieser Arbeit ist es, ausgewählte Planungsinstrumente vorzustellen, deren effiziente Nutzung eine langfristige Existenzsicherung für KMU gewährleisten können. Dieses Ziel wird durch die Präsentation der verschiedenen Planungsinstrumente – operativ und strategisch – sowie eine Überprüfung ihrer Anwendbarkeit in KMU verwirklicht werden.
In der Literatur wird das Thema Planung in KMU seit Jahrzehnten diskutiert und es gibt immer wieder neue Journalbeiträge, die sich mit dem Ausmaß und der Art des Planungseinsatzes in Unternehmen auseinandersetzen, wobei der Fokus auf KMU noch zu kurz kommt. Planung ist folglich noch immer ein Aspekt, dem in KMU zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie in der Status-Quo-Beschreibung hervorgeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Abgrenzungen und Definitionen
- Klein- und Mittelunternehmen
- Quantitative Merkmale
- Qualitative Merkmale
- Planung
- Operative (kurzfristige) Planung
- Strategische (langfristige Planung)
- Planungs- und kontrollorientiertes Controlling
- Planung in KMU – Status Quo
- Chancen und Nutzen durch Planung in KMU
- Planungsinstrumente – eine Untersuchung
- Budgetierung
- Portfolio-Analyse
- Stärken-Schwächen-Analyse
- Konkurrenz-Analyse
- Kennzahlenanalyse
- Balanced Scorecard
- Zusammenfassung und Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Planungsinstrumente österreichische KMU nutzen können, um eine langfristige Existenzsicherung zu gewährleisten. Ziel ist es, die Relevanz von Planung für KMU aufzuzeigen, sie zu sensibilisieren, geeignete Planungsinstrumente vorzustellen und somit die Reduzierung von Insolvenzfällen sowie die langfristige Existenz heimischer Unternehmen zu fördern.
- Die Bedeutung von Planung für den Erfolg von KMU
- Die Herausforderungen, denen KMU bei der Implementierung von Planungsinstrumenten gegenüberstehen
- Die verschiedenen Planungsinstrumente, die für KMU relevant sind
- Der Einfluss von Planung auf die langfristige Existenzsicherung von KMU
- Die Bedeutung von Controlling für die Planung und Steuerung von KMU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Seminararbeit beginnt mit einer Einführung, die die Problemstellung der mangelnden Planung in KMU und die Zielsetzung der Arbeit darlegt. Anschließend werden die Begriffe „KMU“ und „Planung“ definiert, wobei insbesondere die Unterschiede zwischen operativer und strategischer Planung hervorgehoben werden. Der dritte Abschnitt befasst sich mit dem planungs- und kontrollorientierten Controlling-Ansatz als theoretischen Hintergrund der Arbeit.
Anschließend werden die Gründe für den Verzicht von KMU auf Planung sowie die Herausforderungen und Probleme im Zusammenhang mit Planung analysiert. Im fünften Kapitel werden die Chancen und Nutzen von Planung für KMU dargestellt. Abschließend werden verschiedene Planungsinstrumente wie beispielsweise Portfolio-Analyse, Konkurrenz-Analyse, Kennzahlenanalyse und Stärken-Schwächen-Analyse untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Planung in KMU, wobei der Fokus auf der Analyse von Planungsinstrumenten liegt, die österreichischen KMU zur Sicherung ihrer langfristigen Existenz nutzen können. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Planung, KMU, Strategische Planung, Operative Planung, Controlling, Portfolio-Analyse, Konkurrenz-Analyse, Kennzahlenanalyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Existenzsicherung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Planung für KMU in Österreich so wichtig?
Planung ist ein wesentliches Instrument zur langfristigen Existenzsicherung. Sie hilft KMU, Risiken frühzeitig zu erkennen, Insolvenzen zu vermeiden und strategische Wettbewerbsvorteile aufzubauen.
Was ist der Unterschied zwischen operativer und strategischer Planung?
Operative Planung ist kurzfristig (meist bis zu einem Jahr) und befasst sich mit dem Tagesgeschäft und Budgets. Strategische Planung ist langfristig und legt die grundlegende Ausrichtung des Unternehmens fest.
Welche Planungsinstrumente eignen sich besonders für KMU?
Zu den bewährten Instrumenten gehören die Budgetierung, die Portfolio-Analyse, die Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT), die Konkurrenz-Analyse sowie die Kennzahlenanalyse.
Was sind die häufigsten Gründe, warum KMU auf Planung verzichten?
KMU nennen oft Zeitmangel, fehlendes Know-how, die Fokussierung auf das operative Tagesgeschäft oder die Annahme, dass Planung für kleine Betriebe zu komplex sei, als Gründe.
Wie unterstützt Controlling den Planungsprozess?
Das Controlling fungiert als Informationsquelle und Überwachungsinstanz. Es liefert die notwendigen Daten für die Planung und kontrolliert durch Soll-Ist-Vergleiche die Erreichung der gesetzten Ziele.
Was ist eine Balanced Scorecard (BSC)?
Die Balanced Scorecard ist ein ganzheitliches Steuerungsinstrument, das neben Finanzkennzahlen auch Kunden-, Prozess- und Mitarbeiterperspektiven berücksichtigt, um die Strategie im Unternehmen umzusetzen.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Klemens (Autor:in), 2016, Welche ausgewählten Planungsinstrumente können österreichische KMU nutzen, um eine langfristige Existenzsicherung zu gewährleisten?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1302710