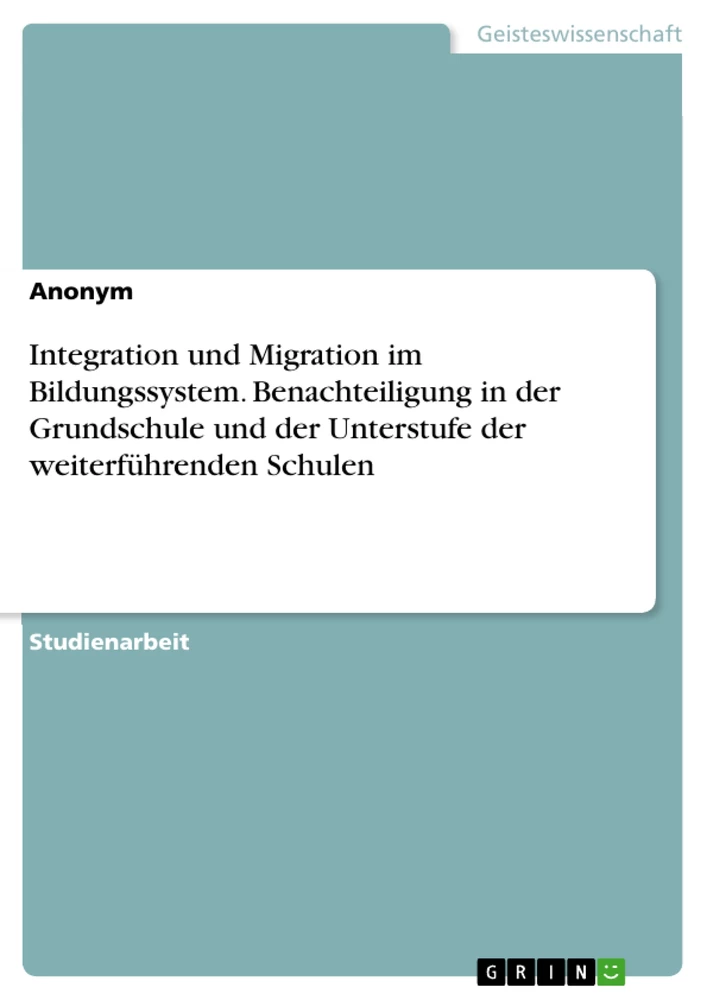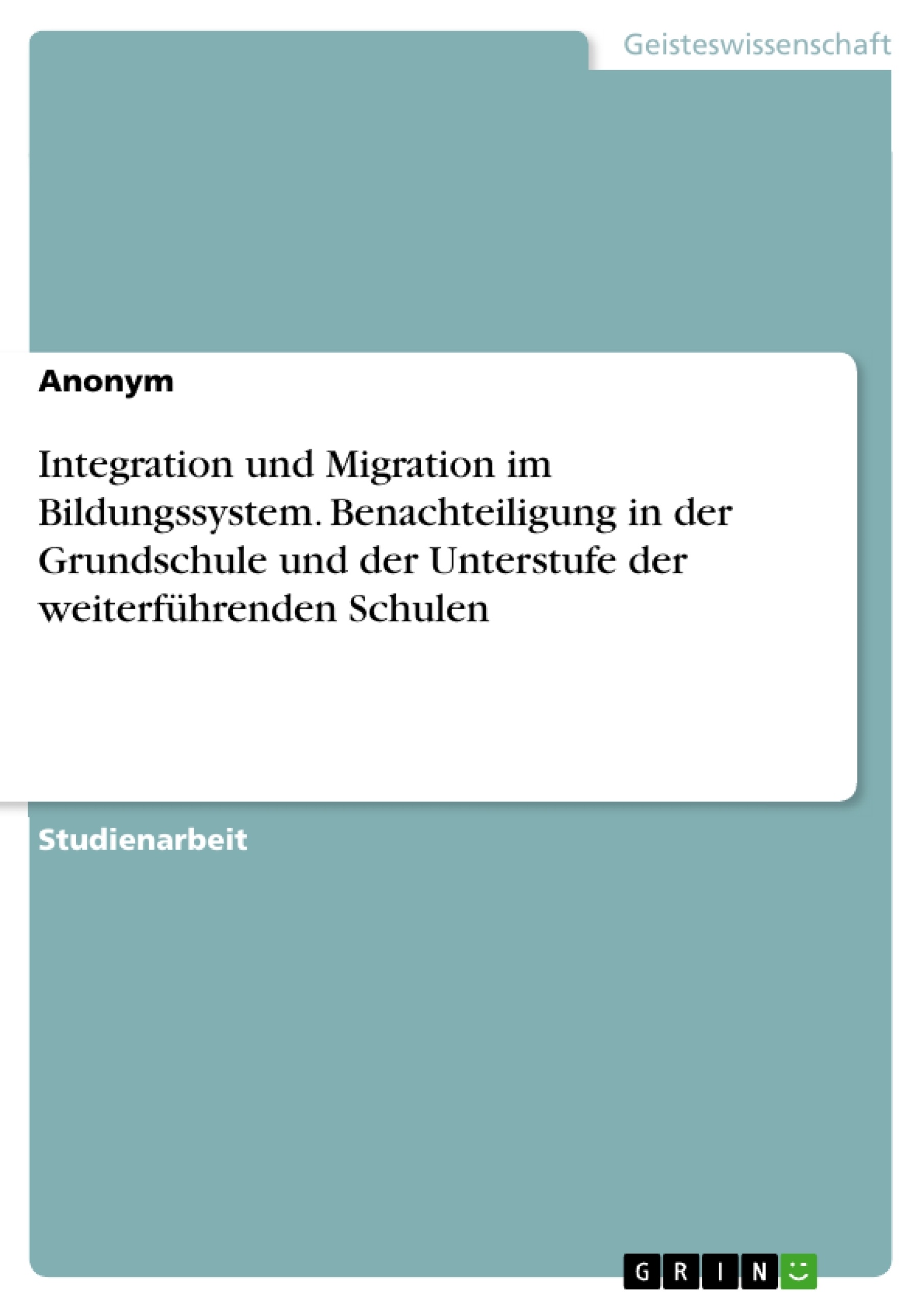In dieser Arbeit sollen die Ungleichheiten im Bildungssystem untersucht werden. Es soll überprüft werden, ob Benachteiligungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund auf deren Migrationshintergrund oder deren sozialen Status zurückzuführen sind. Darauf basierend sollen die Forschungsfragen aufgestellt werden. Zunächst sollen die Benachteiligungen ermittelt werden, welche Schüler:innen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem erfahren.
Dazu ergibt sich die Forschungsfrage: Welche Benachteiligungen erfahren Schüler:innen mit Migrationshintergrund? Diese Frage soll in Kapitel 2 beantwortet werden. Die in Erfahrung gebrachten Benachteiligungen der Schüler:innen mit Migrationshintergrund sollen im zweiten Schritt untersucht werden, ob sie eher auf den Migrationshintergrund oder er auf die soziale Herkunft der Schüler:innen zurückzuführen sind. Dazu ergibt sich die Forschungsfrage: Welche dieser Benachteiligungen sind nicht auf den Status des Migrationshintergrundes der Schüler:innen, sondern den sozialen Status zurückzuführen?
Diese Frage soll in Kapitel 3 beantwortet werden. Die Untersuchung soll sich auf die Grundschule und Unterstufe der weiterführenden Schulen beschränken. Eine Untersuchung der höheren Jahrgänge der weiterführenden Schulen, des tertiären Bildungssektors oder den Eintritt in das Arbeitsleben wird in dieser Arbeit nicht stattfinden. Auch wird keine fächerbezogene Untersuchung angestellt werden, es wird der schulische Erfolg allgemein betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund
- Forschungsfragen
- Benachteiligung von Schüler_innen mit Migrationshintergrund
- Definition Bildungsungleichheit
- Schulabschlüsse von ausländischen und deutschen Schüler_innen
- Benachteiligung von Schüler_innen aus niedrigen sozialen Schichten
- Einfluss der Sozioökonomischen Stellung der Schüler_innen
- Soziale Benachteiligung von Schüler_innenn aus Migrantenfamilien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Benachteiligung von Schüler_innen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem und analysiert, ob diese Benachteiligung primär auf den Migrationshintergrund oder den sozialen Status der Schüler_innen zurückzuführen ist. Die Arbeit verfolgt dabei das Ziel, ein tieferes Verständnis der Ursachen für Bildungsungleichheit zu gewinnen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Definition und Ausmaß von Bildungsungleichheit
- Einfluss des Migrationshintergrunds auf den Bildungserfolg
- Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Untersuchung von Faktoren, die zur Benachteiligung von Schüler_innen mit Migrationshintergrund beitragen
- Diskussion möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Dieses Kapitel stellt den Forschungsgegenstand "Benachteiligung von Schüler_innen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem" vor. Es werden die wichtigsten Begriffsdefinitionen erläutert und die Forschungsfragen formuliert.
Benachteiligung von Schüler_innen mit Migrationshintergrund
Dieses Kapitel beleuchtet die Thematik der Bildungsungleichheit, insbesondere die Unterschiede im Bildungsverhalten und den Schulabschlüssen von Schüler_innen mit und ohne Migrationshintergrund. Es werden statistische Daten und Studien zum Thema herangezogen, um die Diskrepanzen im Bildungserfolg aufzuzeigen.
Benachteiligung von Schüler_innen aus niedrigen sozialen Schichten
Dieses Kapitel betrachtet den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg. Es werden verschiedene Konzepte, wie der Klassismus und das soziale Kapital, diskutiert, um die Herausforderungen von Schüler_innen aus benachteiligten Familien im Bildungssystem zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, Sozioökonomische Stellung, Benachteiligung, Schulsystem, Bildungsgerechtigkeit, Integration, Inklusion.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Integration und Migration im Bildungssystem. Benachteiligung in der Grundschule und der Unterstufe der weiterführenden Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1301134