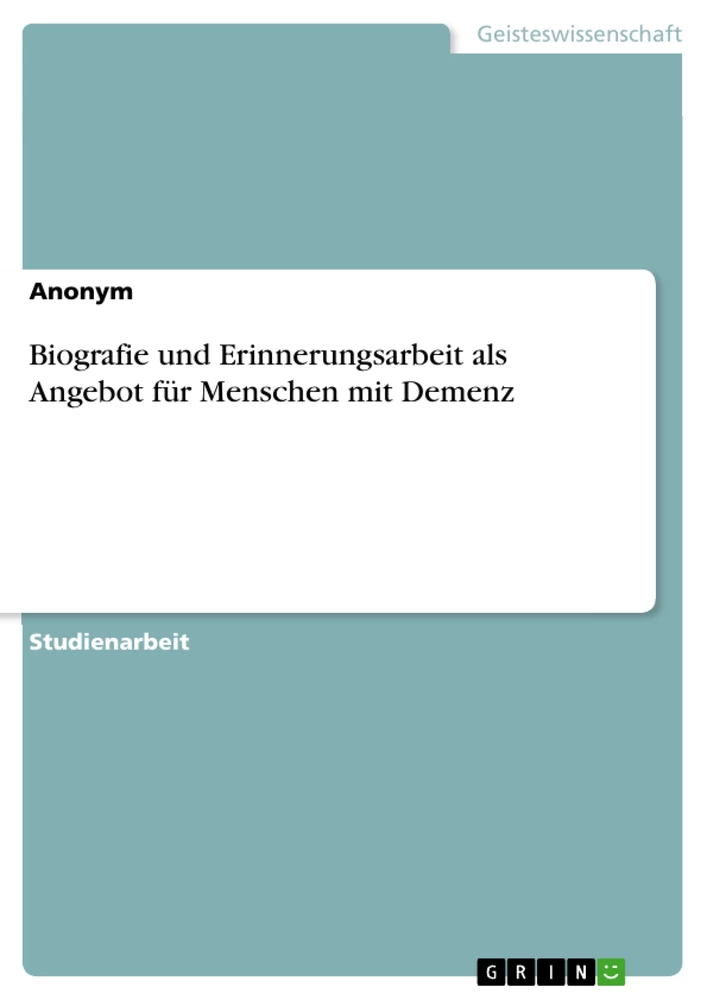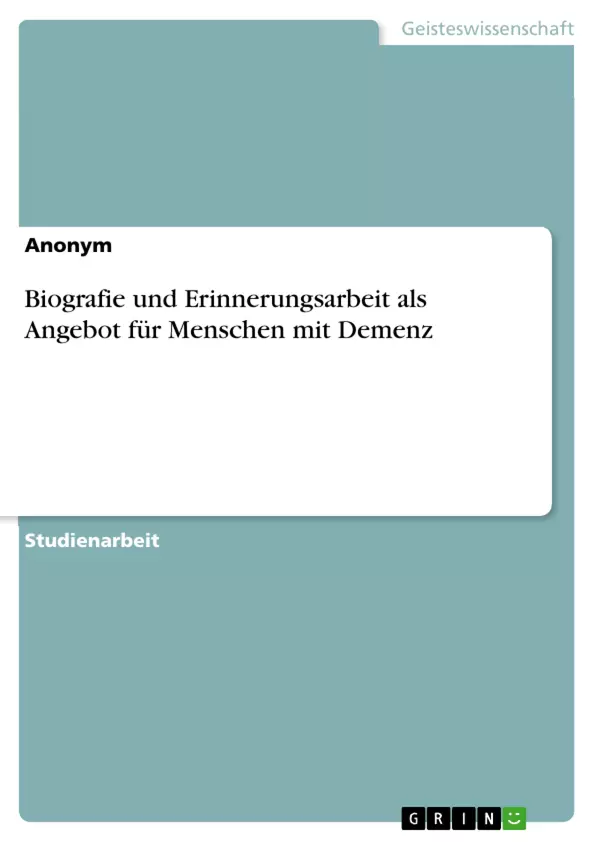Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit behandelt das Thema Biografie und Erinnerungsarbeit als Angebot für Menschen mit Demenz. Die Fragestellung beschäftigt sich damit, weshalb Angebote aus dem Bereich der Biografie- und Erinnerungsarbeit für die Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen sinnvoll sind.
Demenz ist eine große Beeinträchtigung für die Betroffenen sowie deren Familien und des sozialen Umfeldes. Die durch den demografischen Wandel ansteigenden Zahlen der Erkrankten zeigen die Wichtigkeit der Forschung auf, um die Prävention und die Therapie weiterzuentwickeln. Außerdem wird dadurch deutlich, dass die Gesellschaft in Zukunft für das Krankheitsbild sensibilisiert werden muss und die Pflegekräfte in Hinblick auf den Umgang mit demenziell Erkrankten besser und ausgiebiger geschult werden müssen.
Der erste Abschnitt thematisiert das Krankheitsbild der Demenz, indem der Begriff Demenz definiert und gemäß dem ICD10 vorgestellt wird. Des Weiteren werden die Formen der Demenz, die Ursachen und die Häufigkeit dargestellt. Außerdem werden Möglichkeiten der Diagnose, sowie die Auswirkungen der Demenz auf die Betroffenen skizziert. Der zweite Abschnitt beinhaltet eine Auseinandersetzung mit dem Thema Biografie-/ Erinnerungsarbeit. Dafür findet eine Differenzierung zwischen den Begriffen Lebenslauf und Biografie statt. Zusätzlich werden die Kernelemente sowie die Rahmenbedingungen, Formen und Methoden erläutert. Im dritten Abschnitt werden die Themen Demenz und Biografie-/ Erinnerungsarbeit in einen Kontext gesetzt, damit die Bedeutung von Biografie- und Erinnerungsarbeit für die Betreuung von Menschen mit Demenz dargestellt und deutlich wird. Das Fazit ergibt sich aus einer zusammenfassenden Betrachtung der wichtigsten Ergebnisse dieser Hausarbeit sowie einem Ausblick und einer Einschätzung des Potenzials der Biografie-/ Erinnerungsarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Krankheitsbild Demenz
- 2. Was ist Biografie - / Erinnerungsarbeit
- 3. Bedeutung und Eignung von Biografie- und Erinnerungsarbeit für die Betreuung von Menschen mit Demenz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht Biografie- und Erinnerungsarbeit als Angebot für Menschen mit Demenz. Sie befasst sich mit der Frage, warum solche Angebote für die Betreuung demenziell erkrankter Menschen sinnvoll sind. Die Arbeit analysiert die Bedeutung und Eignung dieser Arbeitsformen im Kontext der Demenz und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sie für die Betroffenen und deren Umfeld bieten.
- Das Krankheitsbild der Demenz, einschließlich Definition, Formen, Ursachen, Häufigkeit und Auswirkungen.
- Die Bedeutung und Funktionsweise von Biografie- und Erinnerungsarbeit, insbesondere in der Betreuung von Menschen mit Demenz.
- Die Eignung von Biografie- und Erinnerungsarbeit als Mittel zur Verbesserung der Lebensqualität und der emotionalen Stabilität von Demenzkranken.
- Die Rolle von Biografie- und Erinnerungsarbeit in der Unterstützung des sozialen Umfelds von Demenzkranken.
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Anwendung von Biografie- und Erinnerungsarbeit in der Demenzbetreuung ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Biografie- und Erinnerungsarbeit für Menschen mit Demenz. Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der steigenden Demenzzahlen und der Herausforderungen, die diese Entwicklung für die Gesellschaft mit sich bringt.
1. Krankheitsbild Demenz
Dieser Abschnitt definiert den Begriff Demenz und stellt die verschiedenen Formen, Ursachen und Auswirkungen der Erkrankung vor. Dabei werden die primären und sekundären Demenzen unterschieden und die Bedeutung der Diagnose sowie die Schweregrade der Demenz beleuchtet.
2. Was ist Biografie - / Erinnerungsarbeit
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Definition und den Kernelementen von Biografie- und Erinnerungsarbeit. Es werden die Unterschiede zwischen Lebenslauf und Biografie sowie die Rahmenbedingungen, Formen und Methoden dieser Arbeitsformen vorgestellt.
3. Bedeutung und Eignung von Biografie- und Erinnerungsarbeit für die Betreuung von Menschen mit Demenz
Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung und Eignung von Biografie- und Erinnerungsarbeit für die Betreuung von Menschen mit Demenz. Es werden die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser Arbeitsformen im Kontext der Demenz diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Demenz, Biografiearbeit, Erinnerungsarbeit, Lebensqualität, emotionale Stabilität, soziale Unterstützung, Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Biografie- und Erinnerungsarbeit als Instrument zur Verbesserung der Lebensqualität und der emotionalen Stabilität von Demenzkranken und zeigt die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Anwendung dieser Arbeitsformen in der Demenzbetreuung ergeben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Biografie und Erinnerungsarbeit als Angebot für Menschen mit Demenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1300320