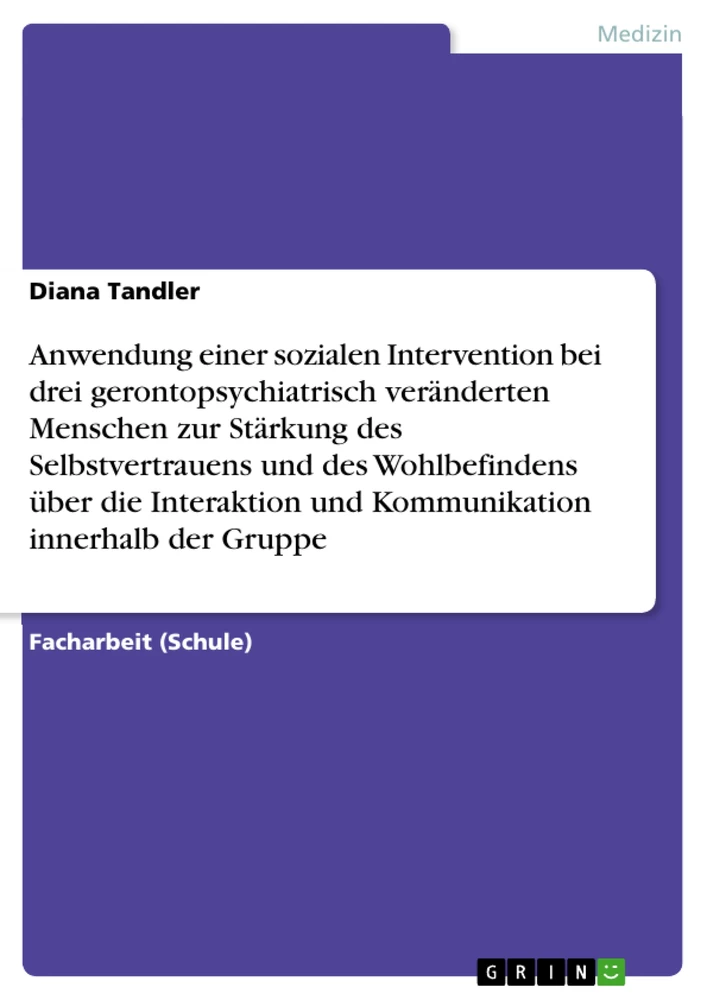Die Facharbeit beinhaltet eine von der Autorin geplante, durchgeführte und evaluierte soziale Intervention mit drei gerontopsychiatrisch veränderten Menschen, für deren Methodik die verbale Kommunikation innerhalb der Gruppe gewählt wurde. Ziel der Intervention war es, beziehungsförderlich zu wirken und das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit wie auch das Gefühl für die eigene Person zu stärken.
Von Geburt an bis zu seinem Tod ist der Mensch ein soziales Wesen, d.h. um zu überleben ist er auf das Miteinander seinesgleichen angewiesen. Ohne dieses Charakteristikum könnte unsere Spezies auf keinen Fall überleben. Damit die Entwicklung des Individuums in jedem Lebensabschnitt gewährleistet und möglichst positiv beeinflusst wird, geht es nicht nur um die Sicherstellung und Befriedigung existenzieller physischer Grundbedürfnisse wie beispielsweise nach Nahrung, Schlaf oder Schutz und Sicherheit, sondern ebenso um die Erfüllung psychischer Bedürfnisse, wie etwa dem nach Liebe und Berührung, nach Anerkennung und dem Wunsch, Teil einer Gruppe zu sein. Körperliche und geistig-seelische Bedürfnisse stehen in Korrelation zueinander: soziale Verarmung oder Isolation können somatische Beschwerden entstehen lassen. Der Mensch muss in der Interaktion mit anderen Personen sein, um sich selbst als Person zu erleben und die Welt auf kognitiver und emotionaler Ebene verstehen zu können.
Soziale Kontakte entwickeln und verändern sich im Laufe des Lebens, im zunehmenden Seniorenalter verringern sie sich meist. Für ältere und hochaltrige Menschen ist oftmals sehr schwer bzw. kaum möglich, den Kontakt zur Außenwelt aufrecht zu erhalten, insbesondere dann, wenn die Mobilität krankheitsbeding eingeschränkt ist u./o. kognitive Beeinträchtigungen aufgrund gerontopsychiatrischer Veränderungen bestehen. Dann ist es notwendig, dass Dritte die Rolle des "Vermittlers" übernehmen, Beziehung zu anderen Menschen ermöglichen und mit adäquaten Maßnahmen (Interventionen) den destruktiven Konsequenzen, die durch Isolation entstehen, entgegensteuern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Theoretische Abhandlungen der sozialen Intervention
- 2.2 Vorstellung der teilnehmenden Personen
- 2.3 Begründung der Methodenauswahl
- 2.4 Interventionsplan
- 2.5 Tatsächliche Verläufe der Interventionsdurchführungen
- 3. Zusammenfassung und Evaluation der Interventionsdurchführung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit analysiert die Anwendung einer sozialen Intervention bei drei gerontopsychiatrisch veränderten Menschen. Ziel der Intervention ist es, durch Interaktion und Kommunikation innerhalb der Gruppe das Selbstvertrauen und das Wohlbefinden der Teilnehmer zu stärken. Die Arbeit konzentriert sich auf die verbale Kommunikation als Methode der Intervention, um Beziehungen zu fördern, ein Gefühl der Gruppenzugehörigkeit zu schaffen und das Selbstbewusstsein der Teilnehmer zu steigern.
- Theoretische Grundlagen und Abhandlungen der sozialen Intervention
- Effekte sozialer Interventionen bei Menschen mit gerontopsychiatrischen Veränderungen
- Planung und Durchführung der Intervention
- Evaluation der Intervention und Analyse ihrer Ergebnisse
- Bedeutung der sozialen Kontakte für das Wohlbefinden im Alter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Intervention bei gerontopsychiatrisch veränderten Menschen ein. Es wird die Bedeutung sozialer Kontakte für das Wohlbefinden und die Entwicklung des Menschen im gesamten Leben betont. Dabei wird besonders auf die Herausforderungen im hohen Alter fokussiert, wenn soziale Isolation aufgrund von Mobilitätseinschränkungen oder kognitiven Beeinträchtigungen auftritt. Die Facharbeit beschreibt die geplante, durchgeführte und evaluierte soziale Intervention, die auf verbale Kommunikation innerhalb einer Gruppe basiert.
2. Hauptteil
2.1 Theoretische Abhandlungen der sozialen Intervention
Dieser Abschnitt beleuchtet den Begriff der Intervention im psychologischen Kontext und definiert die verschiedenen Anwendungsbereiche sozialer Interventionen in der Praxis. Es wird die Rolle der sozialen Intervention bei der Prävention, Behandlung und Eindämmung negativer Folgen von Störungen sowie die problem- und lösungsorientierte Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Betroffenen hervorgehoben. Die Anwendung in der Sozialarbeit und im psychotherapeutischen Bereich wird ebenfalls erläutert.
2.2 Vorstellung der teilnehmenden Personen
Dieser Abschnitt präsentiert die drei gerontopsychiatrisch veränderten Menschen, die an der sozialen Intervention teilgenommen haben. Die Beschreibungen umfassen relevante Informationen zu ihrer Lebenssituation, ihren Bedürfnissen und ihren individuellen Herausforderungen.
2.3 Begründung der Methodenauswahl
Die Begründung der Methodenauswahl fokussiert auf die Wahl der verbalen Kommunikation als Interventionmethode. Es werden die Vorteile der verbalen Interaktion für die Förderung von Beziehungen, die Stärkung des Selbstbewusstseins und die Verbesserung des Wohlbefindens der Teilnehmer erläutert. Die spezifischen Bedürfnisse der teilnehmenden Personen und ihre Eignung für die gewählte Methode werden ebenfalls berücksichtigt.
2.4 Interventionsplan
Der Interventionsplan beschreibt den detaillierten Ablauf der sozialen Intervention. Es werden die einzelnen Interventionsschritte, die Inhalte der Gesprächsgruppen und die Zeitplanung der Intervention erläutert. Der Plan umfasst die Ziele, die Inhalte und die Methoden der Intervention, die auf die Bedürfnisse der teilnehmenden Personen abgestimmt sind.
2.5 Tatsächliche Verläufe der Interventionsdurchführungen
Dieser Abschnitt beleuchtet den konkreten Verlauf der Intervention. Er beschreibt die Erfahrungen während der Interventionen, die Reaktion der Teilnehmer auf die Intervention, die Herausforderungen, die während der Interventionen aufgetreten sind, und die Anpassungen, die im Laufe der Interventionen vorgenommen wurden.
Schlüsselwörter
Soziale Intervention, Gerontopsychiatrie, Demenz, Selbstvertrauen, Wohlbefinden, Interaktion, Kommunikation, Gruppe, verbale Kommunikation, Beziehungen, Gruppenzugehörigkeit, Alter, Bedürfnisse, Herausforderungen, Interventionsplan, Interventionsschritte, Evaluation, Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer sozialen Intervention bei Demenz?
Ziel ist es, das Selbstvertrauen und Wohlbefinden durch Interaktion und Kommunikation zu steigern und Isolation entgegenzuwirken.
Welche Methode wurde in dieser Facharbeit angewandt?
Die Autorin nutzte gezielte verbale Kommunikation innerhalb einer kleinen Gruppe von drei gerontopsychiatrisch veränderten Menschen.
Warum ist soziale Interaktion für Senioren so wichtig?
Der Mensch ist ein soziales Wesen; Isolation kann zu psychischen Leiden und somatischen (körperlichen) Beschwerden führen.
Wie sieht ein Interventionsplan für diese Zielgruppe aus?
Er umfasst Vorbereitung, Einzelgespräche, gemeinsame Sitzungen und eine abschließende Evaluation der Verhaltensänderungen.
Was bedeutet „gerontopsychiatrisch verändert“?
Dieser Begriff bezieht sich auf psychische Erkrankungen im Alter, insbesondere kognitive Beeinträchtigungen wie Demenz.
- Arbeit zitieren
- Diana Tandler (Autor:in), 2020, Anwendung einer sozialen Intervention bei drei gerontopsychiatrisch veränderten Menschen zur Stärkung des Selbstvertrauens und des Wohlbefindens über die Interaktion und Kommunikation innerhalb der Gruppe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1299746