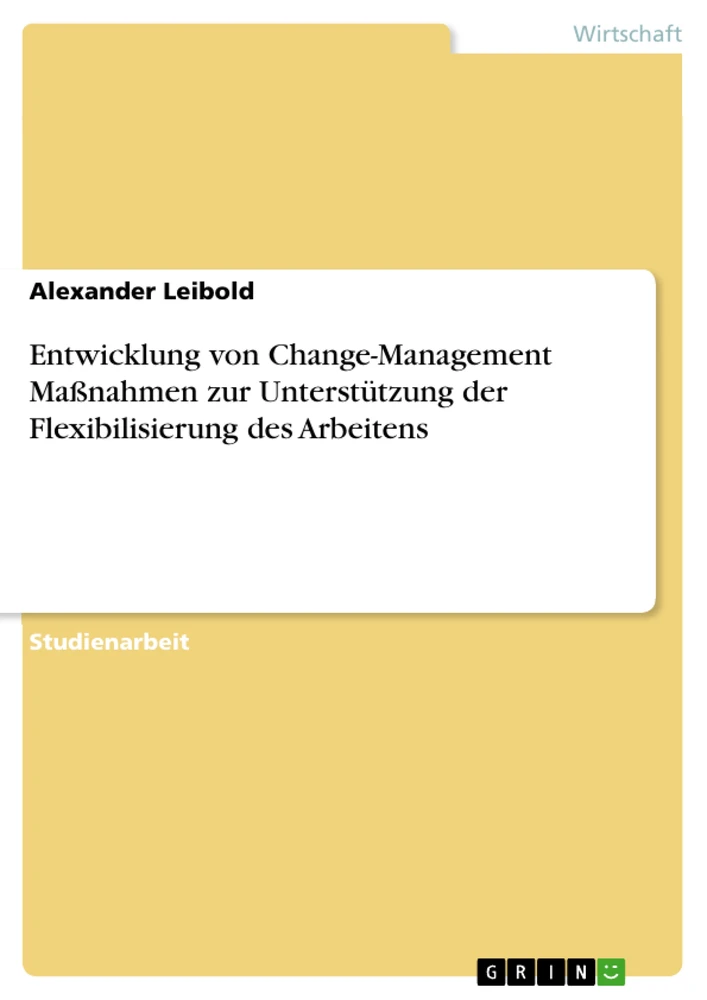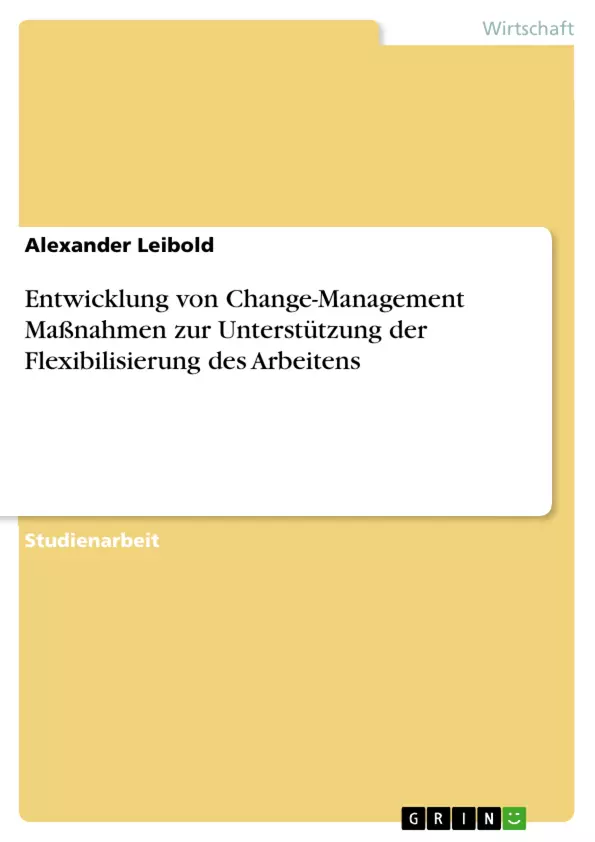Das Ziel dieser Arbeit beschreibt die Entwicklung von einem Change-Management Maßnahmenbündel zur Unterstützung der Flexibilisierung des Arbeitens. Der Begriff Change-Management (CM) wird in Kapitel 2 thematisch eingeführt. Ferner gilt es eine fundierte Begründung dessen zu liefern, warum Unternehmen durch die aufgestellten Maßnahmen bei dem flexiblen Arbeiten unterstützt werden und warum die aufgestellten Maßnahmen jeweils einzeln und in ihrem Zusammenwirken als besonders geeignet angesehen werden, um die spezifischen Herausforderungen organisatorischer Veränderung bewältigen zu können. Zum anderen soll ersichtlich gemacht werden, welche Herausforderungen sich bei dem in dieser Arbeit thematisierten Veränderungsvorhaben auf der psychologisch-emotionalen Ebene ergeben und wie die konkreten Maßnahmen zur Bewältigung beitragen.
Heutzutage sind Megatrends wie die Globalisierung, der demografische und gesellschaftliche Wandel, wie auch die Digitalisierung immer noch in aller Munde. Diese Trends halten nach wie vor an und eröffnen bis heute lösungsorientierte Hilfestellungen und Ansätze bei ungeklärten Fragestellungen. Durch die Verlässlichkeit und der ständigen Verfügbarkeit von digitalen Technologien im Privat- wie auch im Arbeitsleben, werden Unternehmen in die Lage versetzt, sich den bisher unlösbaren Herausforderungen stellen zu können. Entsprechend stellen sich Unternehmen ggü. anderen Unternehmen besser – sie werden wettbewerbsfähiger - sobald sie digitale Herausforderungen bzw. Veränderungen gemeistert haben. Durch die aktuellen Veränderungen der Arbeitswelt, mitunter bedingt durch die Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie, werden die Stimmen von Arbeitnehmern nach flexiblere Formen des Arbeitens wie z. B. Gleitzeitmodellen, mobilem Arbeiten oder Homeoffice und digitalen Unterstützungsprogrammen zum kollaborativen Arbeiten sowie Onlinevideokonferenzen immer lauter. Nach Pfannstiel und Steinhoff werden Formen „[…] der virtuellen Teamarbeit in Zukunft durch die vermehrte Nutzung mobilen Arbeitens oder Homeoffice nach der Corona-Pandemie noch weiter zunehmen.“
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Thematische Einführung und Schaffung theoretischer Grundlagen
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Change-Managements
- Erfordernisse und Ziele des Change-Managements
- Integratives Modell auf Sach- und psychologischer Ebene nach Vahs
- Flexibilisierung des Arbeitens durch flexible Formen
- Definition des flexiblen Arbeitens
- Flexibilisierungsformen des Arbeitens
- Zusammenfassung der wesentlichen Befunde aus Kap. 2.1 bis Kap. 2.3
- Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitens
- Herleitung geeigneter Unterstützungsmaßnahmen von flexiblem Arbeiten
- Flexibles Arbeitszeitmodell
- Mobil-flexibles Arbeiten
- Remote Working / Homeoffice
- Open-Space-Konzept mit integrativem Desk Sharing
- New Work-Ansatz
- Zusammenwirkung der Unterstützungsmaßnahmen
- Ableitung von Herausforderungen auf psychologisch-emotionaler Ebene
- Kritische Reflexion, Diskussion und Limitation
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung von Change-Management Maßnahmen, die die Flexibilisierung von Arbeitsformen unterstützen. Dabei werden die Anforderungen und Ziele des Change-Managements im Kontext der Digitalisierung und der aktuellen Arbeitswelt analysiert. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Integration verschiedener flexibler Arbeitsformen, wie z.B. mobiles Arbeiten, Homeoffice und New Work Ansätze. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Flexibilisierung zu schaffen und praktikable Lösungsansätze zu entwickeln.
- Einführung in das Change-Management und die Bedeutung von Flexibilisierung
- Analyse der Anforderungen und Ziele des Change-Managements im Kontext der Digitalisierung
- Untersuchung von flexiblen Arbeitsformen und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt
- Entwicklung von Change-Management Maßnahmen zur Unterstützung der Flexibilisierung
- Kritik und Limitationen der entwickelten Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein, beschreibt die Problemstellung und definiert die Zielsetzung. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff des Change-Managements und seine Relevanz in der modernen Arbeitswelt. Es werden insbesondere die Erfordernisse und Ziele des Change-Managements sowie verschiedene Modelle und Ansätze zur erfolgreichen Implementierung von Veränderungen diskutiert. Kapitel 3 widmet sich der Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen für die Flexibilisierung des Arbeitens. Dabei werden verschiedene flexible Arbeitsformen, wie z.B. mobiles Arbeiten, Homeoffice und New Work Ansätze, vorgestellt und deren Implikationen für die Unternehmenspraxis analysiert.
Schlüsselwörter
Change-Management, Flexibilisierung des Arbeitens, Digitalisierung, Arbeitswelt, Mobile Arbeit, Homeoffice, New Work, Agile Organisation, Kollaboration, Work-Life-Balance.
- Arbeit zitieren
- Alexander Leibold (Autor:in), 2022, Entwicklung von Change-Management Maßnahmen zur Unterstützung der Flexibilisierung des Arbeitens, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1298947