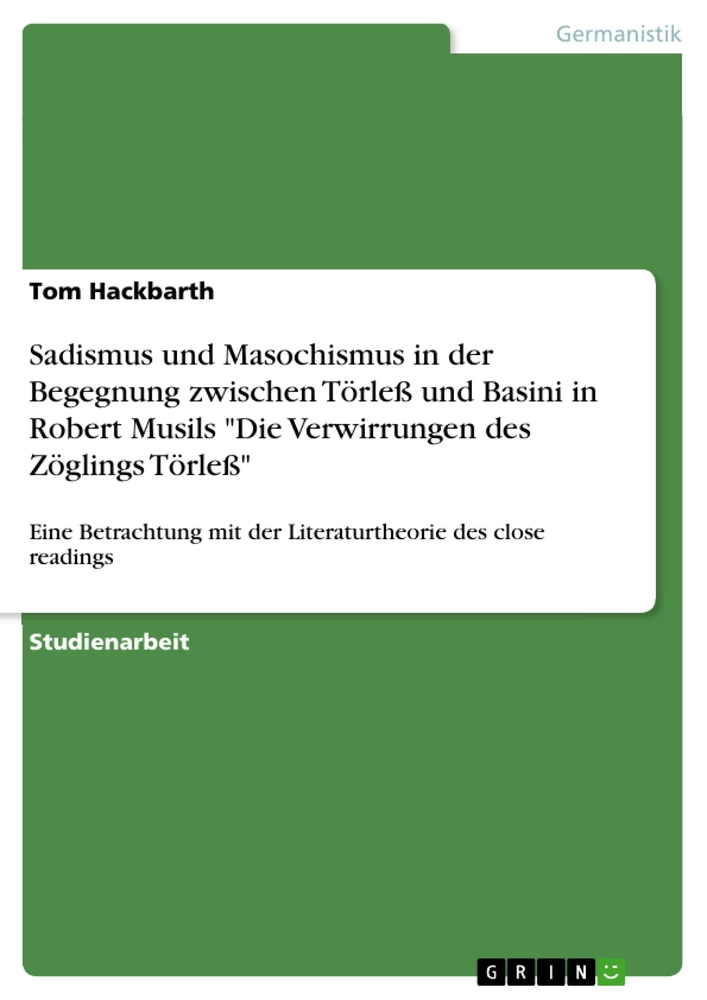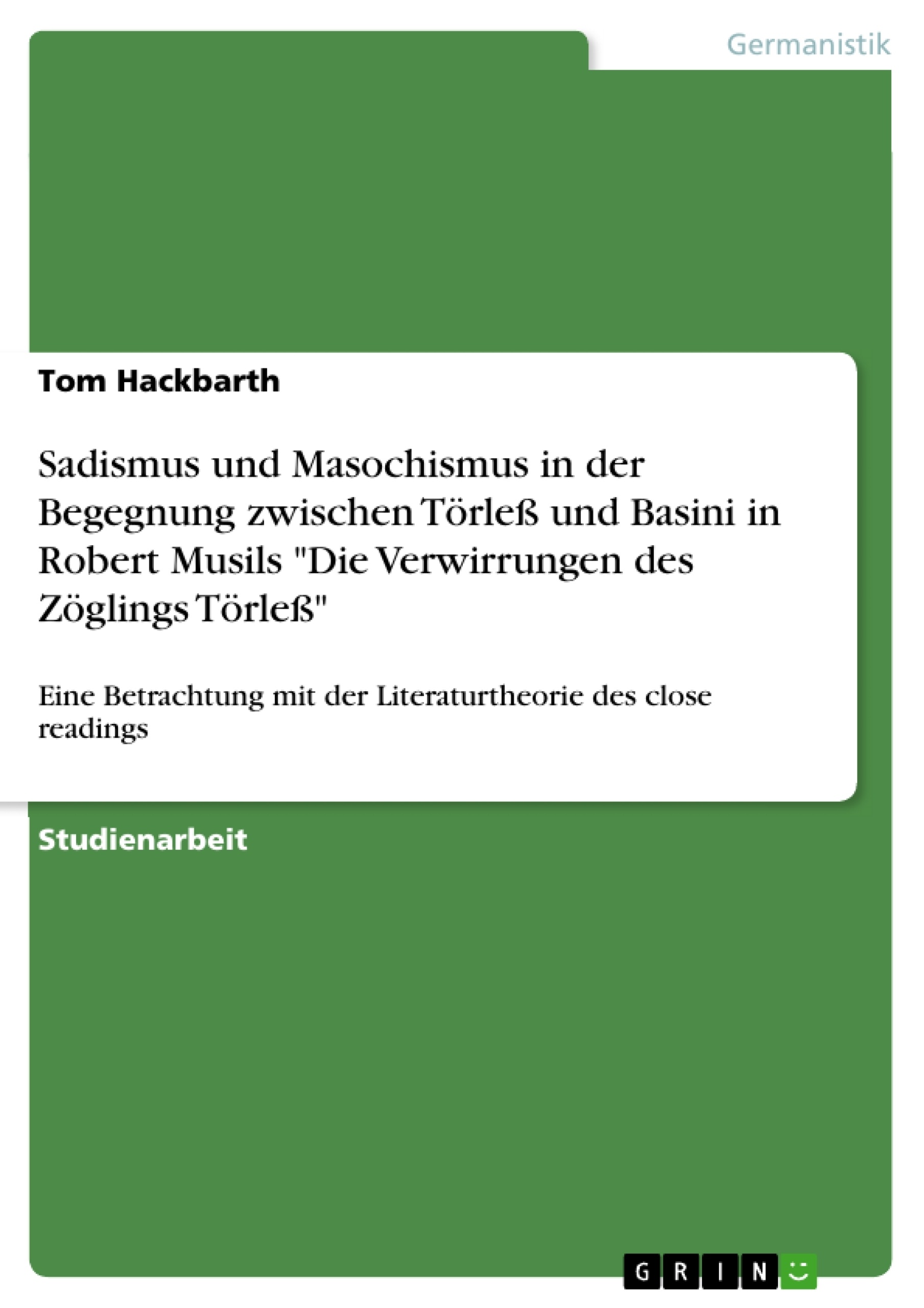Robert Musil thematisiert in "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" das Aufwachsen der Zöglinge eines Konvikts und rückt hierbei die Pubertät und die erwachende Sexualität der Jungen in den Fokus. Vor dem Hintergrund der autoritären Gesellschaftsstrukturen bestimmt insbesondere das sadistische und masochistische Handeln einzelner Figuren die Handlung maßgeblich. Ziel dieser Untersuchung ist, diese Neigungen mithilfe der literaturwissenschaftlichen Methode des close readings herauszustellen, wobei die Figuren Törleß und Basini im Zentrum des Interesses stehen werden. Diese Figuren erwecken den Anschein, einer Neigung zuordenbar zu sein, stellen sich bei näherer Betrachtung allerdings als komplexer und doppelsinniger dar, wodurch sie für eine genaue Analyse besonders geeignet erscheinen. In der Untersuchung sollen sowohl das Verhalten beider Figuren in ihrer unmittelbaren Begegnung als auch Bezugspunkte im vorherigen und nachfolgenden Geschehen beleuchtet werden, da diese als Vorausdeutungen oder Rückblenden fungieren können und somit die Wahrnehmung der zentralen Szene beeinflussen.
Um der Literaturtheorie des close readings gerecht zu werden und eine präzise Untersuchung zu ermöglichen, erfolgt die Analyse größtenteils im Hinblick auf eine Szene – die Begegnung zwischen Törleß und Basini während der Abwesenheit der anderen Zöglinge in einer kurzen Ferienzeit. Insbesondere durch die Absenz der Mitschüler Beineberg und Reiting enthält diese Szene das Potenzial, das Handeln Törleß' und Basinis präzise zu betrachten. Dennoch werden auch Handlungsmomente aus vorangegangenen und nachfolgenden Szenen hinzugezogen, insofern sie sich auf das Geschehen in der hauptsächlich untersuchten Szene auswirken oder beziehen lassen.
In Vorbereitung auf die Textstellenanalyse wird zunächst in die Methode der Literaturtheorie des close readings eingeführt. Ein anschließender Überblick über die Begrifflichkeiten des Sadismus und Masochismus und die damit verbundenen Theorien führt in den motivischen Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit ein. Hierbei liegt der Fokus auf einer allgemeinen Übersicht, der die Theorie Freuds, Ergänzungen durch Reick und die Ansichten Fromms skizziert.
In Kapitel 3 erfolgt final die Anwendung der Literaturtheorie des close readings unter Berücksichtigung einer Analyse der Motive des Sadismus und Masochismus in der Begegnungsszene zwischen Törleß und Basini.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodische und begriffliche Grundlagen
- Die Literaturtheorie des close readings – Methode
- Zum Begriff des Sadismus
- Zum Begriff des Masochismus
- Sadismus und Masochismus in Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
- Die Begegnung zwischen Törleß und Basini
- Der Sadismus Törleß'
- Der Masochismus Basinis
- Der Masochismus Törleß'
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung analysiert Robert Musils Roman „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ im Hinblick auf die Themen Sadismus und Masochismus. Der Fokus liegt auf der Begegnung zwischen den Figuren Törleß und Basini, wobei die literaturwissenschaftliche Methode des close readings zum Einsatz kommt. Ziel der Analyse ist es, die komplexen Machtstrukturen und Beziehungsdynamiken zwischen den Figuren durch eine detaillierte Textinterpretation herauszuarbeiten.
- Die erwachende Sexualität in der Pubertät
- Sadistische und masochistische Verhaltensweisen in der Beziehung zwischen Törleß und Basini
- Die Rolle der Autorität und die Auswirkungen auf die Handlung
- Die Ambivalenz der Figurencharaktere und ihre komplexen Beziehungen
- Der Einfluss von Sprache und Stil auf die Interpretation der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Romans ein und stellt die Zielsetzung der Untersuchung dar. Sie betont die Bedeutung der erwachenden Sexualität und der sadistischen und masochistischen Verhaltensweisen der Figuren im Kontext der autoritären Gesellschaftsstrukturen. Die Analyse fokussiert auf die Figuren Törleß und Basini und ihre komplexe Beziehung.
Methodische und begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die Methode des close readings und erläutert die Begrifflichkeiten Sadismus und Masochismus. Der Fokus liegt auf der literaturwissenschaftlichen Interpretation des Textes und der Abgrenzung von externen Einflüssen.
Sadismus und Masochismus in Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß: Dieses Kapitel analysiert die Begegnung zwischen Törleß und Basini unter dem Aspekt von Sadismus und Masochismus. Es beleuchtet das Verhalten beider Figuren und die Beweggründe für ihr Handeln.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Sadismus, Masochismus, Pubertät, Sexualität, Autorität, close reading, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, Robert Musil, Törleß, Basini. Die Analyse konzentriert sich auf die literarische Darstellung dieser Themen im Kontext des Romans und der literaturwissenschaftlichen Methode des close readings.
- Quote paper
- Tom Hackbarth (Author), 2022, Sadismus und Masochismus in der Begegnung zwischen Törleß und Basini in Robert Musils "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1297702