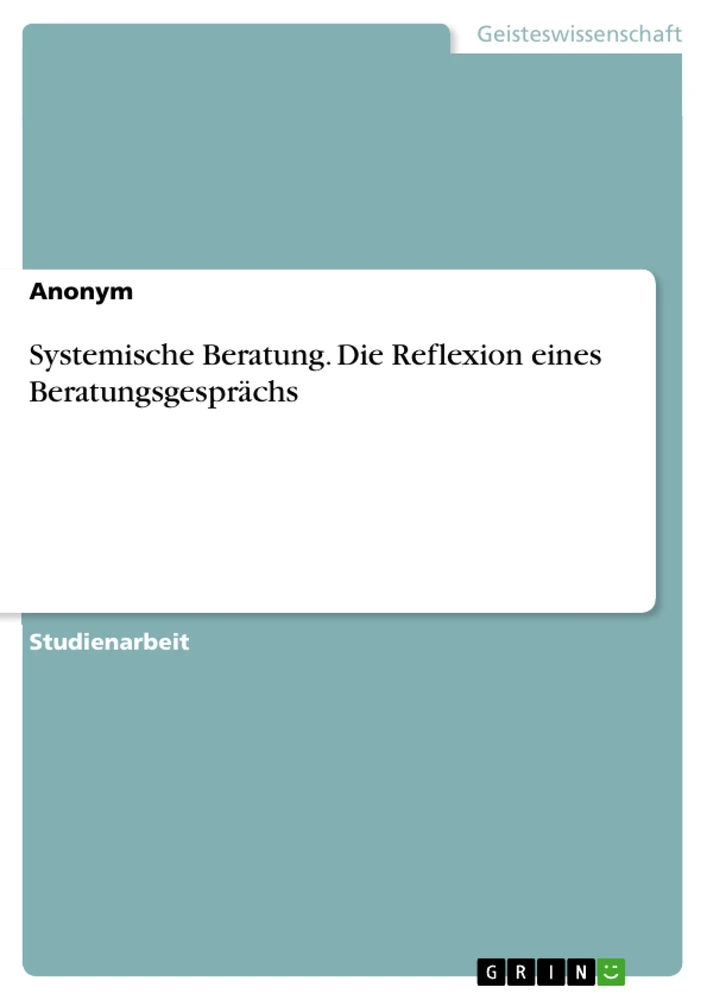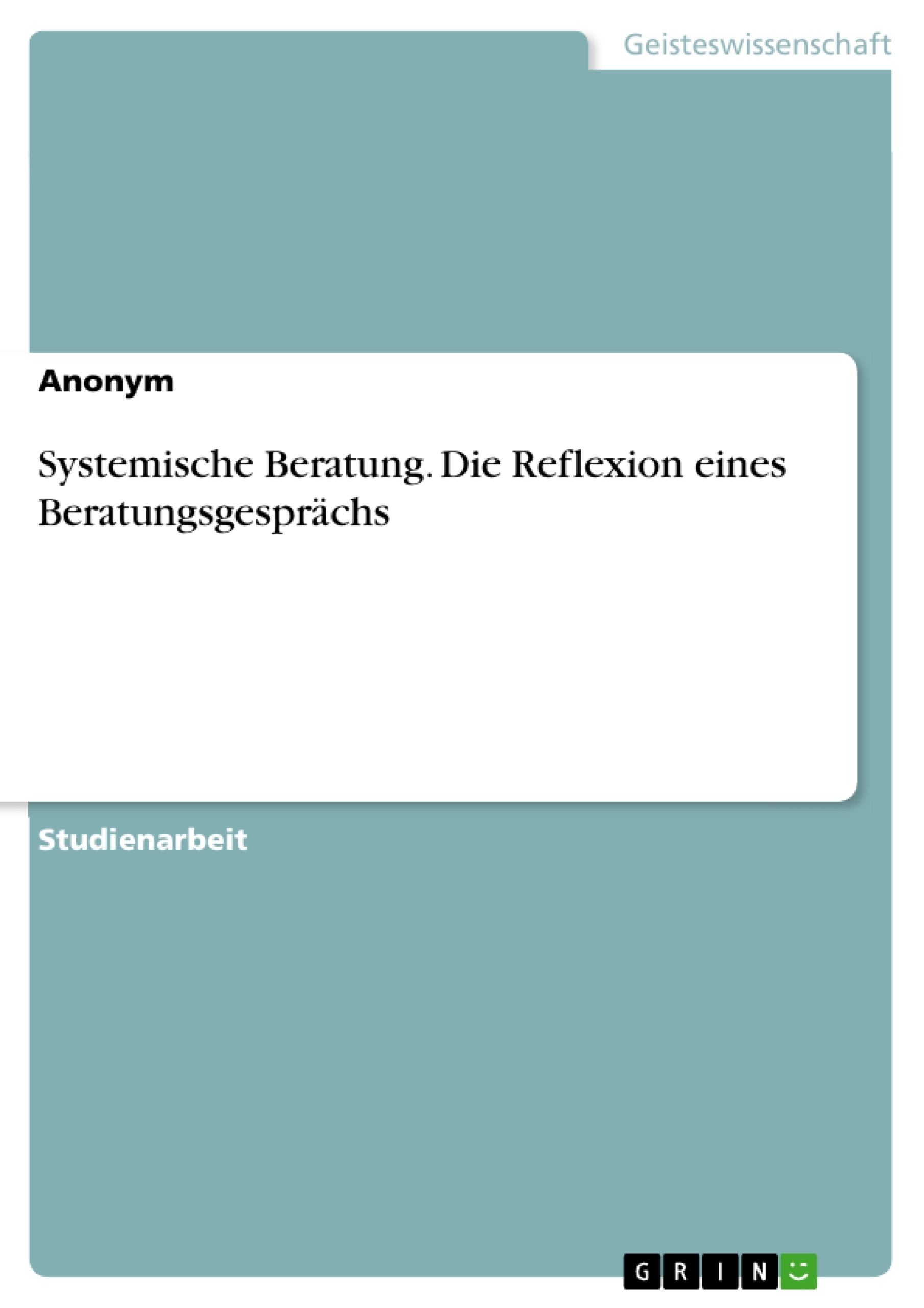Die vorliegende Arbeit dient dem Zweck, die eigene Beratertätigkeit einzuschätzen. Im Rahmen dessen erfolgt die Durchführung eines Beratungsgespräches mit einem Klienten durch die eigene Person. Anhand dieses Gespräches werden die individuellen Beraterkompetenzen analysiert und reflektiert. Im Voraus werde ich versuchen den Begriff der systemischen Beratung zu bestimmen. Die Bestimmung dieser dient dem Zweck, im Vorfeld ein einheitliches Grundverständnis zu schaffen sowie dem Ausschließen von Unklarheiten. Innerhalb des systemischen Beratungsfeldes gibt es zahlreiche Methoden, die praktiziert wer-den.
Da die Nutzung aller verfügbaren Methoden den Rahmen einer Sitzung überschreiten würde und ebenso unangemessen wäre, beschreibe ich innerhalb der vorliegenden Arbeit, lediglich die von mir genutzten. Es handelt sich dabei, um die der Visualisierung und den Einsatz einer Stärken-Schatzkiste. Anschließend wird der Beratungsprozess beschrieben, wobei sowohl auf den Kontext des Gespräches als auch auf den Klienten selbst eingegangen wird. Der Fokus liegt allerdings auf der Analyse und der Reflexion des geführten Beratungsgespräches. In diesem Kontext gliederte ich das Gespräch in fünf Phasen. Die erste Phase unterliegt dem Aufbau der Beziehung zu dem Klienten. Darauf folgt die Formulierung der Zieldefinition, welche am Ende der Beratung erreicht werden sollte. Um dies zu erfüllen, wird in der folgenden Phase eine Lösungs- und Bearbeitungsebene erforscht. Als nächstes müssen dem Klienten Impulse gegeben werden, die zur Lösung des Problems beitragen können und gemeinsam mit dem Berater, durch unterschiedliche Fragestellungen, erarbeitet werden. Die letzte, und ebenso relevante, Phase bildet der Abschluss des Gespräches.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Definitionsversuch von Systemischer Beratung
- Angewandte Methodik im Beratungsgespräch
- Visualisierung in Form eines Ressourcenbaumes
- Stärken-Schatzkiste
- Das Beratungsgespräch
- Kontext des Gespräches
- Beschreibung der Klientin
- Analyse und Reflexion des Beratungsgespräches
- Beziehungsaufbau
- Zielformulierung
- Finden einer Bearbeitungs- und Lösungsebene
- Impulse geben
- Gesprächsabschluss
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die eigene Beratertätigkeit anhand eines geführten Beratungsgespräches mit einem Klienten zu analysieren und zu reflektieren. Dabei soll ein Verständnis für systemische Beratung entwickelt und die angewandten Methoden, wie die Visualisierung und die Stärken-Schatzkiste, erläutert werden. Der Fokus liegt auf der Analyse des Gesprächsprozesses, der in verschiedene Phasen gegliedert wird.
- Definition und Grundprinzipien der systemischen Beratung
- Anwendungen und Methoden in der Beratungspraxis
- Analyse und Reflexion des Beratungsgesprächs
- Beziehungsaufbau und Zielformulierung im Beratungsprozess
- Ressourcenorientierte Vorgehensweise und Lösungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema der Beratung ein und erläutert die Bedeutung professioneller Beratungsfähigkeiten im sozialen Kontext. Sie beschreibt die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit und die Struktur des Textes.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition und den Grundprinzipien der systemischen Beratung. Dabei werden die interaktiven Prozesse, die Zielsetzung der Beratung und die Bedeutung der Beziehung zwischen Berater und Klient hervorgehoben.
- Kapitel 3 präsentiert angewandte Methoden im Beratungsgespräch, wie die Visualisierung in Form eines Ressourcenbaumes und den Einsatz einer Stärken-Schatzkiste. Es werden die Vorteile und der Einsatzbereich dieser Methoden im Detail erläutert.
- Kapitel 4 beschreibt den Beratungsprozess anhand eines konkreten Beispiels. Es werden der Kontext des Gespräches, die Beschreibung des Klienten und die Analyse des Gesprächs anhand der Phasen des Beziehungsaufbaus, der Zielformulierung, der Lösungsfindung, der Impulsgebung und des Gesprächsabschlusses dargestellt.
Schlüsselwörter
Systemische Beratung, Ressourcenorientierung, Visualisierung, Stärken-Schatzkiste, Beratungsgespräch, Analyse, Reflexion, Beziehungsaufbau, Zielformulierung, Lösungsfindung, Impulse, Gesprächsabschluss.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Systemische Beratung. Die Reflexion eines Beratungsgesprächs, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1297483