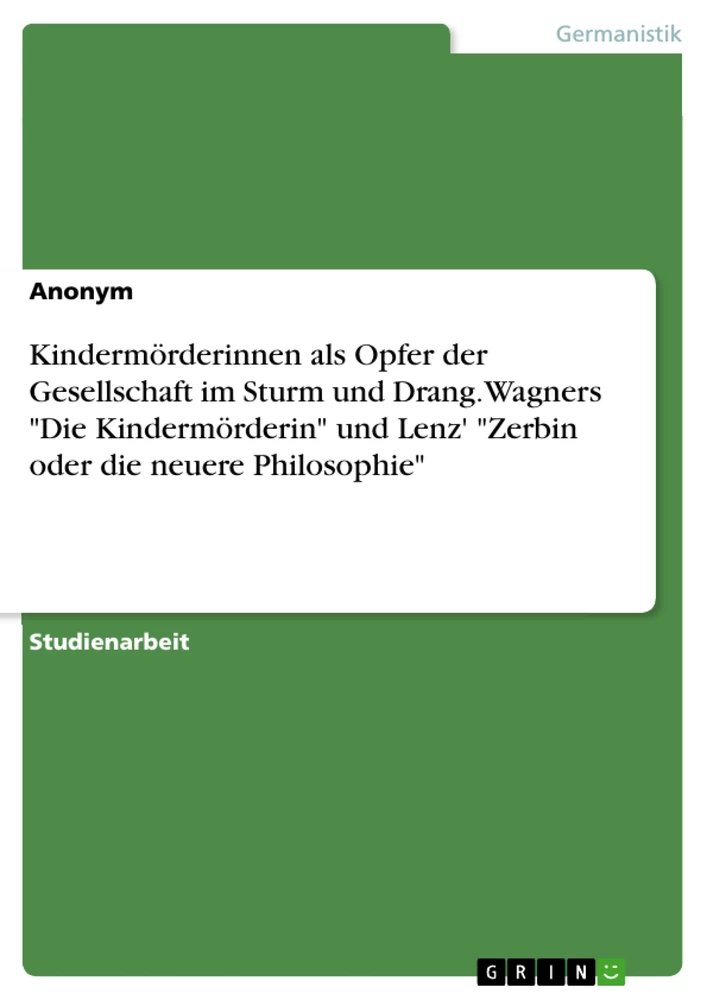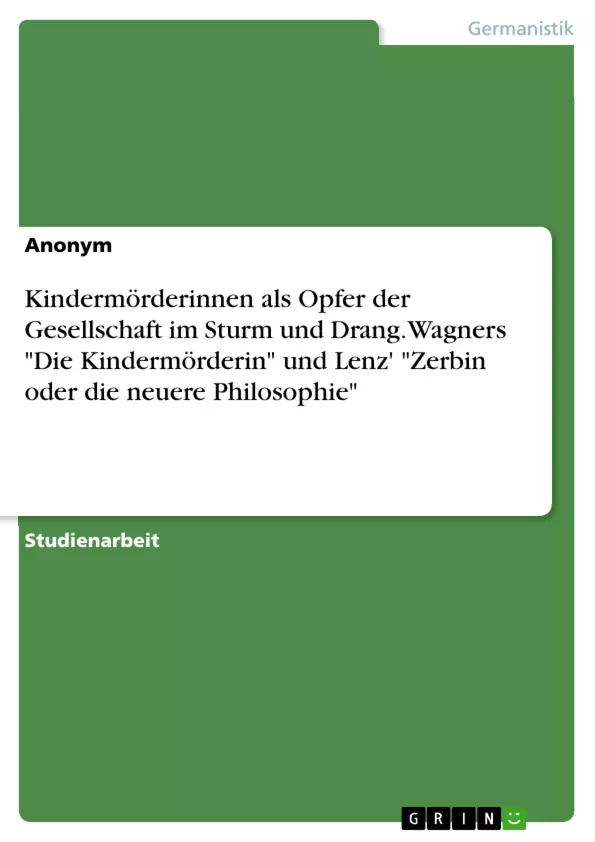Sowohl Heinrich Leopold Wagner als auch Jakob Michael Reinhold Lenz befassten sich in der Epoche des Sturm und Drang mit dem zentralen Motiv des Kindsmords. Diese Arbeit hat es sich zum Ziel genommen, Wagners Drama "Die Kindermörderin" und Lenz' Erzählung "Zerbin oder die neuere Philosophie" unter formalen Analysepunkten zu untersuchen. Dabei wird zunächst die figurale Konzeption im Hinblick auf die Hauptfiguren und den familiären Hintergrund analysiert.
Darauf aufbauend wird der Weg zur Schwangerschaft, der daraus resultierende Kindsmord und die Strafe beleuchtet. In einem Fazit wird ein abschließender Vergleich gezogen. Die Analyse erfolgt vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung der Be- und Verurteilung des Kindsmords vom Mittelalter bis zum 1813 erschienenen Bayrischen Strafgesetzbuch. Dabei soll geklärt werden, inwiefern Lenz' Erzählung und Wagners Drama Sozialkritik an den herrschenden Zuständen übten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Werkanalyse
- Gattungsanalyse
- Hintergründe der Figuren
- Evchen und Marie
- Gröningseck und Zerbin
- Mutter und Vater
- Der Weg zur Schwangerschaft: Vergewaltigung oder Verführung?
- Der Kindsmord und die Strafe
- Fazit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Wagners Drama „Die Kindermörderin“ und Lenz’ Erzählung „Zerbin oder die neuere Philosophie“ im Hinblick auf ihre formalen Aspekte. Der Fokus liegt auf der figuralen Konzeption, dem Weg zur Schwangerschaft, dem Kindsmord und der Strafe. Die Arbeit untersucht, wie die beiden Werke vor dem Hintergrund des historischen Kindsmorddiskurses die Form nutzen, um ihre jeweilige Botschaft zu transportieren.
- Formale Analyse von Wagners Drama und Lenz' Erzählung
- Vergleich der beiden Werke im Hinblick auf den Kindsmorddiskurs
- Analyse der Hauptfiguren und ihrer familiären Hintergründe
- Untersuchung der Darstellung der Schwangerschaft, des Kindsmords und der Strafe
- Bedeutung der Form für die Sozialkritik der beiden Werke
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Kindsmords im 18. Jahrhundert ein und stellt die beiden zu analysierenden Werke vor. Sie hebt die unterschiedlichen Formen von Drama und Erzählung hervor und zeigt die Bedeutung des historischen Kindsmorddiskurses für die Werke auf.
Die formale Werkanalyse widmet sich der Gattungsanalyse und der Konzeption der Figuren. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Handlungsweisen der Figuren, wie beispielsweise die Entwicklung von Evchen und Gröningseck im Drama. Zudem wird die sprachliche Gestaltung der Werke analysiert und auf die Spiegelung der sozialen Verhältnisse hingewiesen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Kindsmord, Sozialkritik, Sturm und Drang, Drama, Erzählung, Wagners „Die Kindermörderin“, Lenz’ „Zerbin oder die neuere Philosophie“, Figurenkonzeption, Geschlecht, Klasse, Alter, Herrschaft, Unterordnung, Sprache.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Kindermörderinnen als Opfer der Gesellschaft im Sturm und Drang. Wagners "Die Kindermörderin" und Lenz' "Zerbin oder die neuere Philosophie", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1294651