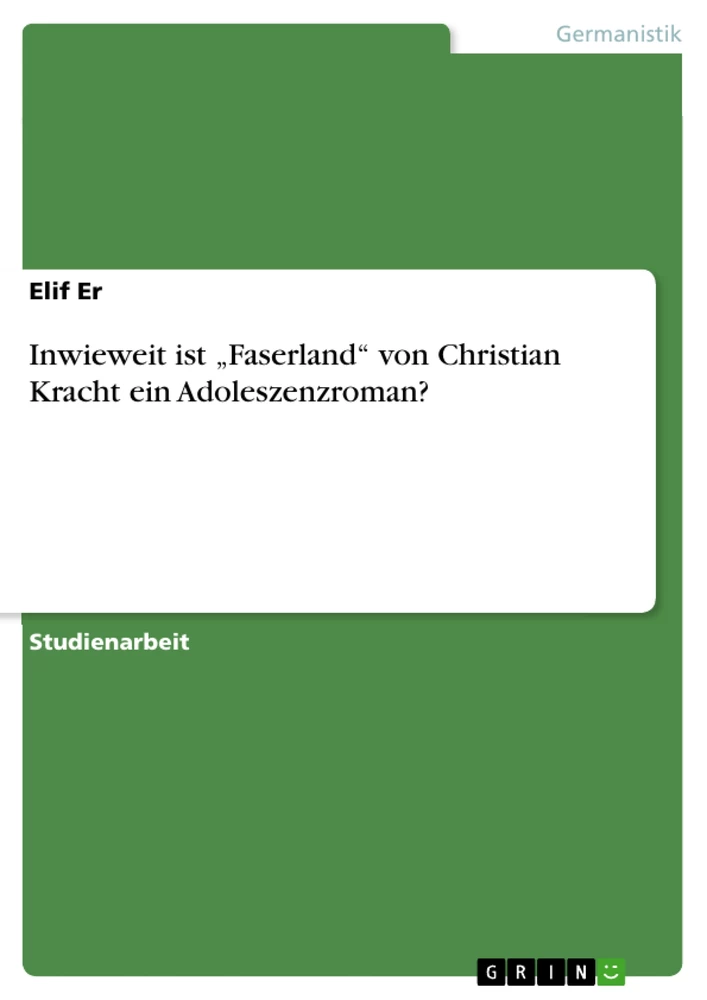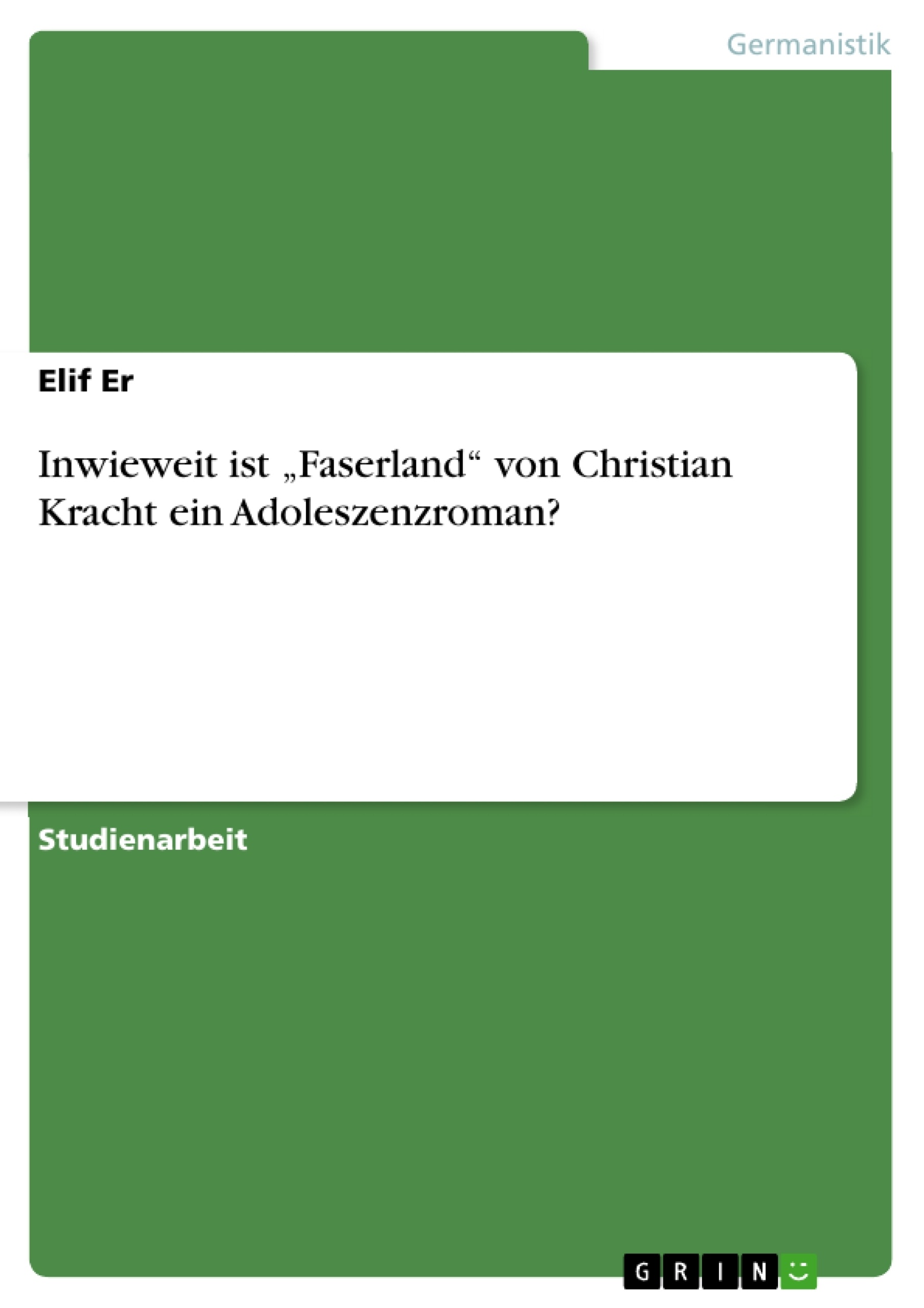In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich mich mit verschiedenen Inhalten beschäftigen, welche im postmodernen Adoleszenzroman aufgegriffen und thematisiert werden. Im Nachfolgendenden möchte ich den Versuch einer Definition des Adoleszenzromans unternehmen und anschließend die Historik und Entstehung dieser Gattung in Deutschland betrachten.
Danach werden wichtige Inhalte, Motive, Themen konkretisiert. Im Anschluss geht es um das Hauptthema meiner Arbeit, den Roman "Faserland" von Christian Kracht aus dem Jahr 1995. Unter der Leitfrage – Inwieweit ist "Faserland" ein Adoleszenzroman? – möchte ich untersuchen, welche der im ersten Teil der Hausarbeit genannten Inhalte und Motive sich in Christan Krachts Debütroman wiederzufinden sind.
Als ein Leitmotiv wird die Reise des Protagonisten und Ich-Erzählers analysiert, die nahezu durchgehend von Drogen, Musik und Marken begleitet wird. Hinzu kommt die durchgehende Identitätskrise des Protagonisten, die im gesamten Roman deutlich wird. Im letzten Teil werde ich in Form eines Fazits die erörterten Aspekte eines typische Adoleszenzromans mit den Analyseergebnissen des gewählten Romans vergleichen und gegenüberstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Adoleszenzroman?
- Historischer Kontext
- Themen und Inhalte
- Motive in „Faserland“
- Reisen des Ich-Erzählers
- Konsum: Partys, Drogen und Marken
- Identitätskrise
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwieweit Christian Krachts Roman „Faserland“ den Kriterien eines Adoleszenzromans entspricht. Dazu werden zunächst zentrale Aspekte der Adoleszenz aus literaturwissenschaftlicher, psychologischer und soziologischer Perspektive beleuchtet, gefolgt von einer Definition des Adoleszenzromans und seiner Genese. Der Fokus liegt dabei auf den typischen Motiven und Inhalten dieser Gattung.
- Begriffsbestimmung des Adoleszenzromans
- Historische Entwicklung des Adoleszenzromans
- Typische Motive und Inhalte des Adoleszenzromans
- Analyse von „Faserland“ im Hinblick auf Adoleszenzthemen
- Zusammenfassende Bewertung der Eignung von „Faserland“ als Adoleszenzroman
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung definiert den Begriff „Adoleszenz“ aus verschiedenen Perspektiven und erläutert die damit verbundenen Herausforderungen. Anschließend wird die Gattung des Adoleszenzromans eingeführt, wobei die Abgrenzung zu verwandten Genres wie dem Bildungsroman und dem Erziehungsroman deutlich wird.
1.1 Was ist ein Adoleszenzroman?
Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Themen und Motive des Adoleszenzromans, die vor allem in der Darstellung der Identitätsfindung und Ablösungsprozesse des jugendlichen Protagonisten liegen. Die Abgrenzung zum Bildungsroman, der eher eine Eingliederung des Protagonisten in die Gesellschaft anstrebt, wird hervorgehoben.
1.2 Historischer Kontext
Der historische Kontext des Adoleszenzromans wird mit frühen Beispielen wie Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und Karl Philipp Moritz' „Anton Reiser“ eröffnet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Gattung vom 18. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert, wobei die Ablösung durch den Bildungsroman und die erneute Bedeutung des Adoleszenzromans im 20. Jahrhundert beschrieben werden.
2. Motive in „Faserland“
Der Roman „Faserland“ wird in diesem Abschnitt mit Blick auf seine zentralen Motive untersucht, wobei die Reise des Ich-Erzählers, die Konsumkultur mit ihren Drogen, Partys und Marken sowie die Identitätskrise des Protagonisten im Vordergrund stehen.
2.1 Reisen des Ich-Erzählers
Das Kapitel analysiert die Reise des Ich-Erzählers in „Faserland“ und die Rolle, die Drogen, Musik und Marken dabei spielen.
2.2 Konsum: Partys, Drogen und Marken
Der Einfluss von Konsum, Partys, Drogen und Marken auf die Entwicklung des Protagonisten wird im Detail betrachtet.
2.3 Identitätskrise
Die Identitätskrise des Protagonisten und ihre Auswirkungen auf sein Verhalten und seine Beziehungen werden in diesem Kapitel beleuchtet.
Schlüsselwörter
Adoleszenz, Adoleszenzroman, Bildungsroman, Identitätskrise, Ablösung, Selbstfindung, Konsum, Drogen, Marken, Reise, Ich-Erzähler, Christian Kracht, Faserland, Postmoderne, Gesellschaft, Kultur.
- Quote paper
- Elif Er (Author), 2021, Inwieweit ist „Faserland“ von Christian Kracht ein Adoleszenzroman?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1294643