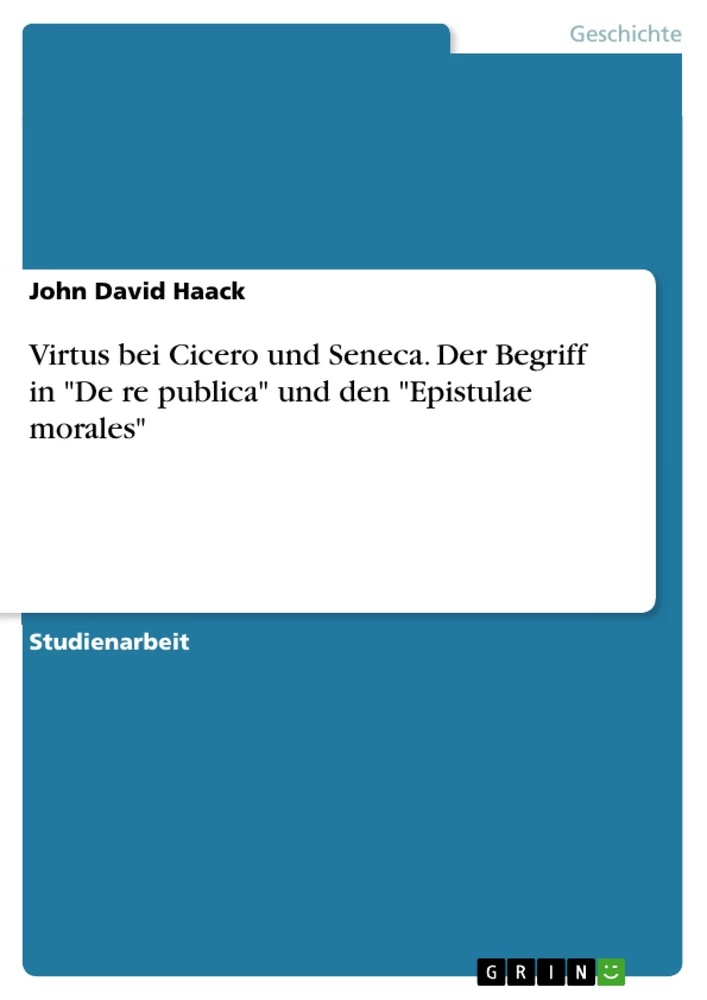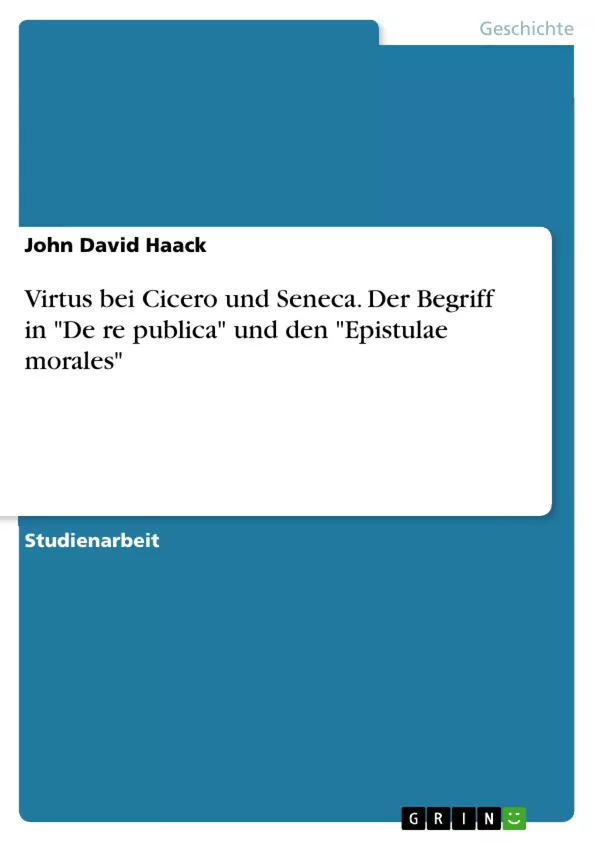Die Zivilisation des 21. Jahrhunderts ist in vielen Aspekten des öffentlichen Lebens geprägt von der Frage nach dem Wert oder der Tüchtigkeit eines Menschen. Auch abseits der anhaltenden Rassismusdebatte profilieren sich Influencer über Social Media, Prominente über soziales bzw. ehrenamtliches Engagement und Politiker über progressive Reformen – ein jeder im Geiste der Präsentation des eigenen vorbildlichen Verhaltens und Schaffens. Dieses Bild des Wertes einer Person aufgrund ihrer Moral und Leistungen war jedoch ein schon immer aufgetretenes Phänomen in einer Gesellschaft. Im Römischen Reich wird dieses äquivalente Leitbild oft als virtus bezeichnet. Und zum Verständnis des römischen Geistes und der Motivation von Taten ist auch das Verständnis der virtus für den Althistoriker unverzichtbar. Der Begriff, der seinen etymologischen Ursprung im "vir" hat, und im Sinne der „Mannhaftigkeit“ wohl zunächst auf dessen Eigenschaft des Mutes abzielte, hat sich im Laufe der Zeit in einen zentralen ethischen und breit gefassten Wert verwandelt, der Interpretationsspielraum ermöglichte.
Deshalb soll in dieser Arbeit ein Ausschnitt dieser breiten Begriffsauslegung untersucht werden: Betrachtet werden die Auffassungen Ciceros, eines Mannes der Republik, und Senecas, eines Mannes des frühen Prinzipats. Im Rahmen der Werksfülle beider Autoren wird sich hier allerdings auf die markanten Schriften "De re publica" und "Epistulae morales" beschränkt, sodass deren verschiedene Ausrichtungen – politisch vs. ethisch – relativ viele Teile der virtus erfassen mögen. Geklärt werden soll dabei, wie der Begriff „virtus“ in den einzelnen Werken aufgegriffen wird, d. h. z. B. was über das Wesen der virtus und ihre Umsetzung geäußert wird, wie sich bestimmte Auffassungen der Verfasser erklären lassen und welche hervorstechenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen bestehen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Ciceros De re publica
2.1 Vorstellung des Autors und des Werkes
2.2 Thematisierung des virtus -Begriffes
3 Senecas Epistulae morales
3.1 Vorstellung des Autors und des Werkes
3.2 Thematisierung des virtus -Begriffes
4 Interpretation und Vergleich
5 Fazit
6 Quellen- und Literaturverzeichnis
6.1 Quellen
6.2 Literatur
6.3 Internetressourcen
1 Einleitung
Die Zivilisation des 21. Jahrhunderts ist in vielen Aspekten des öffentlichen Lebens geprägt von der Frage nach dem Wert oder der Tüchtigkeit eines Menschen. Auch abseits der anhaltenden Rassismusdebatte profilieren sich Influencer über Social Media, Prominente über soziales bzw. ehrenamtliches Engagement und Politiker über progressive Reformen – ein jeder im Geiste der Präsentation des eigenen vorbildlichen Verhaltens und Schaffens. Dieses Bild des Wertes einer Person aufgrund ihrer Moral und Leistungen war jedoch ein schon immer aufgetretenes Phänomen in einer Gesellschaft. Im Römischen Reich wird dieses äquivalente Leitbild oft als virtus bezeichnet. Und zum Verständnis des römischen Geistes und der Motivation von Taten ist auch das Verständnis der virtus für den Althistoriker unverzichtbar. Der Begriff, der seinen etymologischen Ursprung im vir hat, und im Sinne der „Mannhaftigkeit“ wohl zunächst auf dessen Eigenschaft des Mutes abzielte, hätte sich im Laufe der Zeit in einen zentralen ethischen und breit gefassten Wert verwandelt, der Interpretationsspielraum ermöglichte.1
Deshalb soll in dieser Arbeit ein Ausschnitt dieser breiten Begriffsauslegung untersucht werden: Betrachtet werden die Auffassungen Ciceros, eines Mannes der Republik, und Senecas, eines Mannes des frühen Prinzipats. Im Rahmen der Werksfülle beider Autoren wird sich hier allerdings auf die markanten Schriften De re publica und Epistulae morales beschränkt, sodass deren verschiedene Ausrichtungen – politisch vs. ethisch – relativ viele Teile der virtus erfassen mögen. Geklärt werden soll dabei, wie der Begriff „ virtus “ in den einzelnen Werken aufgegriffen wird, d. h. z. B. was über das Wesen der virtus und ihre Umsetzung geäußert wird, wie sich bestimmte Auffassungen der Verfasser erklären lassen und welche hervorstechenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen bestehen.
Neben den offensichtlichen zwei antiken literarischen Hauptquellen, sei jedoch ebenso auf die hier verwendete Forschungsliteratur verwiesen: Für beide Quellen wurde Gebrauch von den Übersetzungen und den Kommentaren aus der Sammlung Tusculum gemacht, welche jeweils einen guten Überblick über die Entstehung und Motivation der Werke geben sowie Tendenzen der Autoren in der Wortwahl bei der Übersetzung aufzeigen. Gerhard Liebers „Virtus bei Cicero“ ist zwar etwas älter, jedoch sehr informations- und umfangreich und liefert ausführliche Erkenntnisse in diesem recht speziellen Feld. Letztlich sei an dieser Stelle Rollers Kapitel „Ethics for the Principate“ aus „Constructing Autocracy“ hervorgehoben, das einen tiefen Einblick in die veränderten moralischen Strukturen der Kaiserzeit bietet und eine Grundlage für die Erklärung der Positionen Senecas liefert. Es sei zusätzlich erwähnt, dass die Literaturauswahl aufgrund der Beschränkungen im Zuge der Corona-Virus-Epidemie verstärkt auf verfügbare Online-Ressourcen beschränkt ist.
Im Hauptteil dieser Arbeit werden im Kontext eines hermeneutischen Vergleichs zunächst De re publica und danach in paralleler Struktur die Epistulae morales betrachtet. Dabei soll jeweils vorab eine Einordnung des Autors und des Werkes erfolgen, bevor es zu einer tiefgreifenderen Analyse der Thematisierung des virtus -Begriffes im Text kommt. Dem wird sich ein näherer Vergleich anschließen, während zugleich versucht wird, einige Hintergründe der vertretenen Ansichten zu beleuchten. Ein abschließendes Fazit möge dann die wesentlichsten Ergebnisse zusammenfassen.
2 Ciceros De re publica
2.1 Vorstellung des Autors und des Werkes
Zunächst gilt es, nähere Informationen rund um den Autor selbst und seine Lebensumstände festzuhalten, damit eine adäquate Einordnung der später folgenden Aussagen des Werkes stattfinden kann. M. Tullius Cicero wurde am 3.1.106 v. Chr. geboren und sah sich zeit seines Lebens mit den Ereignissen der krisengeschüttelten Periode der späten Republik konfrontiert. Äußerst prägend war dabei stets sein politischer Werdegang, der insofern von der Regel abwich, dass es sich bei Cicero um einen homo novus handelte. Als Angehöriger einer gens außerhalb der nobilitas war es ihm v. a. aufgrund seiner bestechenden rhetorischen Fähigkeiten gelungen, den cursus honorum vom Quästor (75 v. Chr.) bis hin zum Konsul (64 v. Chr.) zu durchschreiten.2
Neben seiner aktiven Tätigkeit für den Staat ist Cicero nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen schriftlichen Erzeugnisse für die Geschichtswissenschaft bedeutsam: Bei ihm handele es sich neben Varro um „de[n] einzige[n] Universalschriftsteller der röm. Antike; er verfaßte Reden, Briefe, rhet. und philos. Schriften […] sowie Dichtungen.“3 Sein idealisiertes Bild der traditionellen res publica 4 lässt sich gerade in seinen theoretischen Werken erkennen, von denen eine Großzahl zu Zeitpunkten aufgezwungener politischer Untätigkeit (55 – 51/46 – 44 v Chr.) entstand.5
In diese Werke reiht sich auch die Schrift De re publica ein, die ca. 54 – 52 v. Chr. in sechs Büchern verfasst wurde und das Ideal der römischen Verfassung präsentiert.6 Ciceros Gedanken manifestieren sich in einem fiktiven Gespräch über drei Tage während des Latinerfestes 129 v. Chr. im Scipionenkreis, wobei u. a. die beste Verfassung eines Staates, der Dienst für denselben, die Gerechtigkeit und die rectores rei publicae (Staatslenker) Kernthemen bilden.7 Inhaltlich und strukturell existieren mehrere Parallelen zu Platons Schriften und Ideen, was z. T. sicherlich auf eine ähnliche Entstehungssituation zurückzuführen ist: Unter den Bedingungen der politischen Krise versucht Cicero mit den Gedanken in De re publica den Staat wie Platon die πόλις mit seiner Πολιτεία zu retten.8
2.2 Thematisierung des virtus -Begriffes
Entsprechend des politischen Grundcharakters des Werkes, das hier betrachtet wird, fällt die Erwähnung der virtus durch Cicero stets in einen politischen Kontext. Die virtus war traditionell tief verwurzelt in der römischen Gesellschaft und verkörperte als ein zentraler Wert den „Inbegriff der Leistung und des Wertes des römischen Mannes“9. Von dieser zeitgenössischen Konvention weicht Cicero auch keineswegs ab, er hat es sich offenkundig vielmehr zur Aufgabe gemacht, seine Vorstellungen zur Umsetzung und Bedeutsamkeit der virtus zu formulieren.
Bereits im ersten Buch finden sich mehrere Kerngedanken Ciceros: Zum einen sei, dem Staate nützlich sein, das maximum „ virtutis vel documentum vel officium “.10 Daraus könne direkt abgeleitet werden, dass Cicero im Engagement für den Staat den Zweck des Menschen sehe.11 Darüber hinaus schreibt er: „Neque enim est ulla res, in qua propius ad deorum numen virtus accedat humana, quam civitatis aut condere novas aut conservare iam conditas.”12 Die virtus humana nähere sich dem Walten der Götter also am meisten durch die Gründung neuer bzw. die Bewahrung bestehender Staaten an. Cicero kreiert ein Bild der virtus eines Mannes, in welchem sie direkt von den Leistungen und Verdiensten für die Gemeinschaft abhängig ist.
In dieses Konstrukt wird im Folgenden eine ikonische Figur und ein für die Römer unbestrittenes exemplum virtutis integriert – nämlich Romulus. Statt bekannter militärischer Erfolge und Beweise der Tapferkeit wie der Erlangung der ersten spolia opima werden allerdings seine Verdienste um die civitas gerühmt; konkret die Einrichtung der Auspizien und des Senates als „ egregia duo firmamenta rei publicae “. Romulus‘ „ eximia virtutis gloria“ hätte es außerdem erst möglich gemacht, dass die Menschen sein Verschwinden während einer Sonnenfinsternis als Aufstieg zu den Göttern interpretierten.13 Cicero bedient sich dieses konventionellen Beispiels, um einerseits die Vereinbarkeit seiner Behauptungen zur Natur der virtus mit dem traditionellen Verständnis zu zeigen und andererseits den politischen Aspekt nachhaltig in den Fokus zu rücken. Vom Stadtgründer ausgehend bilde die virtus als „spezifisch römische Exzellenz“ das Fundament der „historischen Größe Roms“.14 Überdies verlange der Staat als ihr Betätigungsfeld nicht nur unbedingten Einsatz für die res publica,15 sondern tilge auch jedes Argument gegen politische Teilhabe.16
Ein weiterer wesentlicher Aspekt seiner Ausführungen ist das Verhältnis von Theorie und Praxis. Das alleinige Besitzen der virtus reiche nämlich nicht aus, wenn sie nicht genutzt würde. Zwar könnten andere Künste trotz fehlender Anwendung durch „ scientia […] ipsa teneri “, aber „ virtus in usu sui tota posita est. “ Insbesondere gelte das Primat der Tat vor dem Wort. Cicero stellt dafür die Gruppen der Gesetzgeber und der Philosophen gegenüber: Letztere hätten nichts von sich gegeben, das nicht von den Gesetzgebern hervorgebracht und bestätigt worden sei.17 Das vermittelte Ideal eines politisch aktiven und handlungsorientierten Bürgers wird somit über das Bild der theorieorientierten Philosophen erhoben, welche noch im gleichen Abschnitt abschätzig als „ isti in angulis “ charakterisiert werden. Ebenso sei die uns naturgegebene „ necessitas virtutis“ sowie das Verlangen, das Gemeinwohl zu schützen, so stark, dass „ ea vis omnia blandimenta voluptatis otique vicerit “.18 Dieser markante Einstieg in den Hauptteil des Werkes proklamiert einen natürlichen Drang zur virtus, wofür M. Porcius Cato als Exempel dient. Anstatt im hohen Alter seine Ruhe im nahegelegenen Tusculum zu suchen, hätte er sich freiwillig weiter in die Wellen und Stürme der Politik gewagt.19
Die Passage richtet sich zugleich gegen die Philosophengemeinschaften, die einen passiven Lebensstil predigen. Im Kontrast zu epikureischen, aber auch sokratischen oder stoischen Lehren genüge es aufgrund der bisherigen Einsichten nicht, zur Erkenntnis über tugendhaftes Verhalten gelangt zu sein, ohne es tatsächlich auszuführen.20 Nichtsdestotrotz werden sie als „ magni homines “ und „ virtutis magistri “ anerkannt, denen lediglich der Praxisbezug fehle. Die Staatsmänner, welche dies jedoch vollbrachten und eine Verbindung der „ ratio civilis et disciplina populorum “ herstellen konnten, hätten gar eine „ incredibilis […] et divina virtus “ hervorgebracht.21
Die Seltenheit der real vorkommenden virtus sei ebenfalls nicht zu unterschätzen: In der Diskussion über die Aristokratie behauptet der fiktive Scipio Africanus minor, dass die virtus nur in Wenigen zu finden sei und nur von Wenigen beurteilt und erkannt werden könne. Dies sei auch der Grund, warum in dieser Staatsform oft die vermeintlich besten Männer gewählt werden. Die wahren optimi viri zeichneten sich nämlich durch ihre virtus aus, wofür viele Bürger nur ein mangelndes Verständnis besäßen.22 Das Volk der Römer stellt sich in seiner eigenen Geschichtsschreibung diesbezüglich ein wohlwollendes Zeugnis aus: „ Nostri illi […] viderunt virtutem et sapientiam regalem, non progeniem, quaeri oportere. “23 So entschieden sie sich, den fremden Numa Pompilius von den Sabinern aufgrund dieser qualifizierenden Eigenschaften zum zweiten König zu erklären.24 Auch L. Brutus als Begründer der Republik bzw. Stürzer des unter Tarquinius Superbus verkommenen Königtums wird als „ vir ingenio et virtute praestans […] [q]ui […] totam rem publicam sustinuit “ glorifiziert.25
Zuletzt gilt es, einen Blick auf die Entlohnung und die Motivation für eine vita virtute zu werfen. Konkret heißt es dazu: Die virtus wolle lediglich die Ehre, irgendeinen anderen Lohn gebe es nicht. Sie erhalte diese leicht, ohne schmerzlich darauf zu drängen.26 Besonders dem Staatsmann, oft rector rei publicae genannt,27 würde auf diesem Wege Ansehen zukommen – ein durchaus wichtiger Wert im öffentlichen Leben der römischen Gesellschaft, was sich u. a. in den traditionellen, prunkvollen Triumphzügen zeigt. Die virtus „wird zum unverlierbaren inneren Besitz gemacht, der keinen äußeren Lohn braucht, sondern tieferen Lohn im inneren Bewußtsein des rechten und wertvollen Handelns findet.“28 Sie ist gewissermaßen also um ihrer selbst willen erstrebenswert.29 Cicero wagt zusätzlich einen Schritt über das irdische Leben hinaus, indem er durch den älteren Scipio Africanus in einem Traum verkünden lässt, dass diejenigen, die die Heimat bewahren, ihr nützlich gewesen seien oder sie vergrößert hätten, einen bestimmten Platz im Himmel bekämen.30 Dies sind die angesprochenen Charakteristika der virtus -Praktizierung. Folglich lassen sich die Ehrungen der großen politischen Figuren, die sich Verdienste um den Staat gemacht hatten, mit der Vergöttlichung nach ihrem Ableben in Verbindung setzen, denn diese stellt die eigentliche Belohnung nach dem irdischen Dasein dar.31 Hier lässt sich wiederum der Bogen zurück zu Romulus als exemplum virtutis spannen, dem dieses Schicksal, wie erwähnt, nachgesagt wurde.
3 Senecas Epistulae morales
3.1 Vorstellung des Autors und des Werkes
Im zweiten Teil wird eine Schrift des stoischen Philosophen L. Annaeus Seneca im Fokus stehen. Seneca selbst wurde um das Jahr 0 geboren und erlebte somit den frühen Prinzipat unter der julisch-claudischen Dynastie im 1. Jh. n. Chr. Er entstammte einer angesehenen Ritterfamilie und war der Spross intellektueller Eltern, welche ihm sicherlich auf diese Weise ihre rhetorisch-philosophischen Tendenzen bereits in die Wiege legten.32 Nach Rom gelangte er zum Zweck seiner Ausbildung33 und verbrachte dort den Großteil seines weiteren Lebens – einschneidend waren jedoch acht Jahre der Verbannung auf Korsika, die ihm merklich zugesetzt hätten.34 Seine Rückkehr Anfang 49 brachte Seneca zugleich eine besondere Stelle als Lehrer des späteren Kaisers Nero ein, auf den er auch während seiner Regentschaft Einfluss ausübte, was folglich eine Periode politischer Aktivität Senecas bedingte. Des Mitwirkens an der gescheiterten pisonischen Verschwörung gegen den Kaiser beschuldigt, wird er 65 schließlich zum Selbstmord gedrängt.35
In seinen letzten Lebensjahren zog sich Seneca von der öffentlichen Bühne zurück und widmete sich verstärkt dem Schreiben: So entstanden 62 – 65 u. a. die 124 Epistulae morales ad Lucilium an einen vermeintlichen Freund, aber indirekt gerichtet an die gebildete Schicht Roms.36 Inhaltlich bemüht sich der Verfasser um die Klärung alltäglicher philosophischer Fragen und versucht, Lucilius die Bedeutung der „moralische[n] Beschaffenheit [des Lebens]“37 nahezubringen. Auch die teils positive Thematisierung von Tod und Sterblichkeit38 in Anbetracht seines absehbaren Ablebens, welches schließlich nach sokratischem Vorbild erfolgen sollte, passt ins Bild.
3.2 Thematisierung des virtus -Begriffes
Im Rahmen dieser Schwerpunktsetzung fällt die virtus in den epistulae in einen philosophisch-moralischen Kontext. Der Brief 92 beschäftigt sich außerordentlich eindringlich mit diesem Thema und soll deshalb im Folgenden besondere Aufmerksamkeit erhalten. Dort beschreibt Seneca die virtus gar als „ prima pars hominis […]; huic committitur inutilis caro et fluida “.39 Offenkundig wird sie auf eine dem leiblichen Körper übergeordnete Position gebracht. Dies steht im Einklang mit der stoischen Betonung des geistigen Charakters der virtus und der zentralen Rolle der ratio 40. Den Gedanken ausführend hält Seneca fest, dass die nochmals gesteigerte „ virtus […] divina “ so auf schlüpfrigen Boden gelange und die höheren und himmlischen Teile des Menschen an ein schwaches Tier gebunden seien.41 D. h. die verinnerlichte und geistige virtus in der Rolle als (idealer) Lenker des irdischen Leibes ist gleichzeitig gekettet an denselben und erfährt sein Laster.
Im weiteren Argumentationsverlauf, in dem Seneca den tugendhaften Weg eines Weisen zum Glück schildert, geht er auf den Einwurf ein, dass ein Weiser mit virtus zwar glücklich sei, ihm der Weg zum „ summum bonum “ ohne natürliche Mittel bzw. Grundgüter wie Gesundheit versperrt bliebe.42 Unter der Prämisse, dass die virtus jemanden vor Unglück bewahren könne, sei es ihr nämlich viel leichter möglich, jemanden sehr glücklich zu machen. Wenn sie es vermag, den Schritt vom Unglück ins Glück zu gewährleisten, sei der wesentlich kleinere verbleibende Schritt zum höchsten Glück ebenso in ihrer Macht.43 Ein Mann, der unter dem schwersten Laster mithilfe der virtus nicht unglücklich sei, könne auch nicht durch die bloße Abwesenheit der genannten Güter vom summum bonum abgehalten werden: „ tam sine commodis beatissimus est, quam non est sub incommodis miser “.44 Diese „ incommoda “ könnten der virtus genauso wenig anhaben, wie die Wolken der Sonne – sie möge zwar weniger für uns strahlen, ihre Kraft sei jedoch ungebrochen.45
Darüber hinaus bezieht Seneca im Verlauf des gesamten Werkes auch das Erkennen und Praktizieren der virtus in seine Erläuterungen ein. In Anlehnung an den vorherigen Absatz und stoische Lehren seien Qualitätsmerkmale einer Person wie Gesundheit, Reichtum etc. zwar der Natur gemäß bevorzugt, für ein glückliches Leben aber nicht hinreichend – der wahre Faktor sei die virtus.46 Liquidität, Vitalität und Luxus sind demnach nur vermeintliche Indikatoren, um ein exemplum virtutis zu erkennen. Es fällt deshalb schwer, sie in einer Person ausfindig zu machen: Man müsse die virtus auch hinter Armut, Demütigung und Schande sehen können wie die Boshaftigkeit und Lethargie einer kummervollen Seele hinter dem falschen Glanz des Reichtums, des Ansehens und der Macht.47
Entsprechend fällt auch die Bewertung großer historischer Persönlichkeiten wie Alexander, Pompeius, Caesar und Marius aus48, die vom Volk für ihre angebliche virtus gepriesen werden: Nicht diese war die Triebkraft ihrer Taten, sondern u. a. „ insanus amor magnitudinis falsae “ und „ gloria et ambitio “.49 Seneca stellt sich klar gegen die traditionelle virtus -Definition und bemüht sich, den Leser durch geschickte rhetorische Fragen von ihrer konventionellen Bedeutung als kriegerischen Heldenmut zum philosophischen Verständnis als mentale Fähigkeit zu lenken.50
Zusätzlich sollte sie nicht unbedingt in Personen gesehen werden, die lediglich aufgrund einzelner, außerordentlich tugendhafter Taten hervorstechen, wie z. B. Fabricius oder Horatius Cocles. Man liefe Gefahr, einer Illusion zu verfallen, falls diese Handlungen nicht der virtus selbst, sondern der „ virtutibus vitia confinia “51 entsprängen. Ggf. seien sie zu dieser mentalen Leistung nicht dauerhaft fähig, wohingegen wahre virtus -Träger ebendiese stets in einem Leben voller Güte, Maß, Geduld und Besonnenheit umzusetzen wüssten.52 Zu Letzterem seien insbesondere weise Männer und Philosophen in der Lage, welche „ virtutem tam in secundis quam in adversis exhibere[nt] […] “.53 Dies erscheint im Kontext plausibel – auf die enge stoische Verbindung von virtus und ratio wurde bereits hingewiesen.
Allerdings lässt sich auch eine gewisse Diskrepanz zwischen der senecanischen Philosophie und dem allgemeinen Stoizismus feststellen: Einerseits entspreche es der stoischen Linie, Zustände wie Freude und Frieden vorzuziehen und solche wie Tapferkeit und Selbstbeherrschung, die „ in materia infelici expressa “54 eher nicht anzustreben. Denn die notwendigen Konfliktsituationen wie Folter oder Krankheit sind mit Schmerzen verbunden und der Seelenruhe somit nicht dienlich. Andererseits widerspricht Seneca diesem Leitfaden, da er zunächst konstatiert: „ Ita non incommoda optabilia sunt, sed virtus qua perferuntur incommoda. “55 Daraus schließt er wiederum, dass die Möglichkeit des virtus -Beweises in jenen Konfliktsituationen genauso anzustreben sei wie die oben genannten Zustände von Freude und Frieden.56 Dabei ginge es nicht um das bloße Aushalten, sondern um das tapfere Ertragen von Schmerzen, welches die virtus verkörpere.57 Gerade dieser praktische virtus -Beweis sei jenem in kommoden Situationen sogar überzuordnen.58 Deshalb geht Seneca soweit, dass er behauptet, diese incommoda wären deswegen erstrebenswert: „ Beatus vero et virtutis exactae […], si alicuius honesti officii pretia sunt, non tantum fert sed amplexatur “.59
Schließlich werden auch in diesem Werk weitere exempla virtutis angeführt – hier seien einerseits Sokrates und Cato minor und andererseits implizit Seneca selbst genannt.60 Nach Lemmens zeigt die durch diese Auswahl bewirkte „Divergenz der Zeit- und Lebensumstände […], dass virtus in allen Epochen, in allen Alltagen vollbracht werden kann.“ Der Kontrast der strahlenden Figuren zum Autor verdeutlicht indes, dass „ virtus nicht nur über catonische Tatkraft oder sokratischen Rationalismus […], sondern auf alltäglichere […] Weise, über die humanitas “ praktiziert werden könne. Virtus könne tatsächlich auf ganz unterschiedliche Weise verwirklicht werden, demnach könne auch die Philosophie viele Wege einschlagen, wenngleich die Orientierung an der virtus außer Frage stünde.61
4 Interpretation und Vergleich
Es lässt sich also feststellen, dass die virtus sowohl bei Cicero als auch bei Seneca zahlreich Erwähnung findet und jeweils einen hohen Stellenwert zugeschrieben bekommt. Jedoch ergeben sich in der Begriffsbestimmung deutliche Unterschiede, die u. a. in den Übersetzungen der Texte durch Rainer Nickel in den Publikationen der Sammlung Tusculum sichtbar werden. In De re publica überträgt er die ciceronische virtus nämlich meist als „höchste Leistung“, „menschliche Leistungsfähigkeit“ oder „Höchstleistung“,62 wohingegen er in den Epistulae morales eher die Bezeichnung „moralische Haltung“63 verwendet. Damit impliziert Nickel die angesprochene Diskrepanz im Grundverständnis des Wortes: Cicero orientiert sich in seiner Schrift noch relativ stark am konventionellen Begriff, nach dem die virtus als Mannhaftigkeit und Leistungsfähigkeit gilt. Analog zu seiner platonischen Steigerung Roms zum Idealstaat erhebe er allerdings auch die virtus, den „entscheidenden Begriff des römischen Lebens und der römischen Geschichte […] zur Stellung der ἀρετή“64, d. h. zum griechischen Äquivalent und dortigen ethisch-philosophischen Ideal. Für Seneca als stoischen Philosophen nimmt sie eine gleichsam wichtige Stellung ein. Hier jedoch, weil die virtus hinreichend für das summum bonum ist, in dem das Glück liege, und sogar mit diesem gleichgesetzt werden könne.65 Deshalb erstrebten sie die Stoiker um ihrer selbst willen und zugleich ermögliche sie die Annäherung an das Göttliche.66
Interessant ist wohl vor allem die sich ähnelnden Entstehungssituationen der betrachteten Werke: Sie sind nämlich dahingehend durchaus vergleichbar, dass beide Schöpfer sie in Zeiten eines politischen Partizipationsvakuums verfassten. In der Phase der Staatskrise am Ende der Republik sei Cicero aufgrund von Gefahr und eigener Machtlosigkeit die Chance auf das traditionelle Ansehen eines rector rei publicae versagt gewesen. Um dies zu kompensieren, suche er diesen Lohn nun jenseits des Irdischen, da sein Engagement in jenem nicht vergütet würde.67 Dieses politische Engagement wiederum ist bekanntlich natürlich und nötig. Ciceros Beiträge während seines Konsulats wie auch der theoretische Beitrag in Form dieser Schrift orientieren sich in ihrem Charakter besonders an dem Leitsatz der Erhaltung und Rettung der res publica. Entsprechend betont wird diese Errungenschaft des „ conservare“ im Kontext der virtus -Umsetzung: Cicero sieht sich selbst als exemplum virtutis und hat keine Scheu, dies in seiner Begriffsauslegung zu implizieren. Seine Definition harmoniert an der gleichen Stelle nebenbei mit der stoischen Auffassung der tendenziellen Vergöttlichung durch die virtus.68
Seneca ging es an seinem Lebensende nicht besser – im Prinzipat herrschte ein hoher Druck auf ihn und andere aktive politische Akteure, jedoch ergaben sich speziell für ihn noch Einbringungsmöglichkeiten. Die Monarchie war jung und als Vertrauter des Kaisers konnte Seneca unter Nero zeitweise bedeutsamen Einfluss ausüben.69 Dieser schwand alsbald und Seneca zog sich zurück70 – er hatte nach wie vor das Bedürfnis, sich zu beteiligen, war jedoch in seinen Möglichkeiten beschränkt. Deshalb neigt er wie Cicero zu einer Verinnerlichung des virtus -Begriffes, was sich damit dem allgemeinen Trend des Individualismus zuordnen lässt, der durch die zunehmende Macht beim Kaiser hervorgerufen wurde.71
Einen starken Kontrast bilden letztlich die Vorstellungen bezüglich der tatsächlichen Umsetzung der virtus. Ciceros Position wird besonders bei der Gegenüberstellung des praktischen Handelns und der theoretischen Fähigkeit zur virtus klar:72 Er stellt sich gegen Philosophen wie Seneca, die die virtus als bloße mentale Disposition sehen. Sein Verständnis steht offensichtlich in einem Kausalitätsverhältnis mit seiner bisherigen Karriere, die wie beschrieben durchaus von praktischen Taten geprägt war. Entsprechend honoriert werden von ihm die Verdienste großer Männer der Republik, wie M. Porcius Cato, die auf ihrer ausgeprägten virtus beruhen.
Ganz anders werden die betreffenden Personen von Seneca reflektiert. Im Prinzipat waren die „traditionally highest and most prestigious [military honors] rapidly monopolized by the emperor himself and by members of the imperial family”73 und somit außer Reichweite für Aristokraten. An diesen erschwerenden Umstand angepasst, nehme er deshalb Abstand vom Gütekriterium der Leistung des militärischen Erfolgs, welche die virtus traditionell verkörpere.74 Bezeichnend dafür ist das gewählte Beispiel Cato minors als exemplum virtutis. Wie auch der von Cicero geschätzte Cato maior ist dieser nämlich ein traditionelles Paradebeispiel der virtus, aber Seneca preist entgegen der Konvention die Momente seiner Niederlagen und Verluste. Diese ermöglichten ihm erst den virtus -Beweis durch das Ertragen und Überkommen der Schmerzen, wobei seine Selbstopferung im Geiste der libertas als Höhepunkt gelte.75 Genauso gelten die beiden Decii, die sich für die Aussicht des Sieges und für das Gemeinwohl in den Schlachten opferten, als Vorbilder der senecanischen virtus.76 Ob diese gewandelte Sichtweise, dass Leid eine Chance für virtus biete, „als symbolischer Bruch mit der neronischen Welt anzusehen [ist], die nun einmal per se aus proegmena besteht“ oder auf das erhöhte, von Nero ausgehende Gefahrenrisiko zurückgeht, kann auch Lemmens nur spekulieren.77
5 Fazit
Resümierend lässt sich also festhalten, dass die virtus in beiden Werken eine wichtige Rolle einnimmt und ihr von den Autoren große Beachtung und Schätzung zuteilwird. Nach Ciceros Vorstellung habe sie einen aktiven Charakter, da sie durch Tat statt Wort praktiziert würde. Ein natürlicher Drang bewege den Menschen zu ihr und finde seinen größten Auswuchs im Dienst für den Staat – allgemeinpolitisch, theoretisch bis militärisch. Demnach stelle sie ferner die Quelle des Aufstiegs und der Glorie Roms dar. Seneca zufolge sei die virtus eher eine mentale Disposition, unabhängig von jeglichen Felderfolgen und Verdiensten. Ihre Umsetzung finde vielmehr auf einer individuellen geistigen Ebene statt, wobei die psychische Überwindung von incommoda eine wichtige Rolle spiele. Virtus gelte als der höchstrangige Teil des Menschen mit Rationalität als Maxime.
Gemeinsam verlautbaren sie, dass die virtus kein Attribut jedermanns ist. Laut Cicero seien genauso wenige zu ihr selbst wie zu ihrer Erkennung fähig. Seneca schreibt konkreter, dass die echte virtus oft von täuschenden Äußerlichkeiten verhüllt sein kann, während strahlende Auren uns die vermeintliche Präsenz der virtus vermuten lassen. Außerdem wird beidseitig die Indirektheit ihres Lohnes festgehalten: Eine Distanz zum Irdischen wird aufgebaut. Einerseits behauptet Cicero, virtus würde im hiesigen Dasein nur mit Ansehen und Ehre allein, im Jenseits jedoch gotteswürdig vergolten. Andererseits liege ihr Wert laut dem anderen Autor v. a. darin, dass sie einem bereits im Diesseits ein Leben in Absenz des Unglücks, d. h. ein Leben im Glück, ermögliche. Trotzdem spricht auch er von einer Annäherung an das Göttliche mithilfe der virtus.
Beide sind natürlich Männer ihrer Zeit – und dies bedingt ihre Motive. Gerade die Verinnerlichung und Verlagerung des Lohnes der virtus aus dem Irdischen heraus resultiert aus dem Verlangen beider Verfasser, sich für das Gemeinwesen zu engagieren. Ihre Umstände hemmten allerdings sowohl Partizipation als auch Honorierung – also trösteten sie sich mit den präsentierten Modellen. Der erfahrene Republikaner Cicero glaubte jedoch noch an das schlagende Herz seines Staates und legt den Fokus auf den politischen Charakter der virtus, wogegen der Philosoph Seneca entsprechend der einschränkenden Rahmenbedingungen des Prinzipats den Weg des Individualismus einschlägt und die geistige Qualität ergründet. Dennoch machen beide Gebrauch von diversen traditionellen exempla virtutis, um einen Bezug zum konventionellen Begriff herzustellen und diese Figuren in ihrer Tugend entweder zu bestätigen oder ihnen diese ggf. abzusprechen.
Obwohl beide Autoren nur wenige Jahrzehnte trennen, ist ein markanter Wandel in ihrem Verständnis der römisch zentralen virtus erkennbar. Teils auf persönliche Einstellungen zurückzuführen kann aber auch die Zeitenwende als Zäsur gesehen werden, die einen wichtigen Faktor darstellt. Der Althistoriker sei letztlich gut beraten, die virtus, an der sich die Römer messen, differenziert nach Bezugsperson und zeitlichem Kontext zu betrachten. So wie dies auch für heutige Ideale gilt.
6 Quellen- und Literaturverzeichnis
6.1 Quellen
Cicero, M. Tullius: De re publica, zitiert nach Cicero, Marcus Tullius: Der Staat. De re publica, hg. und übersetzt von Rainer Nickel (Sammlung Tusculum), Mannheim 2010.
Seneca, L. Annaeus: Ad Lucilium epistulae morales, zitiert nach Seneca, Lucius Annaeus: Epistulae morales ad Lucilium. Briefe an Lucilius, hg. und übersetzt von Gerhard Fink/Rainer Nickel (Sammlung Tusculum), Düsseldorf 2007/2009.
6.2 Literatur
Balmaceda, Catalina: Virtus Romana. Politics and Morality in the Roman Historians, Chapel Hill 2017, online abgerufen unter <www.jstor.org/stable/10.5149/9781469635132_balmaceda; 17.05.2020>.
Cicero, Marcus Tullius: Der Staat. De re publica, hg. und übersetzt von Rainer Nickel (Sammlung Tusculum), Mannheim 2010, online abgerufen unter <doi.org/10.1524/9783050061603; 17.05.2020>.
Evenepoel, Willy: The Stoic Seneca on virtus, gaudium and voluptas, in: L'Antiquité Classique 83 (2014), S. 45–78, online abgerufen unter <www.jstor.org/stable/90004709; 17.05.2020>.
Lemmens, Thomas: Tecum sunt quae fugis. Senecas 104. Brief an Lucilius. Ein Kommentar. Interpretation und Ausblick (Wiener Studien Beiheft, 37), Wien 2015, online abgerufen unter <www.jstor.org/stable/j.ctt1bj4tfs; 17.05.2020>.
Liebers, Gerd: Virtus bei Cicero, Dresden 1942, online abgerufen unter <digital.slub-dresden.de/data/kitodo/LiebVirt_493032142/ LiebVirt_493032142_tif/jpegs/LiebVirt_493032142.pdf; 21.07.2020>.
McDonnell, Myles Anthony: Roman manliness. Virtus and the Roman Republic, New York 2009, online abgerufen unter <epdf.pub/roman-manliness-virtus-and-the-roman-republic.html; 21.07.2020>.
Powell, J. G. F.: Cicero’s De Re Publica and the Virtues of the Statesman, in: Nicgorski, Walter (Hrsg.): Cicero’s Practical Philosophy, Notre Dame (IN) 2012, S. 14–42, online abgerufen unter <www.jstor.org/stable/j.ctvpj74jm; 17.05.2020>.
Roller, Matthew B.: Ethics for the Principate. Seneca, Stoicism, and traditional Roman Morality, in: ders.: Constructing Autocracy. Aristocrats and Emperors in Julio-Claudian Rome, Princeton/Oxford 2001, S. 64–126, online abgerufen unter <www.jstor.org/stable/j.ctt13x0rrk; 17.05.2020>.
Seneca, Lucius Annaeus: Epistulae morales ad Lucilium. Briefe an Lucilius – Band 1, hg. und übersetzt von Gerhard Fink (Sammlung Tusculum), Düsseldorf 2007, online abgerufen unter <doi.org/10.1515/9783050091334.7; 13.07.2020>.
Seneca, Lucius Annaeus: Epistulae morales ad Lucilium. Briefe an Lucilius – Band 2, hg. und übersetzt von Rainer Nickel (Sammlung Tusculum), Düsseldorf 2009, online abgerufen unter <doi.org/10.1515/9783050091358; 13.07.2020>.
6.3 Internetressourcen
Bringmann, Klaus/Leonhardt, Jürgen: Cicero, in: DNP, online abgerufen unter <dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e234410, 28.06.2020>.
Dingel, Joachim: Seneca. L. Annaeus S. Politiker und stoischer Philosoph - 1. Jh., in: DNP, online abgerufen unter <dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1108480#e1108520, 28.06.2020>.
Selbstständigkeitserklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe.
Schwedt, den 27.07.2020.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Vgl. Balmaceda, Virtus Romana, S. 47.
2 Vgl. Bringmann, Cicero, Abschnitt I.
3 Leonhardt, Cicero, Abschnitt II A.
4 Vgl. Bringmann, Cicero, Abschnitt I.
5 Vgl. Leonhardt, Cicero, Abschnitt II A.
6 Vgl. ebd., Abschnitt II D/2.
7 Vgl. Nickel, Der Staat, S. 17.
8 Vgl. Liebers, Virtus bei Cicero, S. 145.
9 ebd., S. 148.
10 Cic. rep. 1, 33.
11 Vgl. Nickel, Der Staat, S. 23.
12 Cic. rep. 1, 12.
13 Vgl. Cic. rep. 2, 17. Dieses Motiv taucht ebenfalls in 1, 25 auf.
14 Nickel, Der Staat, S. 20.
15 Vgl. ebd. S. 23.
16 Vgl. ebd. S. 20.
17 Vgl. Cic. rep. 1, 2.
18 ebd. 1, 1.
19 Vgl. ebd. 1, 1.
20 Vgl. Powell, Cicero’s De Re Publica, S. 18.
21 Cic. rep. 3, 5.
22 Vgl. ebd. 1, 51.
23 ebd. 2, 24.
24 Vgl. ebd. 2, 25.
25 ebd. 2, 46.
26 ebd. 3, 28.
27 Vgl. ebd. z. B. 2, 51 oder 3, 3.
28 Liebers, Virtus bei Cicero, S. 148.
29 Vgl. auch Cic. rep. 6, 25.
30 Vgl. ebd. 6, 13.
31 Vgl. Liebers, Virtus bei Cicero, S. 149.
32 Vgl. Dingel, Seneca, Abschnitt I.
33 Vgl. ebd.
34 Vgl. Fink, Epistulae Morales I, S. 479 f.
35 Vgl. Dingel, Seneca, Abschnitt I.
36 Vgl. Fink, Epistulae Morales I, S. 488 f.
37 Dingel, Seneca, Abschnitt II. B.
38 Vgl. ebd.
39 Sen. epist. 92, 10.
40 Vgl. ebd. 92, 4.
41 Vgl. ebd. 92, 10.
42 Vgl. ebd. 92, 14.
43 Vgl. ebd. 92, 15.
44 ebd. 92, 15.
45 Vgl. ebd. 92, 18.
46 Vgl. Roller, Ethics for the Principate, S. 68.
47 Vgl. Sen. epist. 115, 6–7.
48 Vgl. ebd. 94, 62–66.
49 ebd. 94, 64–65.
50 Vgl. Roller, Ethics for the Principate, S. 89.
51 Sen. epist. 120, 8.
52 Vgl. ebd. 120, 6–7.9–10 und Roller, Ethics for the Principate, S. 92–94.
53 Sen. epist. 85, 39.
54 ebd. 66, 5.
55 ebd. 67, 5.
56 Vgl. Lemmens, Senecas 104. Brief an Lucilius, S. 405.
57 Vgl. Sen. epist. 67, 6.
58 Vgl. ebd. 66, 49–50 und Lemmens, Senecas 104. Brief an Lucilius, S. 406.
59 Sen. epist. 71, 28.
60 Vgl. ebd. 104, 1–5.27–32.
61 Lemmens, Senecas 104. Brief an Lucilius, S. 415 f.
62 Vgl. Cic. rep. 1, 1–2.12.33.51 übersetzt nach Nickel, Der Staat, S. 57, 59, 73, 99, 119, 121.
63 Vgl. Sen. epist. 76, 6.10.16.19; 77, 15; 78, 16.20 übersetzt nach Nickel, Epistulae Morales II, S. 9, 11, 13, 15, 29, 41, 43.
64 Liebers, Virtus bei Cicero, S. 146.
65 Vgl. Evenepoel, Seneca on virtus, gaudium and voluptas, S. 45.
66 Vgl. ebd. S. 56, 73 und Sen. epist. 92, 3.27–30.
67 Vgl. Liebers, Virtus bei Cicero, S. 149.
68 Vgl. Cic. rep. 1, 12.
69 Vgl. Lemmens, Senecas 104. Brief an Lucilius, S. 420.
70 Vgl. Fink, Epistulae Morales I, S. 488.
71 Vgl. Roller, Ethics for the Principate, S. 98.
72 Vgl. Cic. rep. 1, 1.
73 Roller, Ethics for the Principate, S. 99 f.
74 Vgl. ebd. S. 106.
75 Vgl. ebd. S. 104; Sen. epist. 67, 13; 104, 29–30.
76 Vgl. Roller, Ethics for the Principate, S. 103.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht einen Ausschnitt der breiten Begriffsauslegung von "virtus" im Römischen Reich. Sie betrachtet die Auffassungen von Cicero (Republik) und Seneca (früher Prinzipat) in ihren Werken De re publica und Epistulae morales.
Welche Fragestellungen werden in Bezug auf "virtus" untersucht?
Die Arbeit klärt, wie der Begriff "virtus" in den Werken aufgegriffen wird, was über sein Wesen und seine Umsetzung geäußert wird, wie sich bestimmte Auffassungen der Verfasser erklären lassen und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen bestehen.
Welche Quellen und Literatur werden verwendet?
Neben den Hauptquellen (De re publica und Epistulae morales) werden Übersetzungen und Kommentare aus der Sammlung Tusculum, Gerhard Liebers' "Virtus bei Cicero" und Rollers Kapitel "Ethics for the Principate" aus "Constructing Autocracy" verwendet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit vergleicht zunächst De re publica und dann die Epistulae morales in paralleler Struktur. Vorab erfolgt jeweils eine Einordnung des Autors und des Werkes, bevor die Thematisierung des virtus-Begriffes analysiert wird. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Wer war Cicero und was ist De re publica?
M. Tullius Cicero (106 v. Chr. - 43 v. Chr.) war ein römischer Staatsmann und Schriftsteller. De re publica ist eine Schrift, die ca. 54 – 52 v. Chr. verfasst wurde und das Ideal der römischen Verfassung präsentiert.
Wie thematisiert Cicero den Begriff "virtus"?
Cicero erwähnt die "virtus" stets in einem politischen Kontext. Für ihn ist das Engagement für den Staat der Zweck des Menschen. Die "virtus humana" nähert sich dem Walten der Götter am meisten durch die Gründung oder Bewahrung von Staaten an. Er betont das Primat der Tat vor dem Wort und den natürlichen Drang zur "virtus".
Wer war Seneca und was sind die Epistulae morales?
L. Annaeus Seneca (ca. 0 n. Chr. - 65 n. Chr.) war ein stoischer Philosoph. Die Epistulae morales ad Lucilium sind 124 Briefe an Lucilius, die sich mit philosophischen Fragen und der Bedeutung der moralischen Beschaffenheit des Lebens beschäftigen.
Wie thematisiert Seneca den Begriff "virtus"?
Seneca sieht die "virtus" in einem philosophisch-moralischen Kontext. Sie steht über dem leiblichen Körper. Er argumentiert, dass die "virtus" hinreichend für das "summum bonum" (höchste Gut) ist, das mit Glück gleichgesetzt werden kann. Er kritisiert die traditionelle Definition von "virtus" als kriegerischen Heldenmut und betont die mentale Fähigkeit zur Güte.
Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es in der Auffassung von "virtus" bei Cicero und Seneca?
Cicero orientiert sich am konventionellen Begriff von "virtus" als Mannhaftigkeit und Leistungsfähigkeit, während Seneca sie als moralische Haltung und mentale Fähigkeit betrachtet. Beide Autoren schreiben der "virtus" einen hohen Stellenwert zu, betonen jedoch unterschiedliche Aspekte ihrer Umsetzung. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die "virtus" nicht als Attribut jedermanns sehen und die Indirektheit ihres Lohnes betonen.
Warum haben Cicero und Seneca unterschiedliche Vorstellungen von der "virtus"?
Die unterschiedlichen Vorstellungen resultieren aus den jeweiligen politischen Umständen. Cicero lebte in der späten Republik, während Seneca im frühen Prinzipat wirkte. Beide Autoren neigten zu einer Verinnerlichung des "virtus"-Begriffes, aber Cicero fokussierte sich stärker auf den politischen Charakter, während Seneca den Weg des Individualismus einschlug.
- Quote paper
- John David Haack (Author), 2020, Virtus bei Cicero und Seneca. Der Begriff in "De re publica" und den "Epistulae morales", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1294412