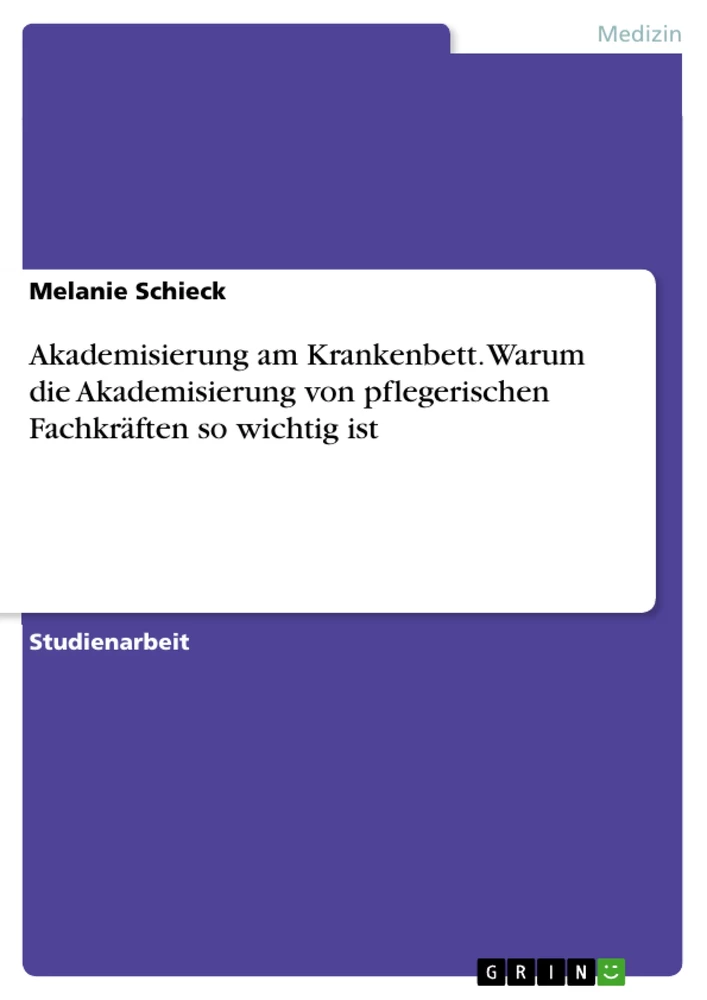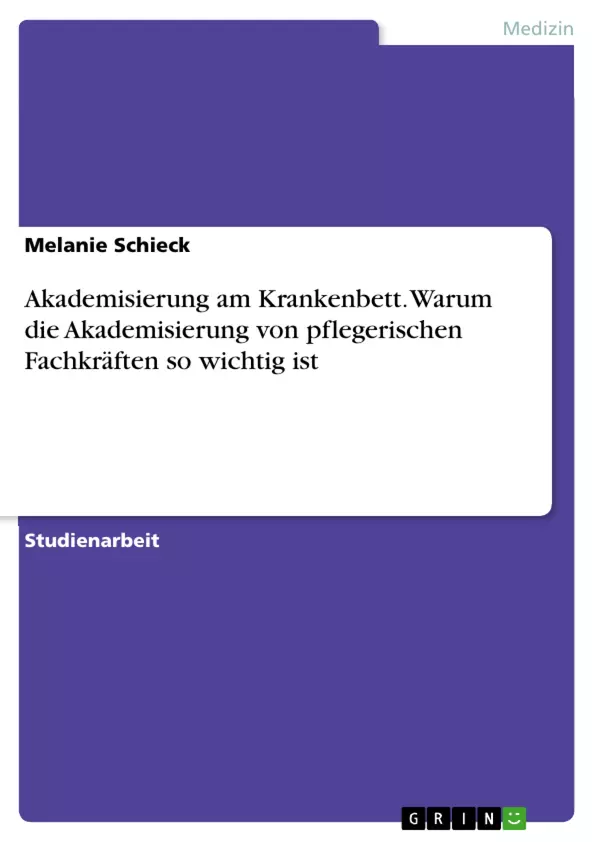Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Notwendigkeit von akademisierten Pflegekräften am Krankenbett. Sie geht der Fragestellung „Warum ist die Akademisierung von Fachkräften im pflegerischen Alltag wichtig?“ nach. Der demografische Wandel und Gesundheitsreformen führen dazu, dass die Pflege alter und multimorbider Menschen immer komplexer und herausfordernder wird. Immer mehr Pflegekräfte, die sich akademisch aus- oder weiterbilden, wechseln nach dem Abschluss aber in Berufsfelder, die vom Krankenbett wegführen. Partiell sind Studiengänge auch genau darauf ausgelegt. Dabei sind akademisierte pflegerische Fachkräfte, welche im stationären und ambulanten Alltag - also am Krankenbett selber - professionell handeln, unabdingbar, um die Versorgungsqualität in hochkomplexen Pflegesituationen sicherzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemhintergrund
- Der demografische Wandel
- Abwanderung der akademisierten Pflegeexperten aus der Pflege
- Gründe für die Akademisierung von in der Pflege tätigen Fachkräften
- Sicherstellung und Verbesserung einer hohen Versorgungsqualität
- Anpassung an ein verändertes pflegerisches Leistungsprofils durch Gesetzesänderungen und Gesundheitsreformen
- Steigerung der Attraktivität des Berufssfeldes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung akademisierter Pflegekräfte im direkten Patientenkontakt. Sie analysiert die Gründe, warum die Akademisierung von Fachkräften im pflegerischen Alltag essenziell ist, insbesondere angesichts des demografischen Wandels und komplexer Pflegebedürfnisse.
- Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Pflege
- Die Abwanderung akademisierter Pflegekräfte aus dem direkten Patientenkontakt
- Die Notwendigkeit akademischer Qualifikationen zur Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität
- Die Anpassung des pflegerischen Leistungsprofils an Gesetzesänderungen und Gesundheitsreformen
- Die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes durch Akademisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemhintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den demografischen Wandel und die damit einhergehende Zunahme von älteren und multimorbiden Patienten, was die Pflege komplexer macht. Darüber hinaus wird die Abwanderung akademisierter Pflegekräfte aus dem direkten Patientenkontakt diskutiert.
- Gründe für die Akademisierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Akademisierung für die Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität in komplexen Pflegesituationen. Es beleuchtet zudem die Anpassung des pflegerischen Leistungsprofils an neue Gesetze und Reformen sowie die Steigerung der Attraktivität des Berufes durch Akademisierung.
Schlüsselwörter
Akademisierung, Pflege, Krankenbett, Versorgungsqualität, demografischer Wandel, Gesundheitsreformen, Berufsattraktivität, Fachkräfte, Pflegeexperten, Leistungsprofil.
- Quote paper
- Melanie Schieck (Author), 2018, Akademisierung am Krankenbett. Warum die Akademisierung von pflegerischen Fachkräften so wichtig ist, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1292472