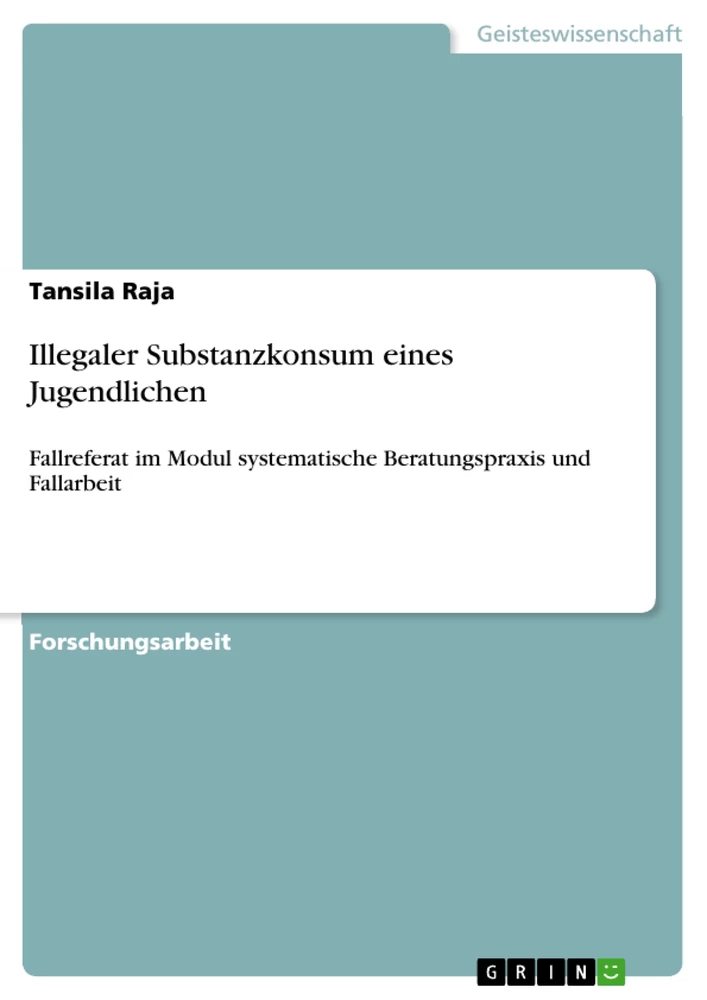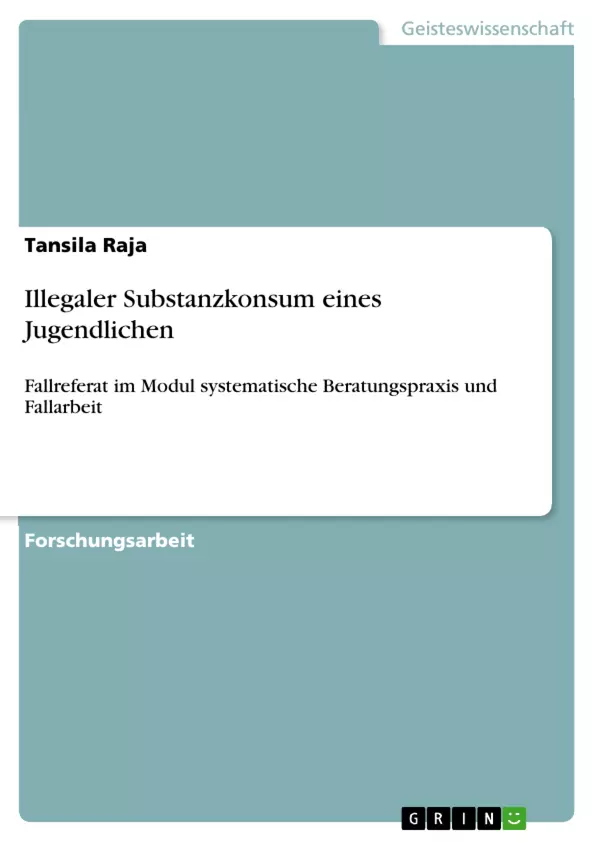Diese Ausarbeitung soll eine Bearbeitung einer Problemdarstellung und einer krisenorientierten Auswertung im Bereich der systemischen Beratungspraxis von Einzelnen mit dem Fallbeispiel ,,Max‘‘ veranschaulichen.
Der Fall des Klienten soll unter dem multiperspektivischen Fallverstehen nach Müller zunächst gegliedert werden. Unter ,,Fall von‘‘, ,,Fall für‘‘ und ,,Fall mit‘‘ ordnen sich die folgenden Techniken und Methoden ein.
Um die Methodenvielfalt zu verdeutlichen, wurden neben der bekannten Ressourcenkarte, auch die Netzwerkkarte, sowie das Genogramm Fallbezogen visualisiert. Als neue Methode wird das ,,innere Team‘‘, wie auch die ,,Selbstregulation‘‘ im Anschluss thematisiert.
Während eines Beratungsgespräches kommen unteranderem Fragetechniken zum Einsatz. Darunter zählen zirkuläre, Skalierungs-, wie auch hypothetische Fragen, die den Beratungsprozess unterstützen.
Ein Kernthema meines Klienten ist die aktuelle Krise, in der er sich befindet, weshalb der Umgang mit genau dieser, in dieser Ausarbeitung ebenso einen Platz findet und durch das Stufenmodell nach Erikson eine mögliche Erklärung parallel versucht zu finden.
Eine Selbstreflexion der Beratung, sowie die Anwendung der Techniken und das Innenleben der Beraterin beenden die Ausarbeitung.
Um die Anonymität des Klienten zu wahren, sind sämtliche persönliche Daten verändert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemlage
- 3. Multiperspektivisches Fallverstehen
- 3.1 Fall von (Auftragsklärung)
- 3.2 Fall für (Jetz-Bild / Ziel-Bild)
- 3.3 Fall mit (MODELL S.E.L.B.S.T.)
- 4. Methodisches Handeln
- 4.1 Genogramm
- 4.2 Inneres Team
- 5. Fragetechniken
- 5.1 Zirkuläres Fragen
- 5.2 Skalierungsfragen
- 5.3 Hypothetische Fragen
- 6. Umgang mit Krisen
- 6.1 Einordnung in das Stufenmodell nach Erikson
- 7. Evaluation
- 8. Selbstreflexion
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert den Fall „Max“ im Rahmen systemischer Beratungspraxis und Fallarbeit. Ziel ist es, die Problemlage des Klienten zu beschreiben, das multiperspektivische Fallverstehen anzuwenden und die eingesetzten Methoden und Techniken zu erläutern. Der Umgang mit der Krise und die Selbstreflexion der Beraterin werden ebenfalls beleuchtet.
- Systemische Beratungspraxis im Kontext eines Fallbeispiels
- Multiperspektivisches Fallverstehen nach Müller
- Anwendung verschiedener Methoden (Genogramm, Inneres Team, Fragetechniken)
- Krisenintervention und deren Einordnung in das Stufenmodell nach Erikson
- Selbstreflexion der Beraterin
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Zweck der Arbeit: die systemische Beratungspraxis anhand des Fallbeispiels „Max“ zu veranschaulichen. Sie gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit, die den Fall unter verschiedenen Aspekten (Auftragsklärung, Ressourcenkarte, Genogramm, Inneres Team, Selbstregulation, Fragetechniken, Krisenintervention) beleuchtet. Die Anonymisierung der Daten wird betont.
2. Problemlage: Dieses Kapitel schildert die Ausgangssituation des 15-jährigen Max, der seit Februar 2021 in Beratung ist. Der tägliche Cannabiskonsum, die angespannte familiäre Situation und das Gefühl, das „schwarze Schaf“ zu sein, werden als zentrale Probleme dargestellt. Eine anfängliche Verbesserung der Situation wird durch einen kritischen Vorfall mit Drogen und Gewalt konterkariert, der zu einer Eskalation und der Notwendigkeit einer stationären Rehabilitation führt.
3. Multiperspektivisches Fallverstehen: Dieses Kapitel erläutert das multiperspektivische Fallverstehen nach Müller, gegliedert in Anamnese, Diagnose, Intervention und Evaluation. Es werden die drei Perspektiven „Fall von“ (Auftragsklärung, Problemdefinition), „Fall für“ (Institutionen, notwendige Unterstützung) und „Fall mit“ (gemeinsames Handeln, Lösungsfindung) detailliert beschrieben. Die Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3 beleuchten diese Perspektiven im Kontext des Falls Max.
4. Methodisches Handeln: Dieses Kapitel beschreibt die angewandten Methoden, insbesondere das Genogramm zur Visualisierung der familiären Beziehungen und das Konzept des „Inneren Teams“ zur Darstellung innerer Konflikte. Die Visualisierung der Netzwerkkarte wird als weitere Methode erwähnt. Die Kapitel 4.1 und 4.2 vertiefen die jeweiligen Methoden im Kontext des Fallbeispiels.
5. Fragetechniken: Der Fokus liegt auf der Anwendung zirkulärer, Skalierungs- und hypothetischer Fragen im Beratungsprozess. Es wird herausgestellt, wie diese Fragetechniken den Beratungsprozess unterstützen und zum besseren Verständnis der Situation beitragen. Die einzelnen Unterkapitel 5.1, 5.2, und 5.3 analysieren die jeweiligen Fragetechniken.
6. Umgang mit Krisen: Dieses Kapitel behandelt die aktuelle Krise von Max und versucht, sie anhand des Stufenmodells nach Erikson zu erklären. Es wird die Bedeutung des Umgangs mit Krisen im Beratungskontext hervorgehoben. Kapitel 6.1 vertieft die Einordnung in das Stufenmodell.
Schlüsselwörter
Systemische Beratung, Fallarbeit, Multiperspektivisches Fallverstehen, Krisenintervention, Genogramm, Inneres Team, Fragetechniken (zirkulär, skalierend, hypothetisch), Stufenmodell nach Erikson, Selbstreflexion, Cannabiskonsum, Familienkonflikte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur systemischen Fallarbeit "Max"
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Diese Ausarbeitung analysiert den Fall „Max“, einen 15-jährigen Jugendlichen mit Cannabiskonsum und familiären Problemen, im Rahmen systemischer Beratungspraxis. Es wird ein multiperspektivisches Fallverstehen angewendet und die eingesetzten Methoden und Techniken detailliert erläutert.
Welche Ziele verfolgt die Ausarbeitung?
Ziel ist die Beschreibung der Problemlage von Max, die Anwendung des multiperspektivischen Fallverständnisses nach Müller und die Erläuterung der verwendeten Methoden (Genogramm, Inneres Team, verschiedene Fragetechniken). Der Umgang mit der Krise und die Selbstreflexion der Beraterin werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt systemische Beratungspraxis anhand eines Fallbeispiels, multiperspektivisches Fallverstehen nach Müller, die Anwendung verschiedener Methoden (Genogramm, Inneres Team, Fragetechniken), Krisenintervention und deren Einordnung in das Stufenmodell nach Erikson sowie die Selbstreflexion der Beraterin.
Welche Methoden werden im Fall „Max“ angewendet?
Es werden das Genogramm zur Visualisierung der familiären Beziehungen, das Konzept des „Inneren Teams“ zur Darstellung innerer Konflikte und verschiedene Fragetechniken (zirkuläre, Skalierungs- und hypothetische Fragen) angewendet. Eine Netzwerkkarte wird ebenfalls erwähnt.
Wie wird das multiperspektivische Fallverstehen angewendet?
Das multiperspektivische Fallverstehen nach Müller wird anhand der drei Perspektiven „Fall von“ (Auftragsklärung, Problemdefinition), „Fall für“ (Institutionen, notwendige Unterstützung) und „Fall mit“ (gemeinsames Handeln, Lösungsfindung) im Kontext des Falls Max detailliert beschrieben.
Wie wird mit der Krise von Max umgegangen?
Die aktuelle Krise von Max wird anhand des Stufenmodells nach Erikson erklärt. Die Bedeutung des Umgangs mit Krisen im Beratungskontext wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Ausarbeitung?
Systemische Beratung, Fallarbeit, Multiperspektivisches Fallverstehen, Krisenintervention, Genogramm, Inneres Team, Fragetechniken (zirkulär, skalierend, hypothetisch), Stufenmodell nach Erikson, Selbstreflexion, Cannabiskonsum, Familienkonflikte.
Welche Kapitel umfasst die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung umfasst Kapitel zur Einleitung, Problemlage, dem multiperspektivischen Fallverstehen, methodischem Handeln (mit Genogramm und Innerem Team), Fragetechniken, Umgang mit Krisen, Evaluation, Selbstreflexion und Fazit.
Wie wird die Problemlage von Max beschrieben?
Die Problemlage von Max umfasst seinen täglichen Cannabiskonsum, eine angespannte familiäre Situation und das Gefühl, das „schwarze Schaf“ zu sein. Ein kritischer Vorfall mit Drogen und Gewalt führte zu einer Eskalation und der Notwendigkeit einer stationären Rehabilitation.
Welche Bedeutung hat die Selbstreflexion der Beraterin?
Die Selbstreflexion der Beraterin ist ein wichtiger Bestandteil der Ausarbeitung und beleuchtet die eigenen Erfahrungen und Perspektiven im Beratungsprozess.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Soziale Arbeit Tansila Raja (Author), 2022, Illegaler Substanzkonsum eines Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1292105