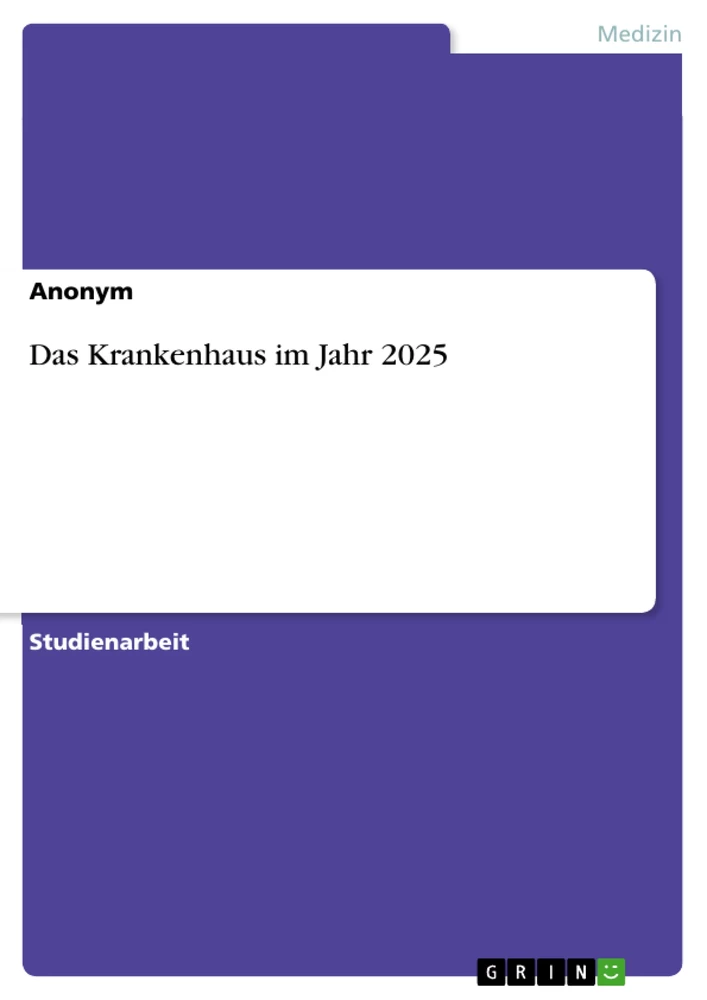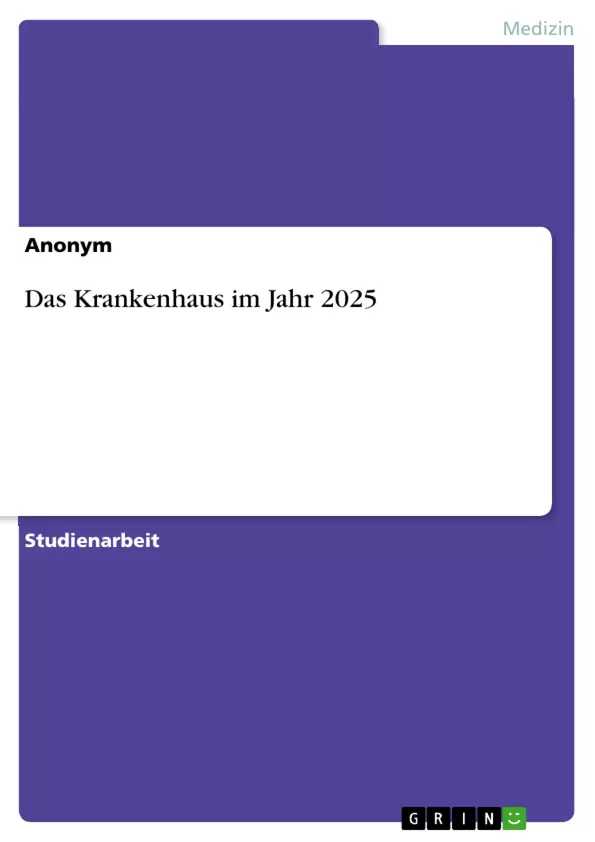Welche eHealth-Anwendungen sind aufgrund der sich verändernden Bedingungen im Gesundheitswesen, speziell im Krankenhaus im Jahr 2025 flächendeckend denkbar?
Diese Ausarbeitung thematisiert Arbeitsprozesse in einem Krankenhaus im Jahr 2025. Es werden dabei konkret denkbare eHealth-Anwendungen in den Prozessen abgebildet. Damit sollen zukunftsorientierte Abläufe, vor allem durch Zuhilfenahme von technischen Geräten und auch softwarebasierten Anwendungen, dargestellt werden.
Die Hausarbeit unterteilt sich zu Beginn in zukünftige Bedingungen und Veränderungen der Krankenhauslandschaft und die daraus abzuleitenden Potenziale für eHealth-Anwendungen. Konkret werden darin die Kostensteigerung, die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser, der demografische Wandel, die technische Entwicklung und der Fachkräftemangel beschrieben.
Anschließend werden das Krankenhausinformationssystem und die Infrastrukturen, vor allem in Hinblick auf WLAN und elektronische Patientenakte, erläutert. Danach folgen weitere denkbare eHealth-Anwendungen speziell im Krankenhaus im Jahr 2025, insbesondere mobile Geräte (vor allem Tablets), Spracherkennung, Smartwatch, Smart Glasses, elektronische Patientenakte, Digitalarchiv für patientenrelevante und klinikübergreifende Informationen.
Abschließend wird ein Ablauf einer Frühschicht im Klinikalltag 2025 aufgezeigt, worin heutige und zukünftige Unterschiede verdeutlicht werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Veränderungen und Problematiken der zukünftigen Krankenhauslandschaft
- Demografischer Wandel
- Gesundheitsausgaben und wirtschaftliche Lage im Krankenhaussektor
- Fachkräftemangel und Patientenansprüche
- Bedeutung des Krankenhausinformationssystems
- Dokumentenmanagement-System "Pegasos Medical Information Broker"
- Das Krankenhausinformationssystem der Zukunft
- Infrastruktur der Informationstechnologien im Krankenhaus
- Die elektronische Patientenakte als Grundlage für das papierlose Krankenhaus
- WLAN als Teil der Infrastruktur im Krankenhaus
- Weitere eHealth-Anwendungen im Krankenhaus der Zukunft
- Spracherkennung im Krankenhaus
- Mobile Geräte
- Tablets im Krankenhaus
- Bring your own Device
- Hygienische Aspekte der Tablets
- Smart Glasses
- Smartwatch
- Klinikalltag am Beispiel einer Frühschicht im Jahr 2025
- Diskussion und Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit den Arbeitsprozessen in einem Krankenhaus im Jahr 2025 und beleuchtet dabei die Einsatzmöglichkeiten von eHealth-Anwendungen. Das Ziel ist es, zukunftsorientierte Abläufe mithilfe technischer Geräte und softwarebasierter Anwendungen aufzuzeigen. Die zentrale Frage lautet: „Welche eHealth-Anwendungen sind aufgrund der sich verändernden Bedingungen im Gesundheitswesen speziell im Krankenhaus im Jahr 2025 flächendeckend denkbar?“.
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels und die damit verbundenen Herausforderungen für das Krankenhauswesen.
- Die Bedeutung der Kostenentwicklung und der wirtschaftlichen Lage im Krankenhaussektor für die Einführung von eHealth-Anwendungen.
- Die Rolle des Krankenhausinformationssystems und der Infrastruktur, insbesondere der elektronischen Patientenakte und WLAN, für die Digitalisierung des Klinikalltags.
- Die Potenziale und Herausforderungen verschiedener eHealth-Anwendungen, wie mobile Geräte, Spracherkennung, Smart Glasses und Smartwatch, im Krankenhaus der Zukunft.
- Die Darstellung des Klinikalltags im Jahr 2025 am Beispiel einer Frühschicht, um die praktische Anwendung von eHealth-Anwendungen zu veranschaulichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der eHealth-Anwendungen im Krankenhaus des Jahres 2025 ein und skizziert die zentralen Fragestellungen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Veränderungen und Problematiken der zukünftigen Krankenhauslandschaft, die durch den demografischen Wandel, die steigenden Gesundheitsausgaben und den Fachkräftemangel geprägt sind. Im dritten Kapitel wird die Bedeutung des Krankenhausinformationssystems, insbesondere des Dokumentenmanagement-Systems "Pegasos Medical Information Broker" und des zukünftigen Krankenhausinformationssystems, für die Optimierung von Abläufen und die Verbesserung der Kommunikation beleuchtet. Das vierte Kapitel behandelt die Infrastruktur der Informationstechnologien im Krankenhaus, wobei die elektronische Patientenakte als Grundlage für das papierlose Krankenhaus und die Bedeutung von WLAN als Teil der Infrastruktur im Fokus stehen.
Im fünften Kapitel werden weitere eHealth-Anwendungen im Krankenhaus der Zukunft vorgestellt, wie Spracherkennung, mobile Geräte (Tablets, Bring your own Device), Smart Glasses und Smartwatch. Dabei werden die Vorteile und Herausforderungen dieser Anwendungen für den Klinikalltag diskutiert. Das sechste Kapitel veranschaulicht den Klinikalltag am Beispiel einer Frühschicht im Jahr 2025, um die praktische Anwendung der beschriebenen eHealth-Anwendungen zu demonstrieren.
Schlüsselwörter
eHealth, Krankenhaus, 2025, Krankenhausinformationssystem, elektronische Patientenakte, WLAN, mobile Geräte, Tablets, Smart Glasses, Smartwatch, Spracherkennung, demografischer Wandel, Gesundheitsausgaben, Fachkräftemangel, Klinikalltag.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Das Krankenhaus im Jahr 2025, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1291802