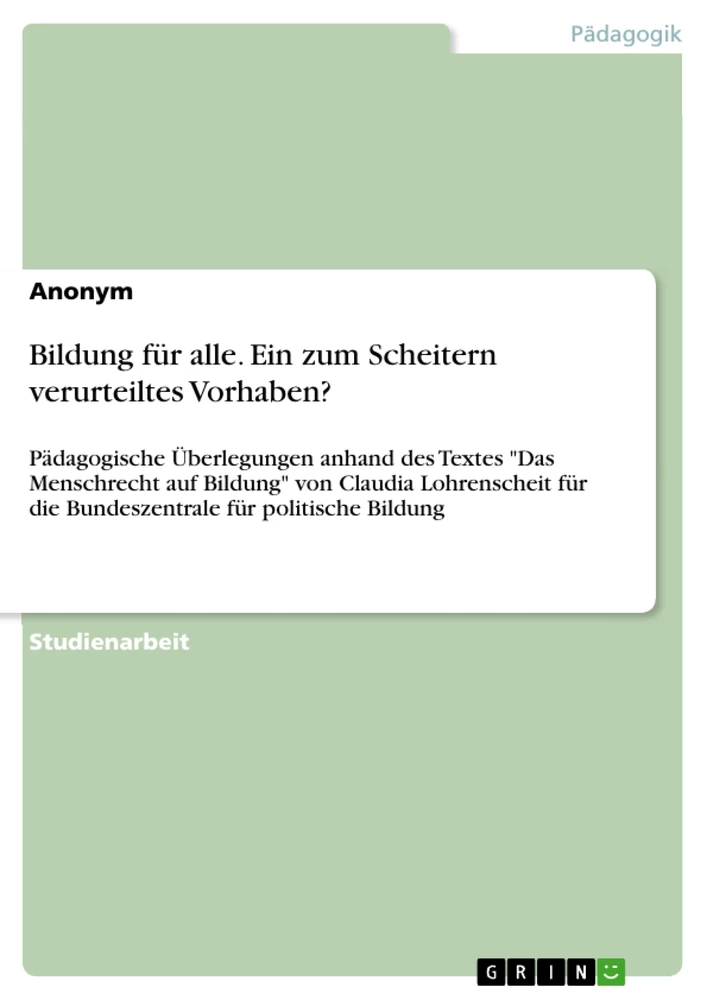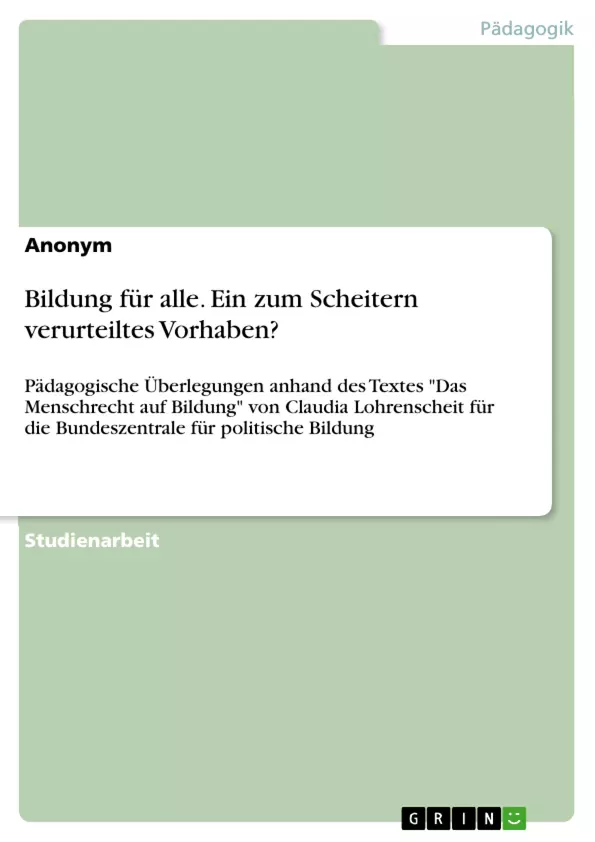Pädagogik beschäftigt sich mit vielen verschiedenen Teilaspekten der Gesellschaft, unter anderem mit Bildung, Erziehung oder sozialer Ungleichheit. In dieser schriftlichen Ausarbeitung wird insbesondere auf die Teilthemen Bildung und soziale Ungleichheit eingegangen. Dies geschieht anhand des Textes "Das Menschrecht auf Bildung" von Claudia Lohrenscheit für die Bundeszentrale für politische Bildung und der Leitfrage "Bildung für alle – Ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben?".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalte des Textes von C. Lohrenscheit
- Der Bildungsbegriff
- Persönliche Stellungnahme
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das Thema „Bildung für alle – Ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben?“. Sie analysiert den Text „Das Menschrecht auf Bildung“ von Claudia Lohrenscheit und diskutiert die Herausforderungen der Bildungsgerechtigkeit im Kontext sozialer Ungleichheit.
- Das Menschenrecht auf Bildung
- Barrieren und Herausforderungen bei der Umsetzung des Bildungsrechtes
- Soziale Selektivität im deutschen Bildungssystem
- Inklusion und Exklusion im Bildungskontext
- Finanzielle und gesellschaftliche Determinanten von Bildungserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und definiert die zentrale Fragestellung: „Bildung für alle – Ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben?“. Sie beleuchtet die Bedeutung des Bildungskonzeptes im Kontext gesellschaftlicher Prozesse und erklärt die Bedeutung der Themen Bildung und soziale Ungleichheit.
Inhalte des Textes von C. Lohrenscheit
Dieser Abschnitt fasst die zentralen Inhalte des Textes „Das Menschrecht auf Bildung“ von Claudia Lohrenscheit zusammen. Er erläutert das Menschenrecht auf Bildung, die rechtlichen Forderungen in Bezug auf Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Angemessenheit und Adaptierbarkeit, sowie die sechs Bildungsziele, die im Jahr 2000 von 164 Staaten formuliert wurden. Der Abschnitt beleuchtet auch die Barrieren bei der Umsetzung des Bildungsrechtes, wie zum Beispiel Hunger, Kriege, gesellschaftliche Standards, Mangel an Lehrkräften und Alphabetisierungsprobleme.
Der Bildungsbegriff
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Definition des Bildungsbegriffes und analysiert verschiedene Facetten der Bildung im Kontext sozialer Ungleichheit. Er untersucht, wie Bildung mit sozialen Strukturen und Machtverhältnissen verwoben ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Bildung für alle. Ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1291511