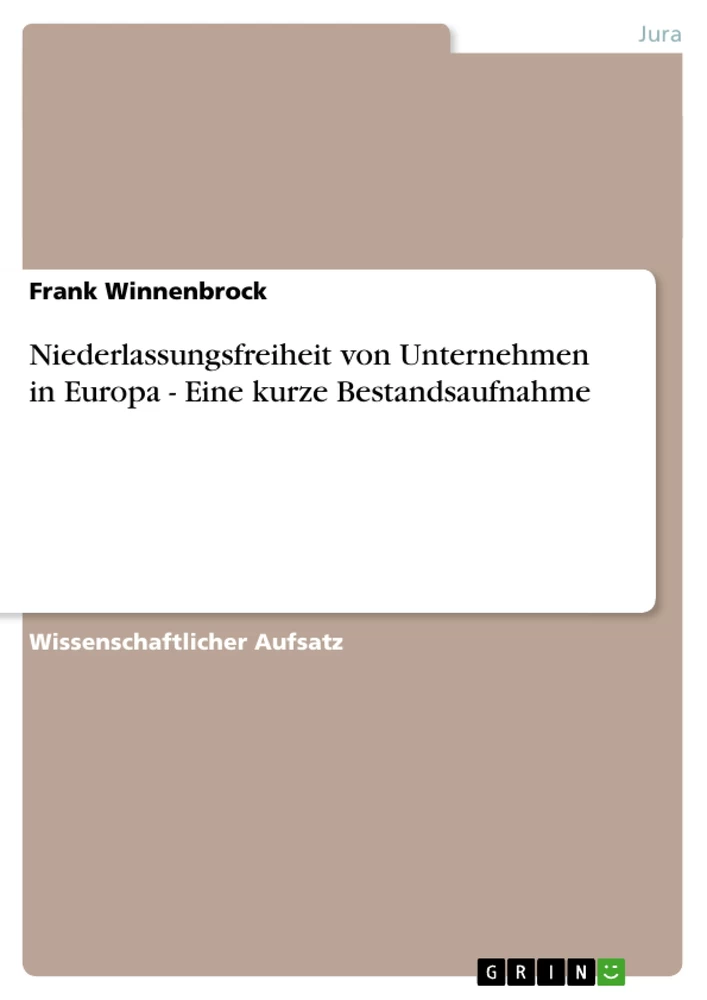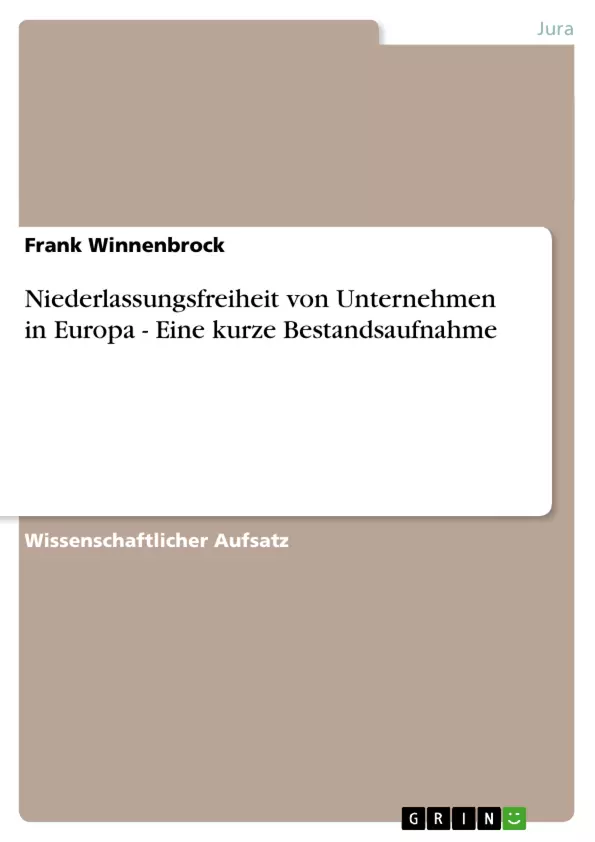In der Rechtsprechung des EuGH, der als erklärter Wächter über die Grundfreiheiten auch bezüglich der direkten Steuern Druck ausübt in Richtung einer stärkeren Harmonisierung oder zumindest Koordinierung der Unternehmensbesteuerung in Europa, zeigt sich eine gewisse Kompensation der fehlenden Gemeinschaftskompetenz auf dem Gebiet der direkten Steuern. Ohne den Gerichtshof würde jeglicher Druck auf die Mitgliedstaaten entfallen, sich europarechtskonform zu verhalten. Seit dem Ergehen der Entscheidung zur Rechtssache Avoir Fiscal im Jahre 1986, die als Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ausgemacht werden kann, hat sich die steuerpolitische Landschaft in Europa wesentlich verändert. Da das Steueraufkommen zu den Lebensgrundlagen eines demokratisch verfassten Staates zählt, ist die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur (weiteren) Angleichung ihrer Steuersysteme und Steuersätze gering. Vor dem Hintergrund, dass sich der den Mitgliedstaaten seitens der Rechtsprechung des EuGH rechtlich zugestandene Gestaltungsspielraum auf dem Gebiet der direkten Steuern durch den Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten faktisch auf Null reduziert hat, erscheint der zu konstatierende Widerstand der Mitgliedstaaten gegen eine weitere Steuerharmonisierung indessen als Kampf gegen Windmühlen.
Niederlassungsfreiheit von Unternehmen in Europa - Eine kurze Bestandsaufnahme
Haan, 20.2.09
Frank Winnenbrock, MBL-HSG
In Rechtsprechung des EuGH, der als erklärter Wächter über die Grundfreiheiten bezüglich der direkten Steuern Druck ausübt in Richtung einer stärkeren Harmonisierung oder zumindest Koordinierung der Unternehmensbesteuerung in Europa, manifestiert sich eine gewisse Kompensation der fehlenden Gemeinschaftskompetenz auf dem Gebiet der direkten Steuern.[1] Ohne den Gerichtshof würde jeglicher Druck auf die Mitgliedstaaten entfallen, sich europarechtskonform zu verhalten.[2] Seit dem Ergehen der Entscheidung zur Rechtssache Avoir Fiscal im Jahre 1986, die als Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ausgemacht werden kann, hat sich die steuerpolitische Landschaft in Europa wesentlich verändert. Da das Steueraufkommen zu den Lebensgrundlagen eines demokratisch verfassten Staates zählt, ist die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur (weiteren) Angleichung ihrer Steuersysteme und Steuersätze gering. Vor dem Hintergrund, dass sich der den Mitgliedstaaten seitens der Rechtsprechung des EuGH rechtlich zugestandene Gestaltungsspielraum auf dem Gebiet der direkten Steuern durch den Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten faktisch auf Null reduziert hat, erscheint der zu konstatierende Widerstand der Mitgliedstaaten gegen eine weitere Steuerharmonisierung indessen als Kampf gegen Windmühlen. Im Sinne eines Europäischen Steuerparadoxons muss konstatiert werden, dass die Mitgliedstaaten ihre Steuerhoheiten unter dem Druck der Märkte wohl nur durch ein gemeinsames Regelwerk sichern können.[3]
Der sich verstärkende Konflikt über eine der tatsächlichen Wertschöpfung entsprechenden Aufteilung des Besteuerungsaufkommens sollte von den Mitgliedstaaten zum Anlass genommen werden, ihre Anstrengungen zur Verwirklichung eines Reformkonzeptes zu verstärken, das den Wertschöpfenden grenzüberschreitend eine optimale Allokation ihrer betrieblichen Ressourcen und Produktionsfaktoren ermöglicht. Die in der Euro-Zone operierenden Unternehmen müssen ihre betrieblichen Ressourcen und Produktionsfaktoren dort allokalisieren können, wo sie von steuerlichen Erwägungen unbeeinflusst die vergleichsweise größte Bruttorendite erzielen können. Im Interesse der Verwirklichung eines einheitlichen und ohne zwischenstaatliche Barrieren bestehenden EU-Wirtschaftsraums erscheint es als sachfremd, die Niederlassungsfreiheit lediglich auf die Zuzugsfreiheit zu reduzieren.[4] Die Zuzugsfreiheit und die Wegzugsfreiheit sind die zwei Seiten der einheitlichen Medaille „Niederlassungsfreiheit”.[5] Anderweitig stünde es im Ermessen eines jeden Staates, den Wegzug der eigenen Gesellschaften zu beschränken.[6]
[...]
[1] Vgl. Fuest, Steuerharmonisierung, 2006, S. 6.
[2] Vgl. Hey, StuW 2004, S. 193, 198.
[3] Vgl. Jacobs, Unternehmensbesteuerung, 2007, S. 270.
[4] Vgl. Campos Nave, BB 2008, S. 1410, 1413.
[5] Vgl. Campos Nave, BB 2008, S. 1410, 1413.
Häufig gestellte Fragen zu "Niederlassungsfreiheit von Unternehmen in Europa - Eine kurze Bestandsaufnahme"
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text, verfasst von Frank Winnenbrock, MBL-HSG, am 20.2.09, befasst sich mit der Niederlassungsfreiheit von Unternehmen in Europa und der Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bei der Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung.
Welche Rolle spielt der EuGH laut dem Text?
Der EuGH wird als Wächter der Grundfreiheiten angesehen, der durch seine Rechtsprechung im Bereich der direkten Steuern Druck auf eine stärkere Harmonisierung oder Koordinierung der Unternehmensbesteuerung in Europa ausübt.
Welches Urteil des EuGH wird als Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung genannt?
Die Entscheidung zur Rechtssache Avoir Fiscal aus dem Jahr 1986 wird als Ausgangspunkt für die Rechtsprechung des EuGH in diesem Bereich genannt.
Wie wird die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur Angleichung ihrer Steuersysteme eingeschätzt?
Die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur Angleichung ihrer Steuersysteme und Steuersätze wird als gering eingeschätzt, da das Steueraufkommen zu den Lebensgrundlagen eines demokratisch verfassten Staates zählt.
Welches Paradoxon wird im Text erwähnt?
Es wird ein Europäisches Steuerparadoxon konstatiert, wonach die Mitgliedstaaten ihre Steuerhoheiten unter dem Druck der Märkte wohl nur durch ein gemeinsames Regelwerk sichern können.
Welche Forderung wird an die Mitgliedstaaten gestellt?
Die Mitgliedstaaten sollten ihre Anstrengungen zur Verwirklichung eines Reformkonzeptes verstärken, das den Wertschöpfenden grenzüberschreitend eine optimale Allokation ihrer betrieblichen Ressourcen und Produktionsfaktoren ermöglicht.
Wie wird die Niederlassungsfreiheit im Text definiert?
Die Niederlassungsfreiheit sollte nicht nur auf die Zuzugsfreiheit reduziert werden. Zuzugs- und Wegzugsfreiheit sind die zwei Seiten der einheitlichen Medaille „Niederlassungsfreiheit”.
Welche Quellen werden im Text zitiert?
Folgende Quellen werden zitiert:
- Fuest, Steuerharmonisierung, 2006, S. 6.
- Hey, StuW 2004, S. 193, 198.
- Jacobs, Unternehmensbesteuerung, 2007, S. 270.
- Campos Nave, BB 2008, S. 1410, 1413.
- Arbeit zitieren
- Frank Winnenbrock (Autor:in), 2009, Niederlassungsfreiheit von Unternehmen in Europa - Eine kurze Bestandsaufnahme, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129127